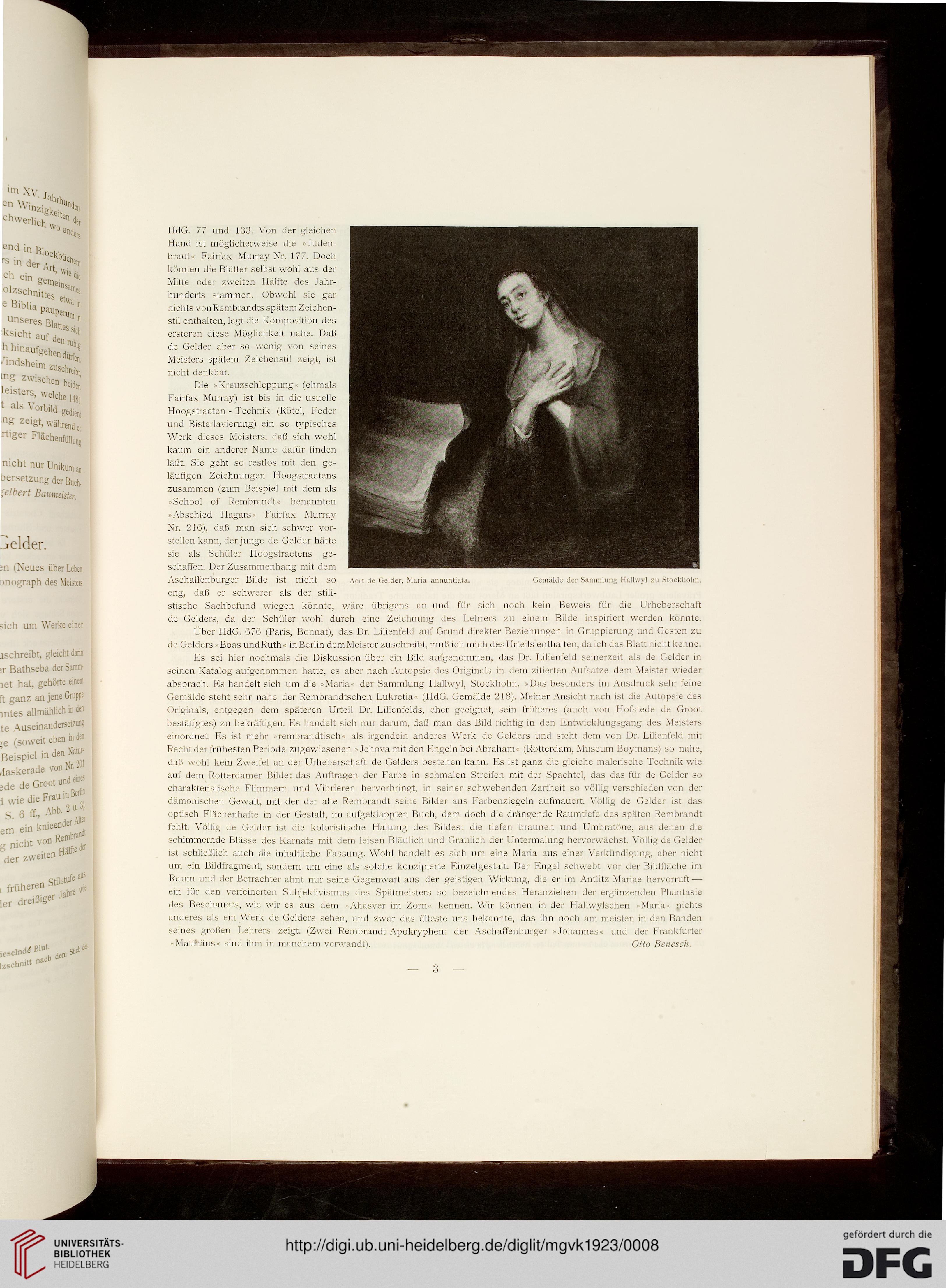1111 XV j
6nd in Blocke
Binder JX
e Bib'ia Pailn
unsere^
",ldShe"11^
t als \ orbüd gediem
nS "igt, während er
rtiger Flächen^
ni^ht nur Unikum aD
bersetzung der Bück.
jelder.
.■n i Neues über Leben
äich um Werke einer
aschreibt, gleicht darin
:r Bathseba der Samm-
let hat, gehörte einen.
ft ganz an jene Gruppe
intes allmählich in *
te Auseinandersetzung
re (soweit ebe
Beispiel in den N»
Maskerade von Nr. 201
.dedeGrootunde*
i wie die rraun
S 6 ff., Abb -
g nicht von
der^'lcnP
■ früheren S&
,er dreißig« J»°
schnitt n*" *»
Aert de Gelder, Maiia annuntiata.
Gemälde der Sammlung Hallwyl zu Stockholm.
HdG. 77 und 133. Von der gleichen
Hand ist möglicherweise die »Juden-
braut« Fairfax Murray Nr. 177. Doch
können die Blätter selbst wohl aus der
Mitte oder zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts stammen. Obwohl sie gar
nichts vonRembrandts spätem Zeichen-
stil enthalten, legt die Komposition des
ersteren diese Möglichkeit nahe. Daß
de Gelder aber so wenig von seines
Meisters spätem Zeichenstil zeigt, ist
nicht denkbar.
Die »Kreuzschleppung« (ehmals
Fairfax Murray) ist bis in die usuelle
Hoogstraeten - Technik (Rötel, Feder
und Bisterlavierung) ein so typisches
Werk dieses Meisters, daß sich wohl
kaum ein anderer Name dafür finden
läßt. Sie geht so restlos mit den ge-
läufigen Zeichnungen Hoogstraetens
zusammen (zum Beispiel mit dem als
»School of Rembrandt« benannten
■ Abschied Hagars« Fairfax Murray
Nr. 216), daß man sich schwer vor-
stellen kann, der junge de Gelder hätte
sie als Schüler Hoogstraetens ge-
schaffen. Der Zusammenhang mit dem
Aschaffenburger Bilde ist nicht so
eng, daß er schwerer als der stili-
stische Sachbefund wiegen könnte, wäre übrigens an und für sich noch kein Beweis für die Urheberschaft
de Gelders, da der Schüler wohl durch eine Zeichnung des Lehrers zu einem Bilde inspiriert werden könnte.
Über HdG. 676 (Paris, Bonnat), das Dr. Lilienfeld auf Grund direkter Beziehungen in Gruppierung und Gesten zu
de Gelders »Boas undRuth« inBerlin demMeister zuschreibt, muß ich mich desUrteilsenthalten, da ich das Blatt nicht kenne.
Es sei hier nochmals die Diskussion über ein Bild aufgenommen, das Dr. Lilienfeld seinerzeit als de Gelder in
seinen Katalog aufgenommen hatte, es aber nach Autopsie des Originals in dem zitierten Aufsatze dem Meister wieder
absprach. Es handelt sich um die »Maria« der Sammlung Hallwyl, Stockholm. »Das besonders im Ausdruck sehr feine
Gemälde steht sehr nahe der Rembrandtschen Lukretia« (HdG. Gemälde 218). Meiner Ansicht nach ist die Autopsie des
Originals, entgegen dem späteren Urteil Dr. Lilienfelds, eher geeignet, sein früheres (auch von Hofstede de Groot
bestätigtes) zu bekräftigen. Es handelt sich nur darum, daß man das Bild richtig in den Entwicklungsgang des Meisters
einordnet. Es ist mehr »rembrandtisch« als irgendein anderes Werk de Gelders und steht dem von Dr. Lilienfeld mit
Recht der frühesten Periode zugewiesenen »Jehovamit den Engeln bei Abraham« (Rotterdam, Museum Boymans) so nahe,
daß wohl kein Zweifel an der Urheberschaft de Gelders bestehen kann. Es ist ganz die gleiche malerische Technik wie
auf dem Rotterdamer Bilde: das Auftragen der Farbe in schmalen Streifen mit der Spachtel, das das für de Gelder so
charakteristische Flimmern und Vibrieren hervorbringt, in seiner schwebenden Zartheit so völlig verschieden von der
dämonischen Gewalt, mit der der alte Rembrandt seine Bilder aus Farbenziegeln aufmauert. Völlig de Gelder ist das
optisch Flächenhafte in der Gestalt, im aufgeklappten Buch, dem doch die drängende Raumtiefe des späten Rembrandt
fehlt. Völlig de Gelder ist die koloristische Haltung des Bildes: die tiefen braunen und Umbratöne, aus denen die
schimmernde Blässe des Karnats mit dem leisen Bläulich und Graulich der Untermalung hervorwächst. Völlig de Gelder
ist schließlich auch die inhaltliche Fassung. Wohl handelt es sich um eine Maria aus einer Verkündigung, aber nicht
um ein Bildfragment, sondern um eine als solche konzipierte Einzelgestalt. Der Engel schwebt vor der Bildfläche im
Raum und der Betrachter ahnt nur seine Gegenwart aus der geistigen Wirkung, die er im Antlitz Mariae hervorruft —
ein für den verfeinerten Subjektivismus des Spätmeisters so bezeichnendes Heranziehen der ergänzenden Phantasie
des Beschauers, wie wir es aus dem »Ahasver im Zorn« kennen. Wir können in der Hallwylschen »Maria« nichts
anderes als ein Werk de Gelders sehen, und zwar das älteste uns bekannte, das ihn noch am meisten in den Banden
seines großen Lehrers zeigt. (Zwei Rembrandt-Apokryphen: der Aschaffenburger »Johannes« und der Frankfurter
-Matthäus« sind ihm in manchem verwandt.. Otto Bcncscli.
— 3
Sag:' -
.-. «,..';■,.,. ", ' ! -v-
Hü
6nd in Blocke
Binder JX
e Bib'ia Pailn
unsere^
",ldShe"11^
t als \ orbüd gediem
nS "igt, während er
rtiger Flächen^
ni^ht nur Unikum aD
bersetzung der Bück.
jelder.
.■n i Neues über Leben
äich um Werke einer
aschreibt, gleicht darin
:r Bathseba der Samm-
let hat, gehörte einen.
ft ganz an jene Gruppe
intes allmählich in *
te Auseinandersetzung
re (soweit ebe
Beispiel in den N»
Maskerade von Nr. 201
.dedeGrootunde*
i wie die rraun
S 6 ff., Abb -
g nicht von
der^'lcnP
■ früheren S&
,er dreißig« J»°
schnitt n*" *»
Aert de Gelder, Maiia annuntiata.
Gemälde der Sammlung Hallwyl zu Stockholm.
HdG. 77 und 133. Von der gleichen
Hand ist möglicherweise die »Juden-
braut« Fairfax Murray Nr. 177. Doch
können die Blätter selbst wohl aus der
Mitte oder zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts stammen. Obwohl sie gar
nichts vonRembrandts spätem Zeichen-
stil enthalten, legt die Komposition des
ersteren diese Möglichkeit nahe. Daß
de Gelder aber so wenig von seines
Meisters spätem Zeichenstil zeigt, ist
nicht denkbar.
Die »Kreuzschleppung« (ehmals
Fairfax Murray) ist bis in die usuelle
Hoogstraeten - Technik (Rötel, Feder
und Bisterlavierung) ein so typisches
Werk dieses Meisters, daß sich wohl
kaum ein anderer Name dafür finden
läßt. Sie geht so restlos mit den ge-
läufigen Zeichnungen Hoogstraetens
zusammen (zum Beispiel mit dem als
»School of Rembrandt« benannten
■ Abschied Hagars« Fairfax Murray
Nr. 216), daß man sich schwer vor-
stellen kann, der junge de Gelder hätte
sie als Schüler Hoogstraetens ge-
schaffen. Der Zusammenhang mit dem
Aschaffenburger Bilde ist nicht so
eng, daß er schwerer als der stili-
stische Sachbefund wiegen könnte, wäre übrigens an und für sich noch kein Beweis für die Urheberschaft
de Gelders, da der Schüler wohl durch eine Zeichnung des Lehrers zu einem Bilde inspiriert werden könnte.
Über HdG. 676 (Paris, Bonnat), das Dr. Lilienfeld auf Grund direkter Beziehungen in Gruppierung und Gesten zu
de Gelders »Boas undRuth« inBerlin demMeister zuschreibt, muß ich mich desUrteilsenthalten, da ich das Blatt nicht kenne.
Es sei hier nochmals die Diskussion über ein Bild aufgenommen, das Dr. Lilienfeld seinerzeit als de Gelder in
seinen Katalog aufgenommen hatte, es aber nach Autopsie des Originals in dem zitierten Aufsatze dem Meister wieder
absprach. Es handelt sich um die »Maria« der Sammlung Hallwyl, Stockholm. »Das besonders im Ausdruck sehr feine
Gemälde steht sehr nahe der Rembrandtschen Lukretia« (HdG. Gemälde 218). Meiner Ansicht nach ist die Autopsie des
Originals, entgegen dem späteren Urteil Dr. Lilienfelds, eher geeignet, sein früheres (auch von Hofstede de Groot
bestätigtes) zu bekräftigen. Es handelt sich nur darum, daß man das Bild richtig in den Entwicklungsgang des Meisters
einordnet. Es ist mehr »rembrandtisch« als irgendein anderes Werk de Gelders und steht dem von Dr. Lilienfeld mit
Recht der frühesten Periode zugewiesenen »Jehovamit den Engeln bei Abraham« (Rotterdam, Museum Boymans) so nahe,
daß wohl kein Zweifel an der Urheberschaft de Gelders bestehen kann. Es ist ganz die gleiche malerische Technik wie
auf dem Rotterdamer Bilde: das Auftragen der Farbe in schmalen Streifen mit der Spachtel, das das für de Gelder so
charakteristische Flimmern und Vibrieren hervorbringt, in seiner schwebenden Zartheit so völlig verschieden von der
dämonischen Gewalt, mit der der alte Rembrandt seine Bilder aus Farbenziegeln aufmauert. Völlig de Gelder ist das
optisch Flächenhafte in der Gestalt, im aufgeklappten Buch, dem doch die drängende Raumtiefe des späten Rembrandt
fehlt. Völlig de Gelder ist die koloristische Haltung des Bildes: die tiefen braunen und Umbratöne, aus denen die
schimmernde Blässe des Karnats mit dem leisen Bläulich und Graulich der Untermalung hervorwächst. Völlig de Gelder
ist schließlich auch die inhaltliche Fassung. Wohl handelt es sich um eine Maria aus einer Verkündigung, aber nicht
um ein Bildfragment, sondern um eine als solche konzipierte Einzelgestalt. Der Engel schwebt vor der Bildfläche im
Raum und der Betrachter ahnt nur seine Gegenwart aus der geistigen Wirkung, die er im Antlitz Mariae hervorruft —
ein für den verfeinerten Subjektivismus des Spätmeisters so bezeichnendes Heranziehen der ergänzenden Phantasie
des Beschauers, wie wir es aus dem »Ahasver im Zorn« kennen. Wir können in der Hallwylschen »Maria« nichts
anderes als ein Werk de Gelders sehen, und zwar das älteste uns bekannte, das ihn noch am meisten in den Banden
seines großen Lehrers zeigt. (Zwei Rembrandt-Apokryphen: der Aschaffenburger »Johannes« und der Frankfurter
-Matthäus« sind ihm in manchem verwandt.. Otto Bcncscli.
— 3
Sag:' -
.-. «,..';■,.,. ", ' ! -v-
Hü