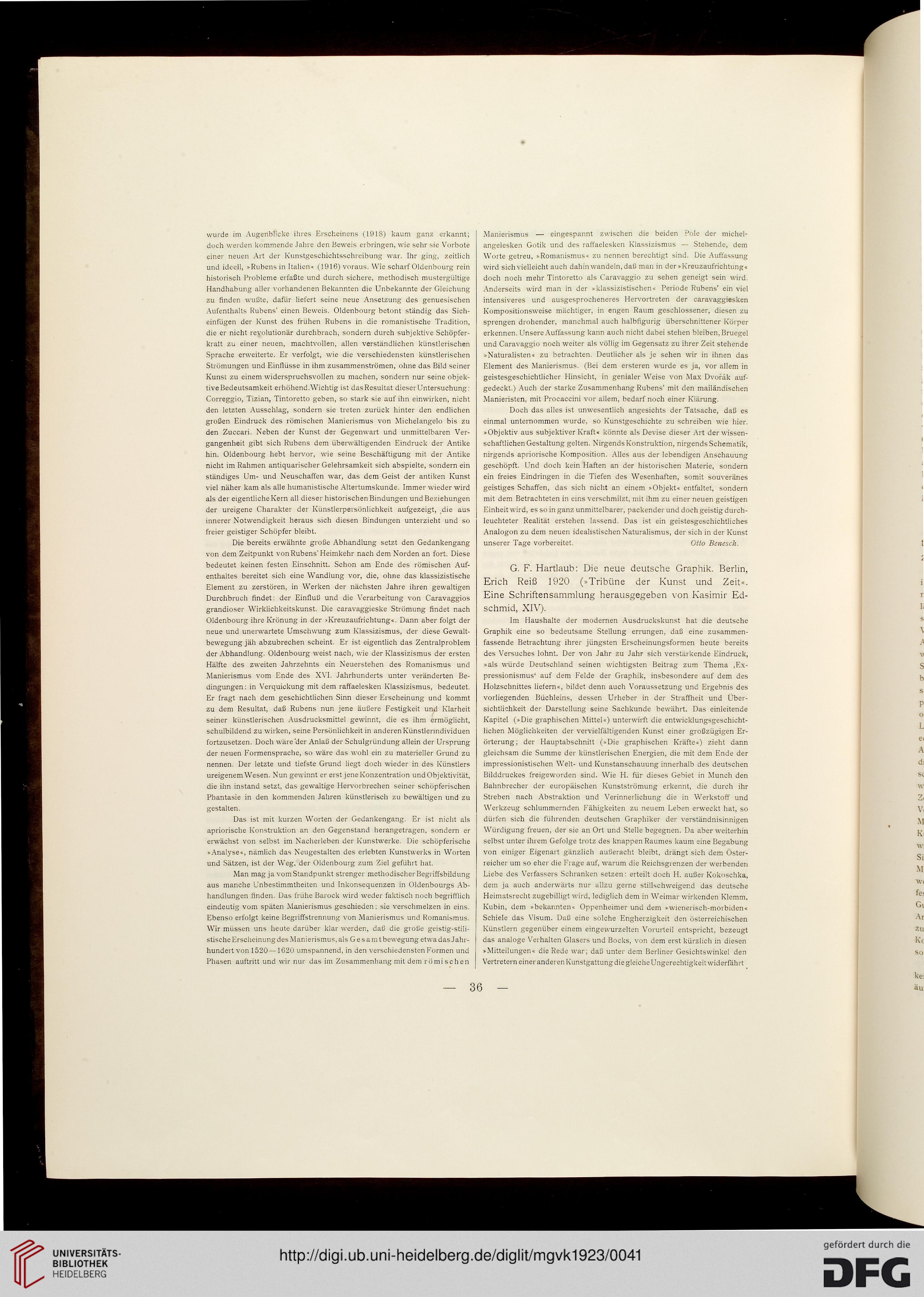wurde im Augenblicke ihres Erscheinens (1918) kaum ganz erkannt;
doch werden kommende Jahre den Beweis erbringen, wie sehr sie Vorbote
einer neuen Art der Kunstgeschichtsschreibung war, Ihr ging, zeitlich
und ideell, »Rubens in Italien« (1916) voraus. Wie scharf Oldenbourg rein
historisch Probleme erfaßte und durch sichere, methodisch mustergültige
Handhabung aller vorhandenen Bekannten die Unbekannte der Gleichung
zu finden wußte, dafür liefert seine neue Ansetzung des genuesischen
Aufenthalts Rubens' einen Beweis. Oldenbourg betont ständig das Sich-
einfügen der Kunst des frühen Rubens in die romanistische Tradition,
die er nicht revolutionär durchbrach, sondern durch subjektive Schöpfer-
kraft zu einer neuen, machtvollen, allen verständlichen künstlerischen
Sprache erweiterte. Er verfolgt, wie die verschiedensten künstlerischen
Strömungen und Einflüsse in ihm zusammenströmen, ohne das Bild seiner
Kunst zu einem-widerspruchsvollen zu machen, sondern nur seine objek-
tive Bedeutsamkeit erhöhend.Wichtig ist dasResultat dieser Untersuchung:
Correggio, Tizian, Tintoretto geben, so stark sie auf ihn einwirken, nicht
den letzten Ausschlag, sondern sie treten zurück hinter den endlichen
großen Eindruck des römischen Manierismus von Michelangelo bis zu
den Zuccari. Neben der Kunst der Gegenwart und unmittelbaren Ver-
gangenheit gibt sich Rubens dem überwältigenden Eindruck der Antike
hin. Oldenbourg hebt hervor, wie seine Beschäftigung mit der Antike
nicht im Rahmen antiquarischer Gelehrsamkeit sich abspielte, sondern ein
ständiges Um- und Neuschaffen war, das dem Geist der antiken Kunst
viel näher kam als alle humanistische Altertumskunde, Immer wieder wird
als der eigentliche Kern all dieser historischen Bindungen und Beziehungen
der ureigene Charakter der Kunstlerpersönlichkeit aufgezeigt, die aus
innerer Notwendigkeit heraus sich diesen Bindungen unterzieht und so
freier geistiger Schöpfer bleibt.
Die bereits erwähnte große Abhandlung setzt den Gedankengang
von dem Zeitpunkt vonRubens'Heimkehr nach dem Norden an fort. Diese
bedeutet keinen festen Einschnitt. Schon am Ende des römischen Auf-
enthaltes bereitet sich eine Wandlung vor, die, ohne das klassizistische
Element zu zerstören, in Werken der nächsten Jahre ihren gewaltigen
Durchbruch findet: der Einfluß und die Verarbeitung von Caravaggios
grandioser Wirklichkeitskunst. Die caravaggieske Strömung findet nach
Oldenbourg ihre Krönung in der >Kreuzaufrichtung«. Dann aber folgt der
neue und unerwartete Umschwung zum Klassizismus, der diese Gewalt-
bewegung jäh abzubrechen scheint. Er ist eigentlich das Zentralproblem
der Abhandlung. Oldenbourg weist nach, wie der Klassizismus der ersten
Hälfte des zweiten Jahrzehnts ein Neuerstehen des Romanismus und
Manierismus vom Ende des XVI. Jahrhunderts unter veränderten Be-
dingungen: in Verquickung mit dem raffaelesken Klassizismus, bedeutet.
Er fragt nach dem geschichtlichen Sinn dieser Erscheinung und kommt
zu dem Resultat, daß Rubens nun jene äußere Festigkeit und Klarheit
seiner künstlerischen Ausdrucksmittel gewinnt, die es ihm ermöglicht,
schulbildend zu wirken, seine Persönlichkeit in anderenKünstlermdividuen
fortzusetzen. Doch wäre "der Anlaß der Schulgründung allein der Ursprung
der neuen Formensprache, so wäre das wohl ein zu materieller Grund zu
nennen. Der letzte und tiefste Grund liegt doch wieder in des Künstlers
ureigenem Wesen. Nun gewinnt er erst jene Konzentration und Objektivität,
die ihn instand setzt, das gewaltige Hervorbrechen seiner schöpferischen
Phantasie in den kommenden Jahren künstlerisch zu bewältigen und zu
gestalten.
Das ist mit kurzen Worten der Gedankengang. Er ist nicht als
apriorische Konstruktion an den Gegenstand herangetragen, sondern er
erwächst von selbst im Nacherleben der Kunstwerke. Die schöpferische
»Analyse«, nämlich das Neugestalten des erlebten Kunstwerks in Worten
und Sätzen, ist der Weg, der Oldenbourg zum Ziel geführt hat.
Man mag ja vom Standpunkt strenger methodischer Begriffsbildung
aus manche Unbestimmtheiten und Inkonsequenzen in Oldenbourgs Ab-
handlungen finden. Das frühe Barock wird weder faktisch noch begrifflich
eindeutig vom späten Manierismus geschieden; sie verschmelzen in eins.
Ebenso erfolgt keine Begriffstrennung von Manierismus und Romanismus.
Wir müssen uns heute darüber klar werden, daß die große geistig-stili-
stische Erscheinung des Manierismus, als G e s am t bewegung etwa das Jahr-
hundert von 1520—1620 umspannend, in den verschiedensten Formen und
Phasen auftritt und wir nur das im Zusammenhang mit dem römi sehen
Manierismus — eingespannt zwischen die beiden Pole der michel-
angelesken Gotik und des raffaelesken Klassizismus — Stehende, dem
Woite getreu, »Romanismus* zu nennen berechtigt sind. Die Auffassung
wird sich vielleicht auch dahin wandeln, daß man in der »Kreuzaufrichtung*
doch noch mehr Tintoretto als Caravaggio zu sehen geneigt sein wird.
Anderseits wird man in der »klassizistischen* Periode Rubens' ein viel
intensiveres und ausgesprocheneres Hervortreten der caravaggiesken
Kompositionsweise mächtiger, in engen Raum geschlossener, diesen zu
sprengen drohender, manchmal auch halbfigurig überschnittener Körper
erkennen. Unsere Auffassung kann auch nicht dabei stehen bleiben, Bruegel
und Caravaggio noch weiter als völlig im Gegensatz zu ihrer Zeit stehende
»Naturalisten« zu betrachten. Deutlicher als je sehen wir in ihnen das
Element des Manierismus. (Bei dem ersteren wurde es ja, vor allem in
geistesgeschichtlicher Hinsicht, in genialer Weise von Max Dvorak auf-
gedeckt.) Auch der starke Zusammenhang Rubens' mit den mailändischen
Manieristen, mit Procaccini vor allem, bedarf noch einer Klärung.
Doch das alles ist unwesentlich angesichts der Tatsache, daß es
einmal unternommen wurde, so Kunstgeschichte zu schreiben wie hier.
»Objektiv aus subjektiver Kraft« könnte als Devise dieser Art der wissen-
schaftlichen Gestaltung gelten. Nirgends Konstruktion, nirgends Schematik,
nirgends apriorische Komposition. Alles aus der lebendigen Anschauung
geschöpft. Und doch kein Haften an der historischen Materie, sondern
ein freies Eindringen in die Tiefen des Wesenhaften, somit souveränes
geistiges Schaffen, das sich nicht an einem »Objekt« entfaltet, sondern
mit dem Betrachteten in eins verschmilzt, mit ihm zu einer neuen geistigen
Einheit wird, es so in ganz unmittelbarer, packender und doch geistig durch-
leuchteter Realität erstehen lassend. Das ist ein geistesgeschichtliches
Analogon zu dem neuen idealistischen Naturalismus, der sich in der Kunst
unserer Tage vorbereitet. Otto Benesch.
G. F. Hartlaub; Die neue deutsche Graphik. Berlin,
Erich Reiß 1920 (■■Tribüne der Kunst und Zeit«.
Eine Schriften Sammlung herausgegeben von Kasimir Ed-
schmid, XIV).
Im Haushalte der modernen Ausdruckskunst hat die deutsche
Graphik eine so bedeutsame Stellung errungen, daß eine zusammen-
fassende Betrachtung ihrer jüngsten Erscheinungsformen heute bereits
des Versuches lohnt. Der von Jahr zu Jahr sich verstärkende Eindruck,
»als würde Deutschland seinen wichtigsten Beitrag zum Thema .Ex-
pressionismus' auf dem Eelde der Graphik, insbesondere auf dem des
Holzschnittes liefern«, bildet denn auch Voraussetzung und Ergebnis des
vorliegenden Büchleins, dessen Urheber in der Straffheit und Über-
sichtlichkeit der Darstellung seine Sachkunde bewährt. Das einleitende
Kapitel (»Die graphischen Mittel«) unterwirft die entwicklungsgeschicht-
lichen Möglichkeiten der vervielfältigenden Kunst einer großzügigen Er-
örterung; der Hauptabschnitt (»Die graphischen Kräfte«) zieht dann
gleichsam die Summe der künstlerischen Energien, die mit dem Ende der
impressionistischen Welt- und Kunstanschauung innerhalb des deutschen
Bilddruckes freigeworden sind. Wie H. für dieses Gebiet in Munch den
Bahnbrecher der europäischen Kunstströmung erkennt, die durch ihr
Stieben nach Abstraktion und Verinnerlichung die in Werkstoff und
Werkzeug schlummernden Fähigkeiten zu neuem Leben erweckt hat, so
dürfen sich die führenden deutschen Graphiker der verständnisinnigen
Würdigung freuen, der sie an Ort und Stelle begegnen. Da aber weiterhin
selbst unter ihrem Gefolge trotz des knappen Raumes kaum eine Begabung
von einiger Eigenart gänzlich außeracht bleibt, drängt sich dem Öster-
reicher um so eher die Frage auf, warum die Reichsgrenzen der werbenden
Liebe des Verfassers Schranken setzen: erteilt doch H. außer Kokoschka,
dem ja auch anderwärts nur allzu gerne stillschweigend das deutsche
Heimatsrecht zugebilligt wird, lediglich dem in Weimar wirkenden Klemm,
Kubin, dem »bekannten« Oppenheimer und dem »wienerisch-moibiden«
Schiele das Visum. Daß eine solche Engherzigkeit den österreichischen
Künstlern gegenüber einem eingewurzelten Vorurteil entspricht, bezeugt
das analoge Verhalten Glasers und Bocks, von dem erst kürzlich in diesen
»Mitteilungen« die Rede war; daß unter dem Berliner Gesichtswinkel den
Vertretern einer anderen Kunstgattung die gleiche Ungerechtigkeit widerfährt
36
doch werden kommende Jahre den Beweis erbringen, wie sehr sie Vorbote
einer neuen Art der Kunstgeschichtsschreibung war, Ihr ging, zeitlich
und ideell, »Rubens in Italien« (1916) voraus. Wie scharf Oldenbourg rein
historisch Probleme erfaßte und durch sichere, methodisch mustergültige
Handhabung aller vorhandenen Bekannten die Unbekannte der Gleichung
zu finden wußte, dafür liefert seine neue Ansetzung des genuesischen
Aufenthalts Rubens' einen Beweis. Oldenbourg betont ständig das Sich-
einfügen der Kunst des frühen Rubens in die romanistische Tradition,
die er nicht revolutionär durchbrach, sondern durch subjektive Schöpfer-
kraft zu einer neuen, machtvollen, allen verständlichen künstlerischen
Sprache erweiterte. Er verfolgt, wie die verschiedensten künstlerischen
Strömungen und Einflüsse in ihm zusammenströmen, ohne das Bild seiner
Kunst zu einem-widerspruchsvollen zu machen, sondern nur seine objek-
tive Bedeutsamkeit erhöhend.Wichtig ist dasResultat dieser Untersuchung:
Correggio, Tizian, Tintoretto geben, so stark sie auf ihn einwirken, nicht
den letzten Ausschlag, sondern sie treten zurück hinter den endlichen
großen Eindruck des römischen Manierismus von Michelangelo bis zu
den Zuccari. Neben der Kunst der Gegenwart und unmittelbaren Ver-
gangenheit gibt sich Rubens dem überwältigenden Eindruck der Antike
hin. Oldenbourg hebt hervor, wie seine Beschäftigung mit der Antike
nicht im Rahmen antiquarischer Gelehrsamkeit sich abspielte, sondern ein
ständiges Um- und Neuschaffen war, das dem Geist der antiken Kunst
viel näher kam als alle humanistische Altertumskunde, Immer wieder wird
als der eigentliche Kern all dieser historischen Bindungen und Beziehungen
der ureigene Charakter der Kunstlerpersönlichkeit aufgezeigt, die aus
innerer Notwendigkeit heraus sich diesen Bindungen unterzieht und so
freier geistiger Schöpfer bleibt.
Die bereits erwähnte große Abhandlung setzt den Gedankengang
von dem Zeitpunkt vonRubens'Heimkehr nach dem Norden an fort. Diese
bedeutet keinen festen Einschnitt. Schon am Ende des römischen Auf-
enthaltes bereitet sich eine Wandlung vor, die, ohne das klassizistische
Element zu zerstören, in Werken der nächsten Jahre ihren gewaltigen
Durchbruch findet: der Einfluß und die Verarbeitung von Caravaggios
grandioser Wirklichkeitskunst. Die caravaggieske Strömung findet nach
Oldenbourg ihre Krönung in der >Kreuzaufrichtung«. Dann aber folgt der
neue und unerwartete Umschwung zum Klassizismus, der diese Gewalt-
bewegung jäh abzubrechen scheint. Er ist eigentlich das Zentralproblem
der Abhandlung. Oldenbourg weist nach, wie der Klassizismus der ersten
Hälfte des zweiten Jahrzehnts ein Neuerstehen des Romanismus und
Manierismus vom Ende des XVI. Jahrhunderts unter veränderten Be-
dingungen: in Verquickung mit dem raffaelesken Klassizismus, bedeutet.
Er fragt nach dem geschichtlichen Sinn dieser Erscheinung und kommt
zu dem Resultat, daß Rubens nun jene äußere Festigkeit und Klarheit
seiner künstlerischen Ausdrucksmittel gewinnt, die es ihm ermöglicht,
schulbildend zu wirken, seine Persönlichkeit in anderenKünstlermdividuen
fortzusetzen. Doch wäre "der Anlaß der Schulgründung allein der Ursprung
der neuen Formensprache, so wäre das wohl ein zu materieller Grund zu
nennen. Der letzte und tiefste Grund liegt doch wieder in des Künstlers
ureigenem Wesen. Nun gewinnt er erst jene Konzentration und Objektivität,
die ihn instand setzt, das gewaltige Hervorbrechen seiner schöpferischen
Phantasie in den kommenden Jahren künstlerisch zu bewältigen und zu
gestalten.
Das ist mit kurzen Worten der Gedankengang. Er ist nicht als
apriorische Konstruktion an den Gegenstand herangetragen, sondern er
erwächst von selbst im Nacherleben der Kunstwerke. Die schöpferische
»Analyse«, nämlich das Neugestalten des erlebten Kunstwerks in Worten
und Sätzen, ist der Weg, der Oldenbourg zum Ziel geführt hat.
Man mag ja vom Standpunkt strenger methodischer Begriffsbildung
aus manche Unbestimmtheiten und Inkonsequenzen in Oldenbourgs Ab-
handlungen finden. Das frühe Barock wird weder faktisch noch begrifflich
eindeutig vom späten Manierismus geschieden; sie verschmelzen in eins.
Ebenso erfolgt keine Begriffstrennung von Manierismus und Romanismus.
Wir müssen uns heute darüber klar werden, daß die große geistig-stili-
stische Erscheinung des Manierismus, als G e s am t bewegung etwa das Jahr-
hundert von 1520—1620 umspannend, in den verschiedensten Formen und
Phasen auftritt und wir nur das im Zusammenhang mit dem römi sehen
Manierismus — eingespannt zwischen die beiden Pole der michel-
angelesken Gotik und des raffaelesken Klassizismus — Stehende, dem
Woite getreu, »Romanismus* zu nennen berechtigt sind. Die Auffassung
wird sich vielleicht auch dahin wandeln, daß man in der »Kreuzaufrichtung*
doch noch mehr Tintoretto als Caravaggio zu sehen geneigt sein wird.
Anderseits wird man in der »klassizistischen* Periode Rubens' ein viel
intensiveres und ausgesprocheneres Hervortreten der caravaggiesken
Kompositionsweise mächtiger, in engen Raum geschlossener, diesen zu
sprengen drohender, manchmal auch halbfigurig überschnittener Körper
erkennen. Unsere Auffassung kann auch nicht dabei stehen bleiben, Bruegel
und Caravaggio noch weiter als völlig im Gegensatz zu ihrer Zeit stehende
»Naturalisten« zu betrachten. Deutlicher als je sehen wir in ihnen das
Element des Manierismus. (Bei dem ersteren wurde es ja, vor allem in
geistesgeschichtlicher Hinsicht, in genialer Weise von Max Dvorak auf-
gedeckt.) Auch der starke Zusammenhang Rubens' mit den mailändischen
Manieristen, mit Procaccini vor allem, bedarf noch einer Klärung.
Doch das alles ist unwesentlich angesichts der Tatsache, daß es
einmal unternommen wurde, so Kunstgeschichte zu schreiben wie hier.
»Objektiv aus subjektiver Kraft« könnte als Devise dieser Art der wissen-
schaftlichen Gestaltung gelten. Nirgends Konstruktion, nirgends Schematik,
nirgends apriorische Komposition. Alles aus der lebendigen Anschauung
geschöpft. Und doch kein Haften an der historischen Materie, sondern
ein freies Eindringen in die Tiefen des Wesenhaften, somit souveränes
geistiges Schaffen, das sich nicht an einem »Objekt« entfaltet, sondern
mit dem Betrachteten in eins verschmilzt, mit ihm zu einer neuen geistigen
Einheit wird, es so in ganz unmittelbarer, packender und doch geistig durch-
leuchteter Realität erstehen lassend. Das ist ein geistesgeschichtliches
Analogon zu dem neuen idealistischen Naturalismus, der sich in der Kunst
unserer Tage vorbereitet. Otto Benesch.
G. F. Hartlaub; Die neue deutsche Graphik. Berlin,
Erich Reiß 1920 (■■Tribüne der Kunst und Zeit«.
Eine Schriften Sammlung herausgegeben von Kasimir Ed-
schmid, XIV).
Im Haushalte der modernen Ausdruckskunst hat die deutsche
Graphik eine so bedeutsame Stellung errungen, daß eine zusammen-
fassende Betrachtung ihrer jüngsten Erscheinungsformen heute bereits
des Versuches lohnt. Der von Jahr zu Jahr sich verstärkende Eindruck,
»als würde Deutschland seinen wichtigsten Beitrag zum Thema .Ex-
pressionismus' auf dem Eelde der Graphik, insbesondere auf dem des
Holzschnittes liefern«, bildet denn auch Voraussetzung und Ergebnis des
vorliegenden Büchleins, dessen Urheber in der Straffheit und Über-
sichtlichkeit der Darstellung seine Sachkunde bewährt. Das einleitende
Kapitel (»Die graphischen Mittel«) unterwirft die entwicklungsgeschicht-
lichen Möglichkeiten der vervielfältigenden Kunst einer großzügigen Er-
örterung; der Hauptabschnitt (»Die graphischen Kräfte«) zieht dann
gleichsam die Summe der künstlerischen Energien, die mit dem Ende der
impressionistischen Welt- und Kunstanschauung innerhalb des deutschen
Bilddruckes freigeworden sind. Wie H. für dieses Gebiet in Munch den
Bahnbrecher der europäischen Kunstströmung erkennt, die durch ihr
Stieben nach Abstraktion und Verinnerlichung die in Werkstoff und
Werkzeug schlummernden Fähigkeiten zu neuem Leben erweckt hat, so
dürfen sich die führenden deutschen Graphiker der verständnisinnigen
Würdigung freuen, der sie an Ort und Stelle begegnen. Da aber weiterhin
selbst unter ihrem Gefolge trotz des knappen Raumes kaum eine Begabung
von einiger Eigenart gänzlich außeracht bleibt, drängt sich dem Öster-
reicher um so eher die Frage auf, warum die Reichsgrenzen der werbenden
Liebe des Verfassers Schranken setzen: erteilt doch H. außer Kokoschka,
dem ja auch anderwärts nur allzu gerne stillschweigend das deutsche
Heimatsrecht zugebilligt wird, lediglich dem in Weimar wirkenden Klemm,
Kubin, dem »bekannten« Oppenheimer und dem »wienerisch-moibiden«
Schiele das Visum. Daß eine solche Engherzigkeit den österreichischen
Künstlern gegenüber einem eingewurzelten Vorurteil entspricht, bezeugt
das analoge Verhalten Glasers und Bocks, von dem erst kürzlich in diesen
»Mitteilungen« die Rede war; daß unter dem Berliner Gesichtswinkel den
Vertretern einer anderen Kunstgattung die gleiche Ungerechtigkeit widerfährt
36