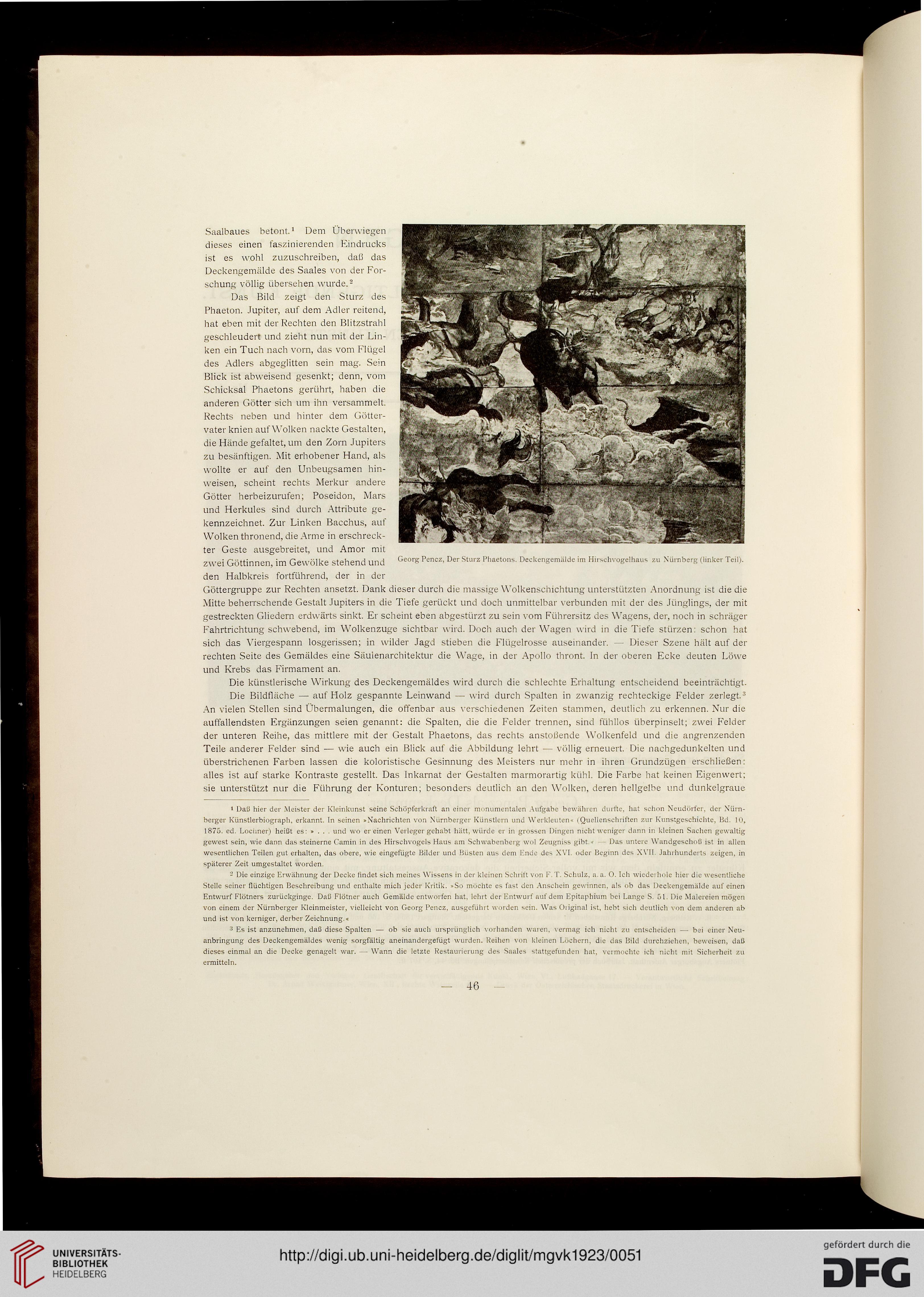Saalbaues betont.1 Dem Überwiegen
dieses einen faszinierenden Eindrucks
ist es wohl zuzuschreiben, daß das
Deckengemälde des Saales von der For-
schung völlig übersehen wurde.2
Das Bild zeigt den Sturz des
Phaeton. Jupiter, auf dem Adler reitend,
hat eben mit der Rechten den Blitzstrahl
geschleudert und zieht nun mit der Lin-
ken ein Tuch nach vorn, das vom Flügel
des Adlers abgeglitten sein mag. Sein
Blick ist abweisend gesenkt; denn, vom
Schicksal Phaetons gerührt, haben die
anderen Götter sich um ihn versammelt.
Rechts neben und hinter dem Götter-
vater knien auf Wolken nackte Gestalten,
die Hände gefaltet, um den Zorn Jupiters
zu besänftigen. Mit erhobener Hand, als
wollte er auf den Unbeugsamen hin-
weisen, scheint rechts Merkur andere
Götter herbeizurufen; Poseidon, Mars
und Herkules sind durch Attribute ge-
kennzeichnet. Zur Linken Bacchus, auf
Wolken thronend, die Arme in erschreck-
ter Geste ausgebreitet, und Amor mit
zwei Göttinnen, im Gewölke stehend und
den Halbkreis fortführend, der in der
Göttergruppe zur Rechten ansetzt. Dank dieser durch die massige Wolkenschichtung unterstützten Anordnung ist die die
Mitte beherrschende Gestalt Jupiters in die Tiefe gerückt und doch unmittelbar verbunden mit der des Jünglings, der mit
gestreckten Gliedern erdwärts sinkt. Er scheint eben abgestürzt zu sein vom Führersitz des Wagens, der, noch in schräger
Fahrtrichtung schwebend, im Wolkenzuge sichtbar wird. Doch auch der Wagen wird in die Tiefe stürzen: schon hat
sich das Viergespann losgerissen; in wilder Jagd stieben die Flügelrosse auseinander. — Dieser Szene hält auf der
rechten Seite des Gemäldes eine Säulenarchitektur die Wage, in der Apollo thront. In der oberen Ecke deuten Löwe
und Krebs das Firmament an.
Die künstlerische Wirkung des Deckengemäldes wird durch die schlechte Erhaltung entscheidend beeinträchtigt.
Die Bildfläche — auf Holz gespannte Leinwand — wird durch Spalten in zwanzig rechteckige Felder zerlegt.3
An vielen Stellen sind Übermalungen, die offenbar aus verschiedenen Zeiten stammen, deutlich zu erkennen. Nur die
auffallendsten Ergänzungen seien genannt: die Spalten, die die Felder trennen, sind fühllos überpinselt; zwei Felder
der unteren Reihe, das mittlere mit der Gestalt Phaetons, das rechts anstoßende Wolkenfeld und die angrenzenden
Teile anderer Felder sind — wie auch ein Blick auf die Abbildung lehrt — völlig erneuert. Die nachgedunkelten und
überstrichenen Farben lassen die koloristische Gesinnung des Meisters nur mehr in ihren Grundzügen erschließen:
alles ist auf starke Kontraste gestellt. Das Inkarnat der Gestalten marmorartig kühl. Die Farbe hat keinen Eigenwert;
sie unterstützt nur die Führung der Konturen; besonders deutlich an den Wolken, deren hellgelbe und dunkelgraue
Georg Pencz, Der Sturz Phaetons. Deckengemälde im Hn
ans zu Nürnberg (linker Teil).
i Daß hier der Meister der Kleinkunst seine Schöpferkraft an einer monumentalen Aufgahe bewähren durfte, hat schon Neudörfer, der Nürn-
berger Künstlerbiograph, erkannt. In seinen »Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werkleuten« (Quellenschriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10,
1875. ed. Lochner) heißt es: » ... und wo er einen Vei leger gehabt hätt, würde er in grossen Dingen nicht weniger dann in kleinen Sachen gewaltig
gewest sein, wie dann das steinerne Camin in des Hirschvogels Haus am Sehwabenberg wol Zeugniss gibt « - Das untere Wandgescholl ist in allen
wesentlichen Teilen gut erhalten, das obere, wie eingefügte Bilder und Büsten aus dem Ende des XVI. oder Beginn des XVII Jahrhunderts zeigen, in
späterer Zeit umgestaltet worden.
- Die einzige Erwähnung der Decke findet sich meines Wissens in der kleinen Schritt von V T. Schulz, a. a. O. Ich wiederhole hier die wesentliche
Stelle seiner flüchtigen Beschreibung und enthalte mich jeder Kritik. »So mochte es fast den Anschein gewinnen, als ob das Deckengemälde auf einen
Entwurf Flötners zurückginge. Daß Flötner auch Gemälde entworfen hat, lehrt der Entwurf auf dem Epitaphium bei Lange S. 51. Die Maiereien mögen
von einem der Nürnberger Kleinmeister, vielleicht von Georg Pencz, ausgefühlt worden sein. Was Oiiginal ist, hebt sich deutlich von dem anderen ab
und ist von kerniger, derber Zeichnung.«
3 Es ist anzunehmen, daß diese Spalten — ob sie auch ursprünglich vorhanden waren, vermag ich nicht zu entscheiden — bei einer Neu-
anbringung des Deckengemäldes wenig sorgfältig aneinandergefügt wurden. Reihen von kleinen Lüchern, die das Bild durchzielten, beweisen, daß
dieses einmal an die Decke genagelt war. — Wann die letzte Restaurierung des Saaies stattgefunden hat, vermochte ich nicht mit Sicherheit zu
ermitteln.
46
dieses einen faszinierenden Eindrucks
ist es wohl zuzuschreiben, daß das
Deckengemälde des Saales von der For-
schung völlig übersehen wurde.2
Das Bild zeigt den Sturz des
Phaeton. Jupiter, auf dem Adler reitend,
hat eben mit der Rechten den Blitzstrahl
geschleudert und zieht nun mit der Lin-
ken ein Tuch nach vorn, das vom Flügel
des Adlers abgeglitten sein mag. Sein
Blick ist abweisend gesenkt; denn, vom
Schicksal Phaetons gerührt, haben die
anderen Götter sich um ihn versammelt.
Rechts neben und hinter dem Götter-
vater knien auf Wolken nackte Gestalten,
die Hände gefaltet, um den Zorn Jupiters
zu besänftigen. Mit erhobener Hand, als
wollte er auf den Unbeugsamen hin-
weisen, scheint rechts Merkur andere
Götter herbeizurufen; Poseidon, Mars
und Herkules sind durch Attribute ge-
kennzeichnet. Zur Linken Bacchus, auf
Wolken thronend, die Arme in erschreck-
ter Geste ausgebreitet, und Amor mit
zwei Göttinnen, im Gewölke stehend und
den Halbkreis fortführend, der in der
Göttergruppe zur Rechten ansetzt. Dank dieser durch die massige Wolkenschichtung unterstützten Anordnung ist die die
Mitte beherrschende Gestalt Jupiters in die Tiefe gerückt und doch unmittelbar verbunden mit der des Jünglings, der mit
gestreckten Gliedern erdwärts sinkt. Er scheint eben abgestürzt zu sein vom Führersitz des Wagens, der, noch in schräger
Fahrtrichtung schwebend, im Wolkenzuge sichtbar wird. Doch auch der Wagen wird in die Tiefe stürzen: schon hat
sich das Viergespann losgerissen; in wilder Jagd stieben die Flügelrosse auseinander. — Dieser Szene hält auf der
rechten Seite des Gemäldes eine Säulenarchitektur die Wage, in der Apollo thront. In der oberen Ecke deuten Löwe
und Krebs das Firmament an.
Die künstlerische Wirkung des Deckengemäldes wird durch die schlechte Erhaltung entscheidend beeinträchtigt.
Die Bildfläche — auf Holz gespannte Leinwand — wird durch Spalten in zwanzig rechteckige Felder zerlegt.3
An vielen Stellen sind Übermalungen, die offenbar aus verschiedenen Zeiten stammen, deutlich zu erkennen. Nur die
auffallendsten Ergänzungen seien genannt: die Spalten, die die Felder trennen, sind fühllos überpinselt; zwei Felder
der unteren Reihe, das mittlere mit der Gestalt Phaetons, das rechts anstoßende Wolkenfeld und die angrenzenden
Teile anderer Felder sind — wie auch ein Blick auf die Abbildung lehrt — völlig erneuert. Die nachgedunkelten und
überstrichenen Farben lassen die koloristische Gesinnung des Meisters nur mehr in ihren Grundzügen erschließen:
alles ist auf starke Kontraste gestellt. Das Inkarnat der Gestalten marmorartig kühl. Die Farbe hat keinen Eigenwert;
sie unterstützt nur die Führung der Konturen; besonders deutlich an den Wolken, deren hellgelbe und dunkelgraue
Georg Pencz, Der Sturz Phaetons. Deckengemälde im Hn
ans zu Nürnberg (linker Teil).
i Daß hier der Meister der Kleinkunst seine Schöpferkraft an einer monumentalen Aufgahe bewähren durfte, hat schon Neudörfer, der Nürn-
berger Künstlerbiograph, erkannt. In seinen »Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werkleuten« (Quellenschriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10,
1875. ed. Lochner) heißt es: » ... und wo er einen Vei leger gehabt hätt, würde er in grossen Dingen nicht weniger dann in kleinen Sachen gewaltig
gewest sein, wie dann das steinerne Camin in des Hirschvogels Haus am Sehwabenberg wol Zeugniss gibt « - Das untere Wandgescholl ist in allen
wesentlichen Teilen gut erhalten, das obere, wie eingefügte Bilder und Büsten aus dem Ende des XVI. oder Beginn des XVII Jahrhunderts zeigen, in
späterer Zeit umgestaltet worden.
- Die einzige Erwähnung der Decke findet sich meines Wissens in der kleinen Schritt von V T. Schulz, a. a. O. Ich wiederhole hier die wesentliche
Stelle seiner flüchtigen Beschreibung und enthalte mich jeder Kritik. »So mochte es fast den Anschein gewinnen, als ob das Deckengemälde auf einen
Entwurf Flötners zurückginge. Daß Flötner auch Gemälde entworfen hat, lehrt der Entwurf auf dem Epitaphium bei Lange S. 51. Die Maiereien mögen
von einem der Nürnberger Kleinmeister, vielleicht von Georg Pencz, ausgefühlt worden sein. Was Oiiginal ist, hebt sich deutlich von dem anderen ab
und ist von kerniger, derber Zeichnung.«
3 Es ist anzunehmen, daß diese Spalten — ob sie auch ursprünglich vorhanden waren, vermag ich nicht zu entscheiden — bei einer Neu-
anbringung des Deckengemäldes wenig sorgfältig aneinandergefügt wurden. Reihen von kleinen Lüchern, die das Bild durchzielten, beweisen, daß
dieses einmal an die Decke genagelt war. — Wann die letzte Restaurierung des Saaies stattgefunden hat, vermochte ich nicht mit Sicherheit zu
ermitteln.
46