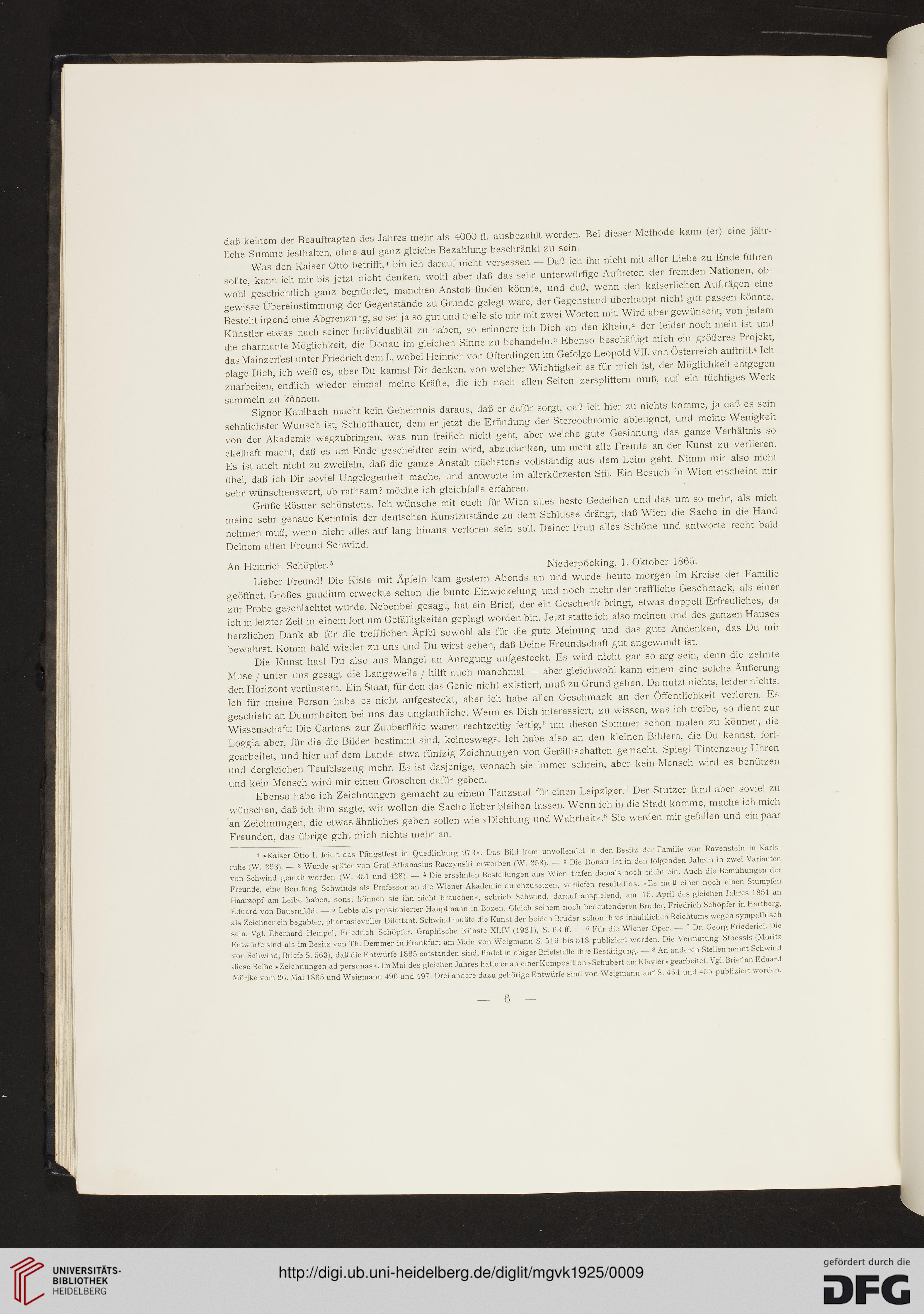daß keinem der Beauftragten des Jahres mehr als 4000 fl. ausbezahlt werden. Bei dieser Methode kann (er) eine jähr-
liche Summe festhalten, ohne auf ganz gleiche Bezahlung beschränkt zu sein.
Was den Kaiser Otto betrifft,1 bin ich darauf nicht versessen — Daß ich ihn nicht mit aller Liebe zu Ende führen
sollte, kann ich mir bis jetzt nicht denken, wohl aber daß das sehr unterwürfige Auftreten der fremden Nationen, ob-
wohl geschichtlich ganz begründet, manchen Anstoß finden könnte, und daß, wenn den kaiserlichen Aufträgen eine
gewisse Übereinstimmung der Gegenstände zu Grunde gelegt wäre, der Gegenstand überhaupt nicht gut passen könnte.
Besteht irgend eine Abgrenzung, so sei ja so gut und theile sie mir mit zwei Worten mit. Wird aber gewünscht, von jedem
Künstler etwas nach seiner Individualität zu haben, so erinnere ich Dich an den Rhein,- der leider noch mein ist und
die charmante Möglichkeit, die Donau im gleichen Sinne zu behandeln.3 Ebenso beschäftigt mich ein größeres Projekt,
das Mainzerfest unter Friedrich dem I., wobei Heinrich von Ofterdingen im Gefolge Leopold VII. von Österreich auftritt.* Ich
plage Dich, ich weiß es, aber Du kannst Dir denken, von welcher Wichtigkeit es für mich ist, der Möglichkeit entgegen
zuarbeiten, endlich wieder einmal meine Kräfte, die ich nach allen Seiten zersplittern muß, auf ein tüchtiges Werk
sammeln zu können.
Signor Kaulbach macht kein Geheimnis daraus, daß er dafür sorgt, daß ich hier zu nichts komme, ja daß es sein
sehnlichster Wunsch ist, Schlotthauer, dem er jetzt die Erfindung der Stereochromie ableugnet, und meine Wenigkeit
von der Akademie wegzubringen, was nun freilich nicht geht, aber welche gute Gesinnung das ganze Verhältnis so
ekelhaft macht, daß es am Ende gescheidter sein wird, abzudanken, um nicht alle Freude an der Kunst zu verlieren.
Es ist auch nicht zu zweifeln, daß die ganze Anstalt nächstens vollständig aus dem Leim geht. Nimm mir also nicht
übel, daß ich Dir soviel Ungelegenheit mache, und antworte im allerkürzesten Stil. Ein Besuch in Wien erscheint mir
sehr wünschenswert, ob rathsam? möchte ich gleichfalls erfahren.
Grüße Rösner schönstens. Ich wünsche mit euch für Wien alles beste Gedeihen und das um so mehr, als mich
meine sehr genaue Kenntnis der deutschen Kunstzustände zu dem Schlüsse drängt, daß Wien die Sache in die Hand
nehmen muß, wenn nicht alles auf lang hinaus verloren sein soll. Deiner Frau alles Schöne und antworte recht bald
Deinem alten Freund Schwind.
An Heinrich Schöpfer.5 Niederpöcking, 1. Oktober 1865.
Lieber Freund! Die Kiste mit Äpfeln kam gestern Abends an und wurde heute morgen im Kreise der Familie
geöffnet. Großes gaudium erweckte schon die bunte Einwickelung und noch mehr der treffliche Geschmack, als einer
zur Probe geschlachtet wurde. Nebenbei gesagt, hat ein Brief, der ein Geschenk bringt, etwas doppelt Erfreuliches, da
ich in letzter Zeit in einem fort um Gefälligkeiten geplagt worden bin. Jetzt statte ich also meinen und des ganzen Hauses
herzlichen Dank ab für die trefflichen Äpfel sowohl als für die gute Meinung und das gute Andenken, das Du mir
bewahrst. Komm bald wieder zu uns und Du wirst sehen, daß Deine Freundschaft gut angewandt ist.
Die Kunst hast Du also aus Mangel an Anregung aufgesteckt. Es wird nicht gar so arg sein, denn die zehnte
Muse / unter uns gesagt die Langeweile / hilft auch manchmal — aber gleichwohl kann einem eine solche Äußerung
den Horizont verfinstern. Ein Staat, für den das Genie nicht existiert, muß zu Grund gehen. Da nutzt nichts, leider nichts.
Ich für meine Person habe es nicht aufgesteckt, aber ich habe allen Geschmack an der Öffentlichkeit verloren. Es
geschieht an Dummheiten bei uns das unglaubliche. Wenn es Dich interessiert, zu wissen, was ich treibe, so dient zur
Wissenschaft: Die Cartons zur Zauberflöte waren rechtzeitig fertig,'1 um diesen Sommer schon malen zu können, die
Loggia aber, für die die Bilder bestimmt sind, keineswegs. Ich habe also an den kleinen Bildern, die Du kennst, fort-
gearbeitet, und hier auf dem Lande etwa fünfzig Zeichnungen von Geräthschaften gemacht. Spiegl Tintenzeug Uhren
und dergleichen Teufelszeug mehr. Es ist dasjenige, wonach sie immer Schrein, aber kein Mensch wird es benützen
und kein Mensch wird mir einen Groschen dafür geben.
Ebenso habe ich Zeichnungen gemacht zu einem Tanzsaal für einen Leipziger.7 Der Stutzer fand aber soviel zu
wünschen, daß ich ihm sagte, wir wollen die Sache lieber bleiben lassen. Wenn ich in die Stadt komme, mache ich mich
an Zeichnungen, die etwas ähnliches geben sollen wie »Dichtung und Wahrheit«.8 Sie werden mir gefallen und ein paar
Freunden, das übrige geht mich nichts mehr an.
1 »Kaiser Otto 1. feiert das Pfingstfest in Quedlinburg 973«. Das Bild kam unvollendet in den Besitz der Familie von Ravenstein in Karls-
ruhe (W. 293). ■— ~ Wurde später von Graf Athanasius Raczynski erworben (W. 258). — "' Die Donau ist in den folgenden Jahren in zwei Varianten
von Schwind gemalt worden (W. 351 und 428). — * Die ersehnten Bestellungen aus Wrien trafen damals noch nicht ein. Auch die Bemühungen der
Freunde, eine Berufung Schwinds als Professor an die Wiener Akademie durchzusetzen, verliefen resultatlos. »Es muß einer noch einen Stumpfen
Haarzopf am Leibe haben, sonst können sie ihn nicht brauchen«, schrieb Schwind, darauf anspielend, am 15. April des gleichen Jahres 1851 an
Eduard von Bauernfeld. — ~° Lebte als pensionierter Hauptmann in Bozen. Gleich seinem noch bedeutenderen Bruder, Friedrich Schöpfer in Hartberg,
als Zeichner ein begabter, phantasievoller Dilettant. Schwind mußte die Kunst der beiden Brüder schon ihres inhaltlichen Reichtums wegen sympathisch
sein. Vgl. Eberhard Hempel, Friedrich Schöpfer. Graphische Künste XLIV (1921), S. G3 S. — « Für die Wiener Oper. — ' Dr. Georg Friedend. Die
Entwürfe sind als im Besitz von Th. Demmer in Frankfurt am Main von Weigmann S. 516 bis 518 publiziert worden. Die Vermutung Stoessls (Moritz
von Schwind, Briefe S. 563), daß die Entwürfe 1865 entstanden sind, findet in obiger Briefstelle ihre Bestätigung. — s An anderen Stellen nennt Schwind
diese Reihe »Zeichnungen ad personas«. Im Mai des gleichen Jahres hatte er an einer Komposition »Schubert am Klavier < gearbeitet. Vgl. Brief an Eduard
Mörike vom 26. Mai 1865 und Weigmann 496 und 497. Drei andere dazu gehörige Entwürfe sind von Weigmann auf S. 454 und 455 publiziert worden.
6 —
liche Summe festhalten, ohne auf ganz gleiche Bezahlung beschränkt zu sein.
Was den Kaiser Otto betrifft,1 bin ich darauf nicht versessen — Daß ich ihn nicht mit aller Liebe zu Ende führen
sollte, kann ich mir bis jetzt nicht denken, wohl aber daß das sehr unterwürfige Auftreten der fremden Nationen, ob-
wohl geschichtlich ganz begründet, manchen Anstoß finden könnte, und daß, wenn den kaiserlichen Aufträgen eine
gewisse Übereinstimmung der Gegenstände zu Grunde gelegt wäre, der Gegenstand überhaupt nicht gut passen könnte.
Besteht irgend eine Abgrenzung, so sei ja so gut und theile sie mir mit zwei Worten mit. Wird aber gewünscht, von jedem
Künstler etwas nach seiner Individualität zu haben, so erinnere ich Dich an den Rhein,- der leider noch mein ist und
die charmante Möglichkeit, die Donau im gleichen Sinne zu behandeln.3 Ebenso beschäftigt mich ein größeres Projekt,
das Mainzerfest unter Friedrich dem I., wobei Heinrich von Ofterdingen im Gefolge Leopold VII. von Österreich auftritt.* Ich
plage Dich, ich weiß es, aber Du kannst Dir denken, von welcher Wichtigkeit es für mich ist, der Möglichkeit entgegen
zuarbeiten, endlich wieder einmal meine Kräfte, die ich nach allen Seiten zersplittern muß, auf ein tüchtiges Werk
sammeln zu können.
Signor Kaulbach macht kein Geheimnis daraus, daß er dafür sorgt, daß ich hier zu nichts komme, ja daß es sein
sehnlichster Wunsch ist, Schlotthauer, dem er jetzt die Erfindung der Stereochromie ableugnet, und meine Wenigkeit
von der Akademie wegzubringen, was nun freilich nicht geht, aber welche gute Gesinnung das ganze Verhältnis so
ekelhaft macht, daß es am Ende gescheidter sein wird, abzudanken, um nicht alle Freude an der Kunst zu verlieren.
Es ist auch nicht zu zweifeln, daß die ganze Anstalt nächstens vollständig aus dem Leim geht. Nimm mir also nicht
übel, daß ich Dir soviel Ungelegenheit mache, und antworte im allerkürzesten Stil. Ein Besuch in Wien erscheint mir
sehr wünschenswert, ob rathsam? möchte ich gleichfalls erfahren.
Grüße Rösner schönstens. Ich wünsche mit euch für Wien alles beste Gedeihen und das um so mehr, als mich
meine sehr genaue Kenntnis der deutschen Kunstzustände zu dem Schlüsse drängt, daß Wien die Sache in die Hand
nehmen muß, wenn nicht alles auf lang hinaus verloren sein soll. Deiner Frau alles Schöne und antworte recht bald
Deinem alten Freund Schwind.
An Heinrich Schöpfer.5 Niederpöcking, 1. Oktober 1865.
Lieber Freund! Die Kiste mit Äpfeln kam gestern Abends an und wurde heute morgen im Kreise der Familie
geöffnet. Großes gaudium erweckte schon die bunte Einwickelung und noch mehr der treffliche Geschmack, als einer
zur Probe geschlachtet wurde. Nebenbei gesagt, hat ein Brief, der ein Geschenk bringt, etwas doppelt Erfreuliches, da
ich in letzter Zeit in einem fort um Gefälligkeiten geplagt worden bin. Jetzt statte ich also meinen und des ganzen Hauses
herzlichen Dank ab für die trefflichen Äpfel sowohl als für die gute Meinung und das gute Andenken, das Du mir
bewahrst. Komm bald wieder zu uns und Du wirst sehen, daß Deine Freundschaft gut angewandt ist.
Die Kunst hast Du also aus Mangel an Anregung aufgesteckt. Es wird nicht gar so arg sein, denn die zehnte
Muse / unter uns gesagt die Langeweile / hilft auch manchmal — aber gleichwohl kann einem eine solche Äußerung
den Horizont verfinstern. Ein Staat, für den das Genie nicht existiert, muß zu Grund gehen. Da nutzt nichts, leider nichts.
Ich für meine Person habe es nicht aufgesteckt, aber ich habe allen Geschmack an der Öffentlichkeit verloren. Es
geschieht an Dummheiten bei uns das unglaubliche. Wenn es Dich interessiert, zu wissen, was ich treibe, so dient zur
Wissenschaft: Die Cartons zur Zauberflöte waren rechtzeitig fertig,'1 um diesen Sommer schon malen zu können, die
Loggia aber, für die die Bilder bestimmt sind, keineswegs. Ich habe also an den kleinen Bildern, die Du kennst, fort-
gearbeitet, und hier auf dem Lande etwa fünfzig Zeichnungen von Geräthschaften gemacht. Spiegl Tintenzeug Uhren
und dergleichen Teufelszeug mehr. Es ist dasjenige, wonach sie immer Schrein, aber kein Mensch wird es benützen
und kein Mensch wird mir einen Groschen dafür geben.
Ebenso habe ich Zeichnungen gemacht zu einem Tanzsaal für einen Leipziger.7 Der Stutzer fand aber soviel zu
wünschen, daß ich ihm sagte, wir wollen die Sache lieber bleiben lassen. Wenn ich in die Stadt komme, mache ich mich
an Zeichnungen, die etwas ähnliches geben sollen wie »Dichtung und Wahrheit«.8 Sie werden mir gefallen und ein paar
Freunden, das übrige geht mich nichts mehr an.
1 »Kaiser Otto 1. feiert das Pfingstfest in Quedlinburg 973«. Das Bild kam unvollendet in den Besitz der Familie von Ravenstein in Karls-
ruhe (W. 293). ■— ~ Wurde später von Graf Athanasius Raczynski erworben (W. 258). — "' Die Donau ist in den folgenden Jahren in zwei Varianten
von Schwind gemalt worden (W. 351 und 428). — * Die ersehnten Bestellungen aus Wrien trafen damals noch nicht ein. Auch die Bemühungen der
Freunde, eine Berufung Schwinds als Professor an die Wiener Akademie durchzusetzen, verliefen resultatlos. »Es muß einer noch einen Stumpfen
Haarzopf am Leibe haben, sonst können sie ihn nicht brauchen«, schrieb Schwind, darauf anspielend, am 15. April des gleichen Jahres 1851 an
Eduard von Bauernfeld. — ~° Lebte als pensionierter Hauptmann in Bozen. Gleich seinem noch bedeutenderen Bruder, Friedrich Schöpfer in Hartberg,
als Zeichner ein begabter, phantasievoller Dilettant. Schwind mußte die Kunst der beiden Brüder schon ihres inhaltlichen Reichtums wegen sympathisch
sein. Vgl. Eberhard Hempel, Friedrich Schöpfer. Graphische Künste XLIV (1921), S. G3 S. — « Für die Wiener Oper. — ' Dr. Georg Friedend. Die
Entwürfe sind als im Besitz von Th. Demmer in Frankfurt am Main von Weigmann S. 516 bis 518 publiziert worden. Die Vermutung Stoessls (Moritz
von Schwind, Briefe S. 563), daß die Entwürfe 1865 entstanden sind, findet in obiger Briefstelle ihre Bestätigung. — s An anderen Stellen nennt Schwind
diese Reihe »Zeichnungen ad personas«. Im Mai des gleichen Jahres hatte er an einer Komposition »Schubert am Klavier < gearbeitet. Vgl. Brief an Eduard
Mörike vom 26. Mai 1865 und Weigmann 496 und 497. Drei andere dazu gehörige Entwürfe sind von Weigmann auf S. 454 und 455 publiziert worden.
6 —