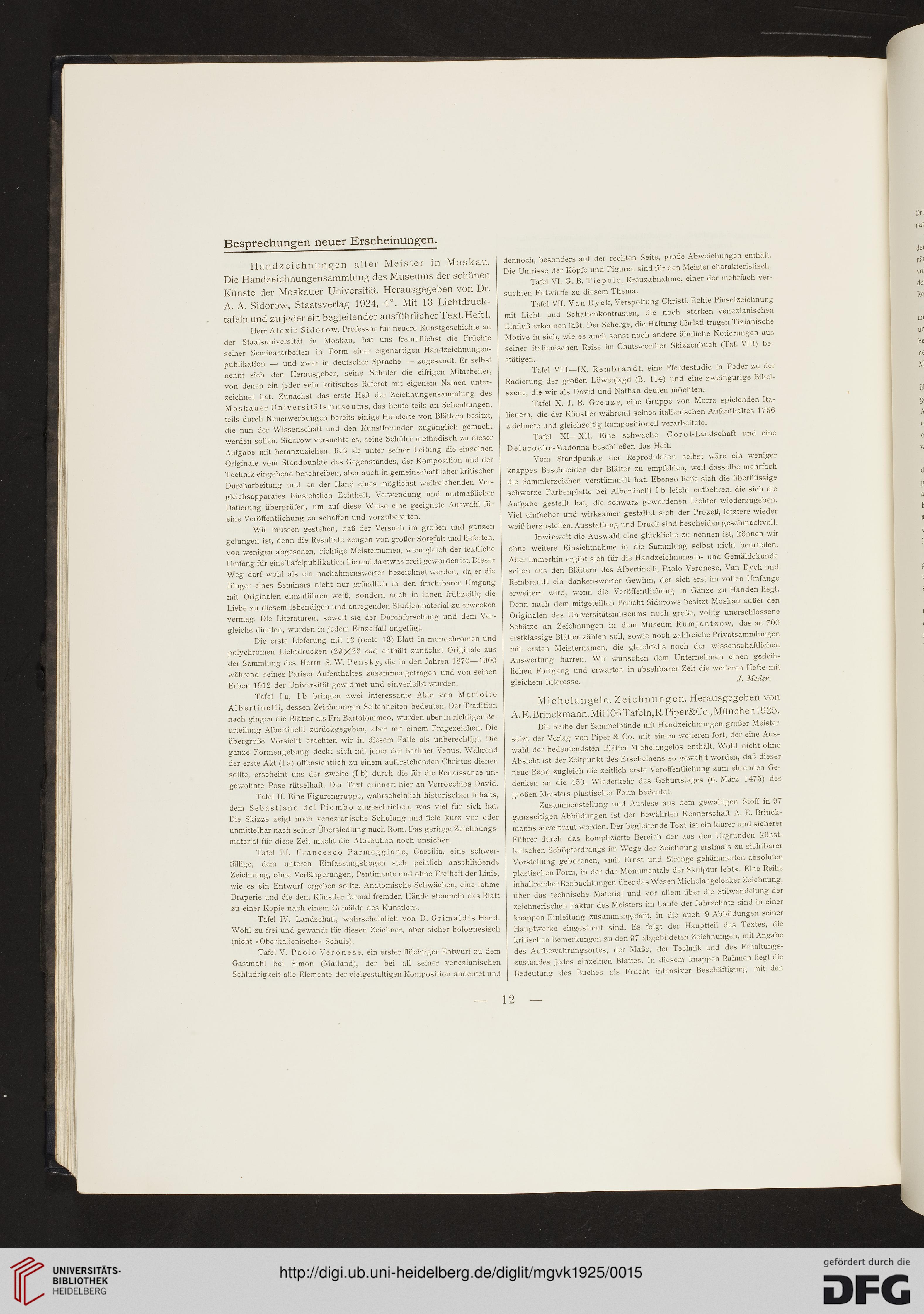Besprechungen neuer Erscheinungen.
Handzeichnungen alter Meister in Moskau.
Die Handzeichnungensammlung des Museums der schönen
Künste der Moskauer Universität. Herausgegeben von Dr.
A.A. Sidorow, Staatsverlag 1924, 4°. Mit 13 Lichtdruck-
tafeln und zu jeder ein begleitender ausführlicher Text. Heft I.
Herr Alexis Sidorow, Professor für neuere Kunstgeschichte an
der Staatsuniversität in Moskau, hat uns freundlichst die Früchte
seiner Seminararbeiten in Form einer eigenartigen Handzeichnungen-
publikation —■ und zwar in deutscher Sprache — zugesandt. Er selbst
nennt sich den Herausgeber, seine Schüler die eifrigen Mitarbeiter,
von denen ein jeder sein kritisches Referat mit eigenem Namen unter-
zeichnet hat. Zunächst das erste Heft der Zeichnungensammlung des
Moskauer Universitätsmuseums, das heute teils an Schenkungen,
teils durch Neuerwerbungen bereits einige Hunderte von Blättern besitzt,
die nun der Wissenschaft und den Kunstfreunden zugänglich gemacht
werden sollen. Sidorow versuchte es, seine Schüler methodisch zu dieser
Aufgabe mit heranzuziehen, ließ sie unter seiner Leitung die einzelnen
Originale vom Standpunkte des Gegenstandes, der Komposition und der
Technik eingehend beschreiben, aber auch in gemeinschaftlicher kritischer
Durcharbeitung und an der Hand eines möglichst weitreichenden Ver-
gleichsapparates hinsichtlich Echtheit, Verwendung und mutmaßlicher
Datierung überprüfen, um auf diese Weise eine geeignete Auswahl für
eine Veröffentlichung zu schaffen und vorzubereiten.
Wir müssen gestehen, daß der Versuch im großen und ganzen
gelungen ist, denn die Resultate zeugen von großer Sorgfalt und lieferten,
von wenigen abgesehen, richtige Meisternamen, wenngleich der textliche
Umfang für eine Tafelpublikation hie und da etwas breit geworden ist. Dieser
Weg darf wohl als ein nachahmenswerter bezeichnet werden, da er die
Jünger eines Seminars nicht nur gründlich in den fruchtbaren Umgang
mit Originalen einzuführen weiß, sondern auch in ihnen frühzeitig die
Liebe zu diesem lebendigen und anregenden Studienmaterial zu erwecken
vermag. Die Literaturen, soweit sie der Durchforschung und dem Ver-
gleiche dienten, wurden in jedem Einzelfall angefügt.
Die erste Lieferung mit 12 (recte 13) Blatt in monochromen und
polychromen Lichtdrucken (29X23 cm) enthält zunächst Originale aus
der Sammlung des Herrn S. W. Pensky, die in den Jahren 1870—1900
während seines Pariser Aufenthaltes zusammengetragen und von seinen
Erben 1912 der Universität gewidmet und einverleibt wurden.
Tafel I a, Ib bringen zwei interessante Akte von Mariotto
Albertinelli, dessen Zeichnungen Seltenheiten bedeuten. Der Tradition
nach gingen die Blätter als Fra Bartolommeo, wurden aber in richtiger Be-
urteilung Albertinelli zurückgegeben, aber mit einem Fragezeichen. Die
übergroße Vorsicht erachten wir in diesem Falle als unberechtigt. Die
ganze Formengebung deckt sich mit jener der Berliner Venus. Während
der erste Akt (I a) offensichtlich zu einem auferstehenden Christus dienen
sollte, erscheint uns der zweite (I b) durch die für die Renaissance un-
gewohnte Pose rätselhaft. Der Text erinnert hier an Verrocchios David.
Tafel II. Eine Figurengruppe, wahrscheinlich historischen Inhalts,
dem Sebastiano delPiombo zugeschrieben, was viel für sich hat.
Die Skizze zeigt noch venezianische Schulung und fiele kurz vor oder
unmittelbar nach seiner Übersiedlung nach Rom. Das geringe Zeichnungs-
material für diese Zeit macht die Attribution noch unsicher.
Tafel III. Francesco Parmeggiano, Caecilia, eine schwer-
fällige, dem unteren Einfassungsbogen sich peinlich anschließende
Zeichnung, ohne Verlängerungen, Pentimente und ohne Freiheit der Linie,
wie es ein Entwurf ergeben sollte. Anatomische Schwächen, eine lahme
Draperie und die dem Künstler formal fremden Hände stempeln das Blatt
zu einer Kopie nach einem Gemälde des Künstlers.
Tafel IV. Landschaft, wahrscheinlich von D. Grimaldis Hand.
Wohl zu frei und gewandt für diesen Zeichner, aber sicher bolognesisch
(nicht »Oberitalienische« Schule).
Tafel V. Paolo Veronese, ein erster flüchtiger Entwurf zu dem
Gastmahl bei Simon (Mailand), der bei all seiner venezianischen
Schludrigkeit alle Elemente der vielgestaltigen Komposition andeutet und
dennoch, besonders auf der rechten Seite, große Abweichungen enthält.
Die Umrisse der Köpfe und Figuren sind für den Meister charakteristisch.
Tafel VI. G. B. Tiepolo, Kreuzabnahme, einer der mehrfach ver-
suchten Entwürfe zu diesem Thema.
Tafel VII. Van Dyck, Verspottung Christi. Echte Pinselzeichnung
mit Licht und Schattenkontrasten, die noch starken venezianischen
Einfluß erkennen läßt. Der Scherge, die Haltung Christi tragen Tizianische
Motive in sich, wie es auch sonst noch andere ähnliche Notierungen aus
seiner italienischen Reise im Chatsworther Skizzenbuch (Taf. VIII) be-
stätigen.
Tafel VIII—IX. Rembrandt, eine Pferdestudie in Feder zu der
Radierung der großen Löwenjagd (B. 114) und eine zweifigurige Bibel-
szene, die wir als David und Nathan deuten möchten.
Tafel X. J. B. Greuze, eine Gruppe von Morra spielenden Ita-
lienern, die der Künstler während seines italienischen Aufenthaltes 1756
zeichnete und gleichzeitig kompositionell verarbeitete.
Tafel XI—XII. Eine schwache Corot-Landschaft und eine
Delaroche-Madonna beschließen das Heft.
Vom Standpunkte der Reproduktion selbst wäre ein weniger
knappes Beschneiden der Blätter zu empfehlen, weil dasselbe mehrfach
die Sammlerzeichen verstümmelt hat. Ebenso ließe sich die überflüssige
schwarze Farbcnplatte bei Albertinelli I b leicht entbehren, die sich die
Aufgabe gestellt hat, die schwarz gewordenen Lichter wiederzugeben.
Viel einfacher und wirksamer gestaltet sich der Prozeß, letztere wieder
weiß herzustellen. Ausstattung und Druck sind bescheiden geschmackvoll.
Inwieweit die Auswahl eine glückliche zu nennen ist, können wir
ohne weitere Einsichtnahme in die Sammlung selbst nicht beurteilen.
Aber immerhin ergibt sich für die Handzeichnungen- und Gemäldekunde
schon aus den Blättern des Albertinelli, Paolo Veronese, Van Dyck und
Rembrandt ein dankenswerter Gewinn, der sich erst im vollen Umfange
erweitern wird, wenn die Veröffentlichung in Gänze zu Händen liegt.
Denn nach dem mitgeteilten Bericht Sidorows besitzt Moskau außer den
Originalen des Universitätsmuseums noch große, völlig unerschlossene
Schätze an Zeichnungen in dem Museum Rumjantzow, das an 700
erstklassige Blätter zählen soll, sowie noch zahlreiche Privatsammlungen
mit ersten Meisternamen, die gleichfalls noch der wissenschaftlichen
Auswertung harren. Wir wünschen dem Unternehmen einen gedeih-
lichen Fortgang und erwarten in absehbarer Zeit die weiteren Hefte mit
gleichem Interesse. /. Meder.
Michelangelo. Zeichnungen. Herausgegeben von
A.E.Brinckmann.Mitl06Tafeln,R.Piper&Co.,Münchenl925.
Die Reihe der Sammelbände mit Handzeichnungen großer Meister
setzt der Verlag von Piper & Co. mit einem weiteren fort, der eine Aus-
wahl der bedeutendsten Blätter Michelangelos enthält. Wohl nicht ohne
Absicht ist der Zeitpunkt des Erscheinens so gewählt worden, daß dieser
neue Band zugleich die zeitlich erste Veröffentlichung zum ehrenden Ge-
denken an die 450. Wiederkehr des Geburtstages (6. März 1475) des
großen Meisters plastischer Form bedeutet.
Zusammenstellung und Auslese aus dem gewaltigen Stoff in 97
ganzseitigen Abbildungen ist der bewährten Kennerschaft A. E. Brinck-
manns anvertraut worden. Der begleitende Text ist ein klarer und sicherer
Führer durch das komplizierte Bereich der aus den Urgründen künst-
lerischen Schöpferdrangs im Wege der Zeichnung erstmals zu sichtbarer
Vorstellung geborenen, »mit Ernst und Strenge gehämmerten absoluten
plastischen Form, in der das Monumentale der Skulptur lebt«. Eine Reihe
inhaltreicher Beobachtungen über das Wesen Michelangelesker Zeichnung.
über das technische Material und vor allem über die Stilwandelung der
zeichnerischen Faktur des Meisters im Laufe der Jahrzehnte sind in einer
knappen Einleitung zusammengefaßt, in die auch 9 Abbildungen seiner
Hauptwerke eingestreut sind. Es folgt der Hauptteil des Textes, die
kritischen Bemerkungen zu den 97 abgebildeten Zeichnungen, mit Angabe
des Aufbewahrungsortes, der Maße, der Technik und des Erhaltungs-
zustandes jedes einzelnen Blattes. In diesem knappen Rahmen liegt die
Bedeutung des Buches als Frucht intensiver Beschäftigung mit den
0n
nat
dei
näi
vo
de:
Re
un
ur
be
iie
M
— 12
Handzeichnungen alter Meister in Moskau.
Die Handzeichnungensammlung des Museums der schönen
Künste der Moskauer Universität. Herausgegeben von Dr.
A.A. Sidorow, Staatsverlag 1924, 4°. Mit 13 Lichtdruck-
tafeln und zu jeder ein begleitender ausführlicher Text. Heft I.
Herr Alexis Sidorow, Professor für neuere Kunstgeschichte an
der Staatsuniversität in Moskau, hat uns freundlichst die Früchte
seiner Seminararbeiten in Form einer eigenartigen Handzeichnungen-
publikation —■ und zwar in deutscher Sprache — zugesandt. Er selbst
nennt sich den Herausgeber, seine Schüler die eifrigen Mitarbeiter,
von denen ein jeder sein kritisches Referat mit eigenem Namen unter-
zeichnet hat. Zunächst das erste Heft der Zeichnungensammlung des
Moskauer Universitätsmuseums, das heute teils an Schenkungen,
teils durch Neuerwerbungen bereits einige Hunderte von Blättern besitzt,
die nun der Wissenschaft und den Kunstfreunden zugänglich gemacht
werden sollen. Sidorow versuchte es, seine Schüler methodisch zu dieser
Aufgabe mit heranzuziehen, ließ sie unter seiner Leitung die einzelnen
Originale vom Standpunkte des Gegenstandes, der Komposition und der
Technik eingehend beschreiben, aber auch in gemeinschaftlicher kritischer
Durcharbeitung und an der Hand eines möglichst weitreichenden Ver-
gleichsapparates hinsichtlich Echtheit, Verwendung und mutmaßlicher
Datierung überprüfen, um auf diese Weise eine geeignete Auswahl für
eine Veröffentlichung zu schaffen und vorzubereiten.
Wir müssen gestehen, daß der Versuch im großen und ganzen
gelungen ist, denn die Resultate zeugen von großer Sorgfalt und lieferten,
von wenigen abgesehen, richtige Meisternamen, wenngleich der textliche
Umfang für eine Tafelpublikation hie und da etwas breit geworden ist. Dieser
Weg darf wohl als ein nachahmenswerter bezeichnet werden, da er die
Jünger eines Seminars nicht nur gründlich in den fruchtbaren Umgang
mit Originalen einzuführen weiß, sondern auch in ihnen frühzeitig die
Liebe zu diesem lebendigen und anregenden Studienmaterial zu erwecken
vermag. Die Literaturen, soweit sie der Durchforschung und dem Ver-
gleiche dienten, wurden in jedem Einzelfall angefügt.
Die erste Lieferung mit 12 (recte 13) Blatt in monochromen und
polychromen Lichtdrucken (29X23 cm) enthält zunächst Originale aus
der Sammlung des Herrn S. W. Pensky, die in den Jahren 1870—1900
während seines Pariser Aufenthaltes zusammengetragen und von seinen
Erben 1912 der Universität gewidmet und einverleibt wurden.
Tafel I a, Ib bringen zwei interessante Akte von Mariotto
Albertinelli, dessen Zeichnungen Seltenheiten bedeuten. Der Tradition
nach gingen die Blätter als Fra Bartolommeo, wurden aber in richtiger Be-
urteilung Albertinelli zurückgegeben, aber mit einem Fragezeichen. Die
übergroße Vorsicht erachten wir in diesem Falle als unberechtigt. Die
ganze Formengebung deckt sich mit jener der Berliner Venus. Während
der erste Akt (I a) offensichtlich zu einem auferstehenden Christus dienen
sollte, erscheint uns der zweite (I b) durch die für die Renaissance un-
gewohnte Pose rätselhaft. Der Text erinnert hier an Verrocchios David.
Tafel II. Eine Figurengruppe, wahrscheinlich historischen Inhalts,
dem Sebastiano delPiombo zugeschrieben, was viel für sich hat.
Die Skizze zeigt noch venezianische Schulung und fiele kurz vor oder
unmittelbar nach seiner Übersiedlung nach Rom. Das geringe Zeichnungs-
material für diese Zeit macht die Attribution noch unsicher.
Tafel III. Francesco Parmeggiano, Caecilia, eine schwer-
fällige, dem unteren Einfassungsbogen sich peinlich anschließende
Zeichnung, ohne Verlängerungen, Pentimente und ohne Freiheit der Linie,
wie es ein Entwurf ergeben sollte. Anatomische Schwächen, eine lahme
Draperie und die dem Künstler formal fremden Hände stempeln das Blatt
zu einer Kopie nach einem Gemälde des Künstlers.
Tafel IV. Landschaft, wahrscheinlich von D. Grimaldis Hand.
Wohl zu frei und gewandt für diesen Zeichner, aber sicher bolognesisch
(nicht »Oberitalienische« Schule).
Tafel V. Paolo Veronese, ein erster flüchtiger Entwurf zu dem
Gastmahl bei Simon (Mailand), der bei all seiner venezianischen
Schludrigkeit alle Elemente der vielgestaltigen Komposition andeutet und
dennoch, besonders auf der rechten Seite, große Abweichungen enthält.
Die Umrisse der Köpfe und Figuren sind für den Meister charakteristisch.
Tafel VI. G. B. Tiepolo, Kreuzabnahme, einer der mehrfach ver-
suchten Entwürfe zu diesem Thema.
Tafel VII. Van Dyck, Verspottung Christi. Echte Pinselzeichnung
mit Licht und Schattenkontrasten, die noch starken venezianischen
Einfluß erkennen läßt. Der Scherge, die Haltung Christi tragen Tizianische
Motive in sich, wie es auch sonst noch andere ähnliche Notierungen aus
seiner italienischen Reise im Chatsworther Skizzenbuch (Taf. VIII) be-
stätigen.
Tafel VIII—IX. Rembrandt, eine Pferdestudie in Feder zu der
Radierung der großen Löwenjagd (B. 114) und eine zweifigurige Bibel-
szene, die wir als David und Nathan deuten möchten.
Tafel X. J. B. Greuze, eine Gruppe von Morra spielenden Ita-
lienern, die der Künstler während seines italienischen Aufenthaltes 1756
zeichnete und gleichzeitig kompositionell verarbeitete.
Tafel XI—XII. Eine schwache Corot-Landschaft und eine
Delaroche-Madonna beschließen das Heft.
Vom Standpunkte der Reproduktion selbst wäre ein weniger
knappes Beschneiden der Blätter zu empfehlen, weil dasselbe mehrfach
die Sammlerzeichen verstümmelt hat. Ebenso ließe sich die überflüssige
schwarze Farbcnplatte bei Albertinelli I b leicht entbehren, die sich die
Aufgabe gestellt hat, die schwarz gewordenen Lichter wiederzugeben.
Viel einfacher und wirksamer gestaltet sich der Prozeß, letztere wieder
weiß herzustellen. Ausstattung und Druck sind bescheiden geschmackvoll.
Inwieweit die Auswahl eine glückliche zu nennen ist, können wir
ohne weitere Einsichtnahme in die Sammlung selbst nicht beurteilen.
Aber immerhin ergibt sich für die Handzeichnungen- und Gemäldekunde
schon aus den Blättern des Albertinelli, Paolo Veronese, Van Dyck und
Rembrandt ein dankenswerter Gewinn, der sich erst im vollen Umfange
erweitern wird, wenn die Veröffentlichung in Gänze zu Händen liegt.
Denn nach dem mitgeteilten Bericht Sidorows besitzt Moskau außer den
Originalen des Universitätsmuseums noch große, völlig unerschlossene
Schätze an Zeichnungen in dem Museum Rumjantzow, das an 700
erstklassige Blätter zählen soll, sowie noch zahlreiche Privatsammlungen
mit ersten Meisternamen, die gleichfalls noch der wissenschaftlichen
Auswertung harren. Wir wünschen dem Unternehmen einen gedeih-
lichen Fortgang und erwarten in absehbarer Zeit die weiteren Hefte mit
gleichem Interesse. /. Meder.
Michelangelo. Zeichnungen. Herausgegeben von
A.E.Brinckmann.Mitl06Tafeln,R.Piper&Co.,Münchenl925.
Die Reihe der Sammelbände mit Handzeichnungen großer Meister
setzt der Verlag von Piper & Co. mit einem weiteren fort, der eine Aus-
wahl der bedeutendsten Blätter Michelangelos enthält. Wohl nicht ohne
Absicht ist der Zeitpunkt des Erscheinens so gewählt worden, daß dieser
neue Band zugleich die zeitlich erste Veröffentlichung zum ehrenden Ge-
denken an die 450. Wiederkehr des Geburtstages (6. März 1475) des
großen Meisters plastischer Form bedeutet.
Zusammenstellung und Auslese aus dem gewaltigen Stoff in 97
ganzseitigen Abbildungen ist der bewährten Kennerschaft A. E. Brinck-
manns anvertraut worden. Der begleitende Text ist ein klarer und sicherer
Führer durch das komplizierte Bereich der aus den Urgründen künst-
lerischen Schöpferdrangs im Wege der Zeichnung erstmals zu sichtbarer
Vorstellung geborenen, »mit Ernst und Strenge gehämmerten absoluten
plastischen Form, in der das Monumentale der Skulptur lebt«. Eine Reihe
inhaltreicher Beobachtungen über das Wesen Michelangelesker Zeichnung.
über das technische Material und vor allem über die Stilwandelung der
zeichnerischen Faktur des Meisters im Laufe der Jahrzehnte sind in einer
knappen Einleitung zusammengefaßt, in die auch 9 Abbildungen seiner
Hauptwerke eingestreut sind. Es folgt der Hauptteil des Textes, die
kritischen Bemerkungen zu den 97 abgebildeten Zeichnungen, mit Angabe
des Aufbewahrungsortes, der Maße, der Technik und des Erhaltungs-
zustandes jedes einzelnen Blattes. In diesem knappen Rahmen liegt die
Bedeutung des Buches als Frucht intensiver Beschäftigung mit den
0n
nat
dei
näi
vo
de:
Re
un
ur
be
iie
M
— 12