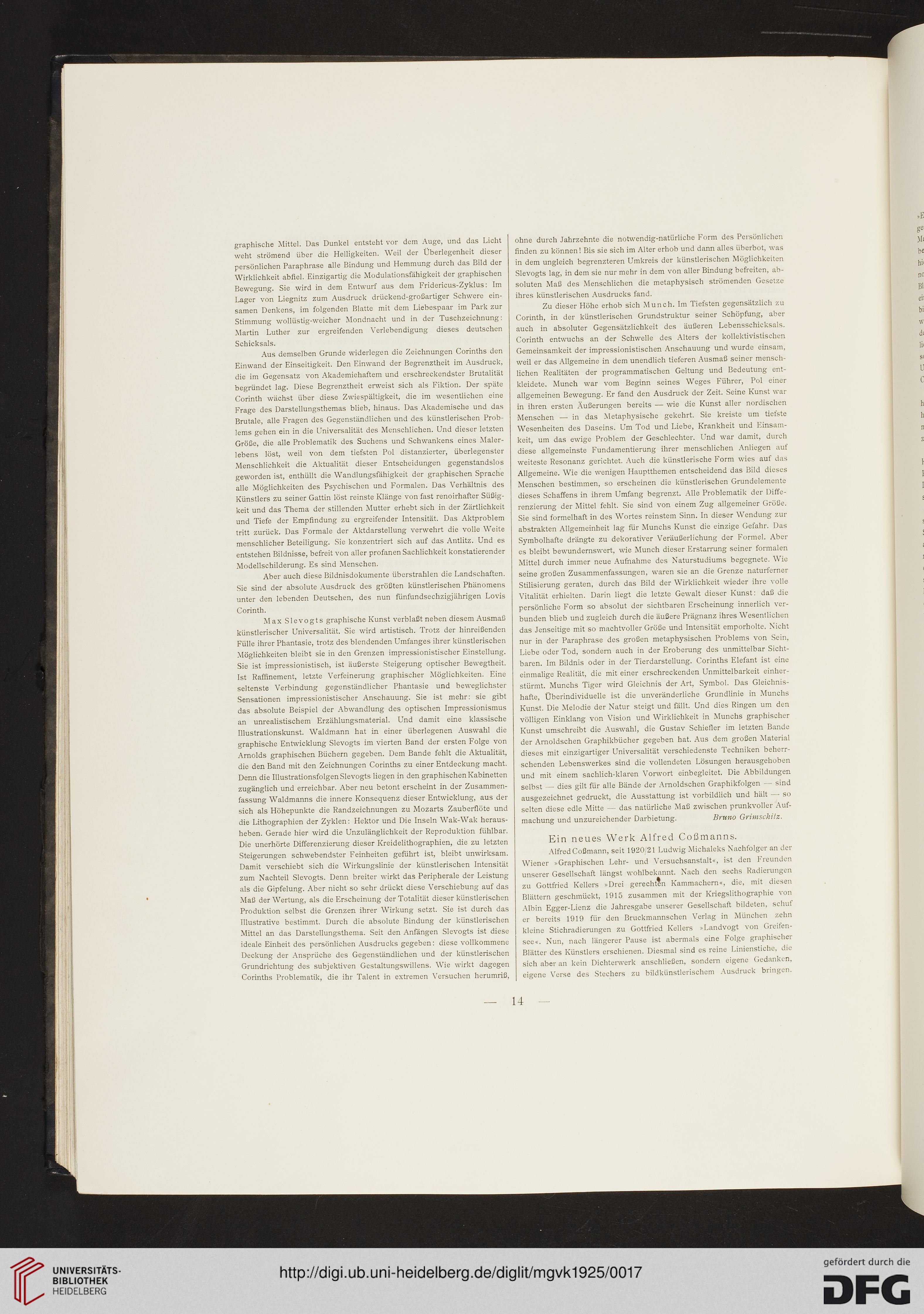graphische Mittel. Das Dunkel entsteht vor dem Auge, und das Licht
weht strömend über die Helligkeiten. Weil der Überlegenheit dieser
persönlichen Paraphrase alle Bindung und Hemmung durch das Bild der
Wirklichkeit abfiel. Einzigartig die Modulationsfähigkeit der graphischen
Bewegung. Sie wird in dem Entwurf aus dem Fridericus-Zyklus: Im
Lager von Liegnitz zum Ausdruck drückend-großartiger Schwere ein-
samen Denkens, im folgenden Blatte mit dem Liebespaar im Park zur
Stimmung wollüstig-weicher Mondnacht und in der Tuschzeichnung:
Martin Luther zur ergreifenden Verlebendigung dieses deutschen
Schicksals.
Aus demselben Grunde widerlegen die Zeichnungen Corinths den
Einwand der Einseitigkeit. Den Einwand der Begrenztheit im Ausdruck,
die im Gegensatz von Akademiehaftem und erschreckendster Brutalität
begründet lag. Diese Begrenztheit erweist sich als Fiktion. Der späte
Corinth wächst über diese Zwiespältigkeit, die im wesentlichen eine
Frage des Darstellungsthemas blieb, hinaus. Das Akademische und das
Brutale, alle Fragen des Gegenständlichen und des künstlerischen Prob-
lems gehen ein in die Universalität des Menschlichen. Und dieser letzten
Größe, die alle Problematik des Suchens und Schwankens eines Maler-
lebens löst, weil von dem tiefsten Pol distanzierter, überlegenster
Menschlichkeit die Aktualität dieser Entscheidungen gegenstandslos
geworden ist, enthüllt die Wandlungsfähigkeit der graphischen Sprache
alle Möglichkeiten des Psychischen und Formalen. Das Verhältnis des
Künstlers zu seiner Gattin löst reinste Klänge von fast renoirhafter Süßig-
keit und das Thema der stillenden Mutter erhebt sich in der Zärtlichkeit
und Tiefe der Empfindung zu ergreifender Intensität. Das Aktproblem
tritt zurück. Das Formale der Aktdarstellung verwehrt die volle Weite
menschlicher Beteiligung. Sie konzentriert sich auf das Antlitz. Und es
entstehen Bildnisse, befreit von aller profanen Sachlichkeit konstatierender
Modellschilderung. Es sind Menschen.
Aber auch diese Bildnisdokumente überstrahlen die Landschaften.
Sie sind der absolute Ausdruck des größten künstlerischen Phänomens
unter den lebenden Deutschen, des nun fünfundsechzigj ährigen Lovis
Corinth.
Max Slevogts graphische Kunst verblaßt neben diesem Ausmaß
künstlerischer Universalität. Sie wird artistisch. Trotz der hinreißenden
Fülle ihrer Phantasie, trotz des blendenden Umfanges ihrer künstlerischen
Möglichkeiten bleibt sie in den Grenzen impressionistischer Einstellung.
Sie ist impressionistisch, ist äußerste Steigerung optischer Bewegtheit.
Ist Raffinement, letzte Verfeinerung graphischer Möglichkeiten. Eine
seltenste Verbindung gegenständlicher Phantasie und beweglichster
Sensationen impressionistischer Anschauung. Sie ist mehr: sie gibt
das absolute Beispiel der Abwandlung des optischen Impressionismus
an unrealistischem Erzählungsmaterial. Und damit eine klassische
Illustrationskunst. Waldmann hat in einer überlegenen Auswahl die
graphische Entwicklung Slevogts im vierten Band der ersten Folge von
Arnolds graphischen Büchern gegeben. Dem Bande fehlt die Aktualität,
die den Band mit den Zeichnungen Corinths zu einer Entdeckung macht.
Denn die Illustrationsfolgen Slevogts liegen in den graphischen Kabinetten
zugänglich und erreichbar. Aber neu betont erscheint in der Zusammen-
fassung Waldmanns die innere Konsequenz dieser Entwicklung, aus der
sich als Höhepunkte die Randzeichnungen zu Mozarts Zauberflöte und
die Lithographien der Zyklen: Hektar und Die Inseln Wak-Wak heraus-
heben. Gerade hier wird die Unzulänglichkeit der Reproduktion fühlbar.
Die unerhörte Differenzierung dieser Kreidelithographien, die zu letzten
Steigerungen schwebendster Feinheiten geführt ist, bleibt unwirksam.
Damit verschiebt sich die Wirkungslinie der künstlerischen Intensität
zum Nachteil Slevogts. Denn breiter wirkt das Peripherale der Leistung
als die Gipfelung. Aber nicht so sehr drückt diese Verschiebung auf das
Maß der Wertung, als die Erscheinung der Totalität dieser künstlerischen
Produktion selbst die Grenzen ihrer Wirkung setzt. Sie ist durch das
Illustrative bestimmt. Durch die absolute Bindung der künstlerischen
Mittel an das Darstellungsthema. Seit den Anfängen Slevogts ist diese
ideale Einheit des persönlichen Ausdrucks gegeben: diese vollkommene
Deckung der Ansprüche des Gegenständlichen und der künstlerischen
Grundrichtung des subjektiven Gestaltungswillens. Wie wirkt dagegen
Corinths Problematik, die ihr Talent in extremen Versuchen herumriß,
ohne durch Jahrzehnte die notwendig-natürliche Form des Persönlichen
finden zu können! Bis sie sich im Alter erhob und dann alles überbot, was
in dem ungleich begrenzteren Umkreis der künstlerischen Möglichkeiten
Slevogts lag, in dem sie nur mehr in dem von aller Bindung befreiten, ab-
soluten Maß des Menschlichen die metaphysisch strömenden Gesetze
ihres künstlerischen Ausdrucks fand.
Zu dieser Höhe erhob sich Munch. Im Tiefsten gegensätzlich zu
Corinth, in der künstlerischen Grundstruktur seiner Schöpfung, aber
auch in absoluter Gegensätzlichkeit des äußeren Lebensschicksals.
Corinth entwuchs an der Schwelle des Alters der kollektivistischen
Gemeinsamkeit der impressionistischen Anschauung und wurde einsam,
weil er das Allgemeine in dem unendlich tieferen Ausmaß seiner mensch-
lichen Realitäten der programmatischen Geltung und Bedeutung ent-
kleidete. Munch war vom Beginn seines Weges Führer, Pol einer
allgemeinen Bewegung. Er fand den Ausdruck der Zeit. Seine Kunst war
in ihren ersten Äußerungen bereits — wie die Kunst aller nordischen
Menschen — in das Metaphysische gekehrt. Sie kreiste um tiefste
Wesenheiten des Daseins. Um Tod und Liebe, Krankheit und Einsam-
keit, um das ewige Problem der Geschlechter. Und war damit, durch
diese allgemeinste Fundamentierung ihrer menschlichen Anliegen auf
weiteste Resonanz gerichtet. Auch die künstlerische Form wies auf das
Allgemeine. Wie die wenigen Hauptthemen entscheidend das Bild dieses
Menschen bestimmen, so erscheinen die künstlerischen Grundelemente
dieses Schaffens in ihrem Umfang begrenzt. Alle Problematik der Diffe-
renzierung der Mittel fehlt. Sie sind von einem Zug allgemeiner Größe.
Sie sind formelhaft in des Wortes reinstem Sinn. In dieser Wendung zur
abstrakten Allgemeinheit lag für Munchs Kunst die einzige Gefahr. Das
Symbolhafte drängte zu dekorativer Veräußerlichung der Formel. Aber
es bleibt bewundernswert, wie Munch dieser Erstarrung seiner formalen
Mittel durch immer neue Aufnahme des Naturstudiums begegnete. Wie
seine großen Zusammenfassungen, waren sie an die Grenze naturferner
Stilisierung geraten, durch das Bild der Wirklichkeit wieder ihre volle
Vitalität erhielten. Darin liegt die letzte Gewalt dieser Kunst: daß die
persönliche Form so absolut der sichtbaren Erscheinung innerlich ver-
bunden blieb und zugleich durch die äußere Prägnanz ihres Wesentlichen
das Jenseitige mit so machtvoller Größe und Intensität emporholte. Nicht
nur in der Paraphrase des großen metaphysischen Problems von Sein,
Liebe oder Tod, sondern auch in der Eroberung des unmittelbar Sicht-
baren. Im Bildnis oder in der Tierdarstellung. Corinths Elefant ist eine
einmalige Realität, die mit einer erschreckenden Unmittelbarkeit einher-
stürmt. Munchs Tiger wird Gleichnis der Art, Symbol. Das Gleichnis-
hafte, Überindividuelle ist die unveränderliche Grundlinie in Munchs
Kunst. Die Melodie der Natur steigt und fällt. Und dies Ringen um den
völligen Einklang von Vision und Wirklichkeit in Munchs graphischer
Kunst umschreibt die Auswahl, die Gustav Schiefler im letzten Bande
der Arnoldschen Graphikbücher gegeben hat. Aus dem großen Material
dieses mit einzigartiger Universalität verschiedenste Techniken beherr-
schenden Lebenswerkes sind die vollendeten Lösungen herausgehoben
und mit einem sachlich-klaren Vorwort einbegleitet. Die Abbildungen
selbst — dies gilt für alle Bände der Arnoldschen Graphikfolgen — sind
ausgezeichnet gedruckt, die Ausstattung ist vorbildlich und hält — so
selten diese edle Mitte — das natürliche Maß zwischen prunkvoller Auf-
machung und unzureichender Darbietung. Bruno Grimschilz.
Ein neues Werk Alfred Coßmanns.
Alfred Coßmann, seit 1920/21 Ludwig Michaleks Nachfolger an der
Wiener »Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt«, ist den Freunden
unserer Gesellschaft längst wohlbekannt. Nach den sechs Radierungen
zu Gottfried Kellers »Drei gerechten Kammachern«, die, mit diesen
Blättern geschmückt, 1915 zusammen mit der Kriegslithographie von
Albin Egger-Lienz die Jahresgabe unserer Gesellschaft bildeten, schuf
er bereits 1919 für den Bruckmannschen Verlag in München zehn
kleine Stichradierungen zu Gottfried Kellers »Landvogt von Greifen-
see«. Nun, nach längerer Pause ist abermals eine Folge graphischer
Blätter des Künstlers erschienen. Diesmal sind es reine Linienstiche, die
sich aber an kein Dichterwerk anschließen, sondern eigene Gedanken,
eigene Verse des Stechers zu bildkünstlerischem Ausdruck bringen.
14
weht strömend über die Helligkeiten. Weil der Überlegenheit dieser
persönlichen Paraphrase alle Bindung und Hemmung durch das Bild der
Wirklichkeit abfiel. Einzigartig die Modulationsfähigkeit der graphischen
Bewegung. Sie wird in dem Entwurf aus dem Fridericus-Zyklus: Im
Lager von Liegnitz zum Ausdruck drückend-großartiger Schwere ein-
samen Denkens, im folgenden Blatte mit dem Liebespaar im Park zur
Stimmung wollüstig-weicher Mondnacht und in der Tuschzeichnung:
Martin Luther zur ergreifenden Verlebendigung dieses deutschen
Schicksals.
Aus demselben Grunde widerlegen die Zeichnungen Corinths den
Einwand der Einseitigkeit. Den Einwand der Begrenztheit im Ausdruck,
die im Gegensatz von Akademiehaftem und erschreckendster Brutalität
begründet lag. Diese Begrenztheit erweist sich als Fiktion. Der späte
Corinth wächst über diese Zwiespältigkeit, die im wesentlichen eine
Frage des Darstellungsthemas blieb, hinaus. Das Akademische und das
Brutale, alle Fragen des Gegenständlichen und des künstlerischen Prob-
lems gehen ein in die Universalität des Menschlichen. Und dieser letzten
Größe, die alle Problematik des Suchens und Schwankens eines Maler-
lebens löst, weil von dem tiefsten Pol distanzierter, überlegenster
Menschlichkeit die Aktualität dieser Entscheidungen gegenstandslos
geworden ist, enthüllt die Wandlungsfähigkeit der graphischen Sprache
alle Möglichkeiten des Psychischen und Formalen. Das Verhältnis des
Künstlers zu seiner Gattin löst reinste Klänge von fast renoirhafter Süßig-
keit und das Thema der stillenden Mutter erhebt sich in der Zärtlichkeit
und Tiefe der Empfindung zu ergreifender Intensität. Das Aktproblem
tritt zurück. Das Formale der Aktdarstellung verwehrt die volle Weite
menschlicher Beteiligung. Sie konzentriert sich auf das Antlitz. Und es
entstehen Bildnisse, befreit von aller profanen Sachlichkeit konstatierender
Modellschilderung. Es sind Menschen.
Aber auch diese Bildnisdokumente überstrahlen die Landschaften.
Sie sind der absolute Ausdruck des größten künstlerischen Phänomens
unter den lebenden Deutschen, des nun fünfundsechzigj ährigen Lovis
Corinth.
Max Slevogts graphische Kunst verblaßt neben diesem Ausmaß
künstlerischer Universalität. Sie wird artistisch. Trotz der hinreißenden
Fülle ihrer Phantasie, trotz des blendenden Umfanges ihrer künstlerischen
Möglichkeiten bleibt sie in den Grenzen impressionistischer Einstellung.
Sie ist impressionistisch, ist äußerste Steigerung optischer Bewegtheit.
Ist Raffinement, letzte Verfeinerung graphischer Möglichkeiten. Eine
seltenste Verbindung gegenständlicher Phantasie und beweglichster
Sensationen impressionistischer Anschauung. Sie ist mehr: sie gibt
das absolute Beispiel der Abwandlung des optischen Impressionismus
an unrealistischem Erzählungsmaterial. Und damit eine klassische
Illustrationskunst. Waldmann hat in einer überlegenen Auswahl die
graphische Entwicklung Slevogts im vierten Band der ersten Folge von
Arnolds graphischen Büchern gegeben. Dem Bande fehlt die Aktualität,
die den Band mit den Zeichnungen Corinths zu einer Entdeckung macht.
Denn die Illustrationsfolgen Slevogts liegen in den graphischen Kabinetten
zugänglich und erreichbar. Aber neu betont erscheint in der Zusammen-
fassung Waldmanns die innere Konsequenz dieser Entwicklung, aus der
sich als Höhepunkte die Randzeichnungen zu Mozarts Zauberflöte und
die Lithographien der Zyklen: Hektar und Die Inseln Wak-Wak heraus-
heben. Gerade hier wird die Unzulänglichkeit der Reproduktion fühlbar.
Die unerhörte Differenzierung dieser Kreidelithographien, die zu letzten
Steigerungen schwebendster Feinheiten geführt ist, bleibt unwirksam.
Damit verschiebt sich die Wirkungslinie der künstlerischen Intensität
zum Nachteil Slevogts. Denn breiter wirkt das Peripherale der Leistung
als die Gipfelung. Aber nicht so sehr drückt diese Verschiebung auf das
Maß der Wertung, als die Erscheinung der Totalität dieser künstlerischen
Produktion selbst die Grenzen ihrer Wirkung setzt. Sie ist durch das
Illustrative bestimmt. Durch die absolute Bindung der künstlerischen
Mittel an das Darstellungsthema. Seit den Anfängen Slevogts ist diese
ideale Einheit des persönlichen Ausdrucks gegeben: diese vollkommene
Deckung der Ansprüche des Gegenständlichen und der künstlerischen
Grundrichtung des subjektiven Gestaltungswillens. Wie wirkt dagegen
Corinths Problematik, die ihr Talent in extremen Versuchen herumriß,
ohne durch Jahrzehnte die notwendig-natürliche Form des Persönlichen
finden zu können! Bis sie sich im Alter erhob und dann alles überbot, was
in dem ungleich begrenzteren Umkreis der künstlerischen Möglichkeiten
Slevogts lag, in dem sie nur mehr in dem von aller Bindung befreiten, ab-
soluten Maß des Menschlichen die metaphysisch strömenden Gesetze
ihres künstlerischen Ausdrucks fand.
Zu dieser Höhe erhob sich Munch. Im Tiefsten gegensätzlich zu
Corinth, in der künstlerischen Grundstruktur seiner Schöpfung, aber
auch in absoluter Gegensätzlichkeit des äußeren Lebensschicksals.
Corinth entwuchs an der Schwelle des Alters der kollektivistischen
Gemeinsamkeit der impressionistischen Anschauung und wurde einsam,
weil er das Allgemeine in dem unendlich tieferen Ausmaß seiner mensch-
lichen Realitäten der programmatischen Geltung und Bedeutung ent-
kleidete. Munch war vom Beginn seines Weges Führer, Pol einer
allgemeinen Bewegung. Er fand den Ausdruck der Zeit. Seine Kunst war
in ihren ersten Äußerungen bereits — wie die Kunst aller nordischen
Menschen — in das Metaphysische gekehrt. Sie kreiste um tiefste
Wesenheiten des Daseins. Um Tod und Liebe, Krankheit und Einsam-
keit, um das ewige Problem der Geschlechter. Und war damit, durch
diese allgemeinste Fundamentierung ihrer menschlichen Anliegen auf
weiteste Resonanz gerichtet. Auch die künstlerische Form wies auf das
Allgemeine. Wie die wenigen Hauptthemen entscheidend das Bild dieses
Menschen bestimmen, so erscheinen die künstlerischen Grundelemente
dieses Schaffens in ihrem Umfang begrenzt. Alle Problematik der Diffe-
renzierung der Mittel fehlt. Sie sind von einem Zug allgemeiner Größe.
Sie sind formelhaft in des Wortes reinstem Sinn. In dieser Wendung zur
abstrakten Allgemeinheit lag für Munchs Kunst die einzige Gefahr. Das
Symbolhafte drängte zu dekorativer Veräußerlichung der Formel. Aber
es bleibt bewundernswert, wie Munch dieser Erstarrung seiner formalen
Mittel durch immer neue Aufnahme des Naturstudiums begegnete. Wie
seine großen Zusammenfassungen, waren sie an die Grenze naturferner
Stilisierung geraten, durch das Bild der Wirklichkeit wieder ihre volle
Vitalität erhielten. Darin liegt die letzte Gewalt dieser Kunst: daß die
persönliche Form so absolut der sichtbaren Erscheinung innerlich ver-
bunden blieb und zugleich durch die äußere Prägnanz ihres Wesentlichen
das Jenseitige mit so machtvoller Größe und Intensität emporholte. Nicht
nur in der Paraphrase des großen metaphysischen Problems von Sein,
Liebe oder Tod, sondern auch in der Eroberung des unmittelbar Sicht-
baren. Im Bildnis oder in der Tierdarstellung. Corinths Elefant ist eine
einmalige Realität, die mit einer erschreckenden Unmittelbarkeit einher-
stürmt. Munchs Tiger wird Gleichnis der Art, Symbol. Das Gleichnis-
hafte, Überindividuelle ist die unveränderliche Grundlinie in Munchs
Kunst. Die Melodie der Natur steigt und fällt. Und dies Ringen um den
völligen Einklang von Vision und Wirklichkeit in Munchs graphischer
Kunst umschreibt die Auswahl, die Gustav Schiefler im letzten Bande
der Arnoldschen Graphikbücher gegeben hat. Aus dem großen Material
dieses mit einzigartiger Universalität verschiedenste Techniken beherr-
schenden Lebenswerkes sind die vollendeten Lösungen herausgehoben
und mit einem sachlich-klaren Vorwort einbegleitet. Die Abbildungen
selbst — dies gilt für alle Bände der Arnoldschen Graphikfolgen — sind
ausgezeichnet gedruckt, die Ausstattung ist vorbildlich und hält — so
selten diese edle Mitte — das natürliche Maß zwischen prunkvoller Auf-
machung und unzureichender Darbietung. Bruno Grimschilz.
Ein neues Werk Alfred Coßmanns.
Alfred Coßmann, seit 1920/21 Ludwig Michaleks Nachfolger an der
Wiener »Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt«, ist den Freunden
unserer Gesellschaft längst wohlbekannt. Nach den sechs Radierungen
zu Gottfried Kellers »Drei gerechten Kammachern«, die, mit diesen
Blättern geschmückt, 1915 zusammen mit der Kriegslithographie von
Albin Egger-Lienz die Jahresgabe unserer Gesellschaft bildeten, schuf
er bereits 1919 für den Bruckmannschen Verlag in München zehn
kleine Stichradierungen zu Gottfried Kellers »Landvogt von Greifen-
see«. Nun, nach längerer Pause ist abermals eine Folge graphischer
Blätter des Künstlers erschienen. Diesmal sind es reine Linienstiche, die
sich aber an kein Dichterwerk anschließen, sondern eigene Gedanken,
eigene Verse des Stechers zu bildkünstlerischem Ausdruck bringen.
14