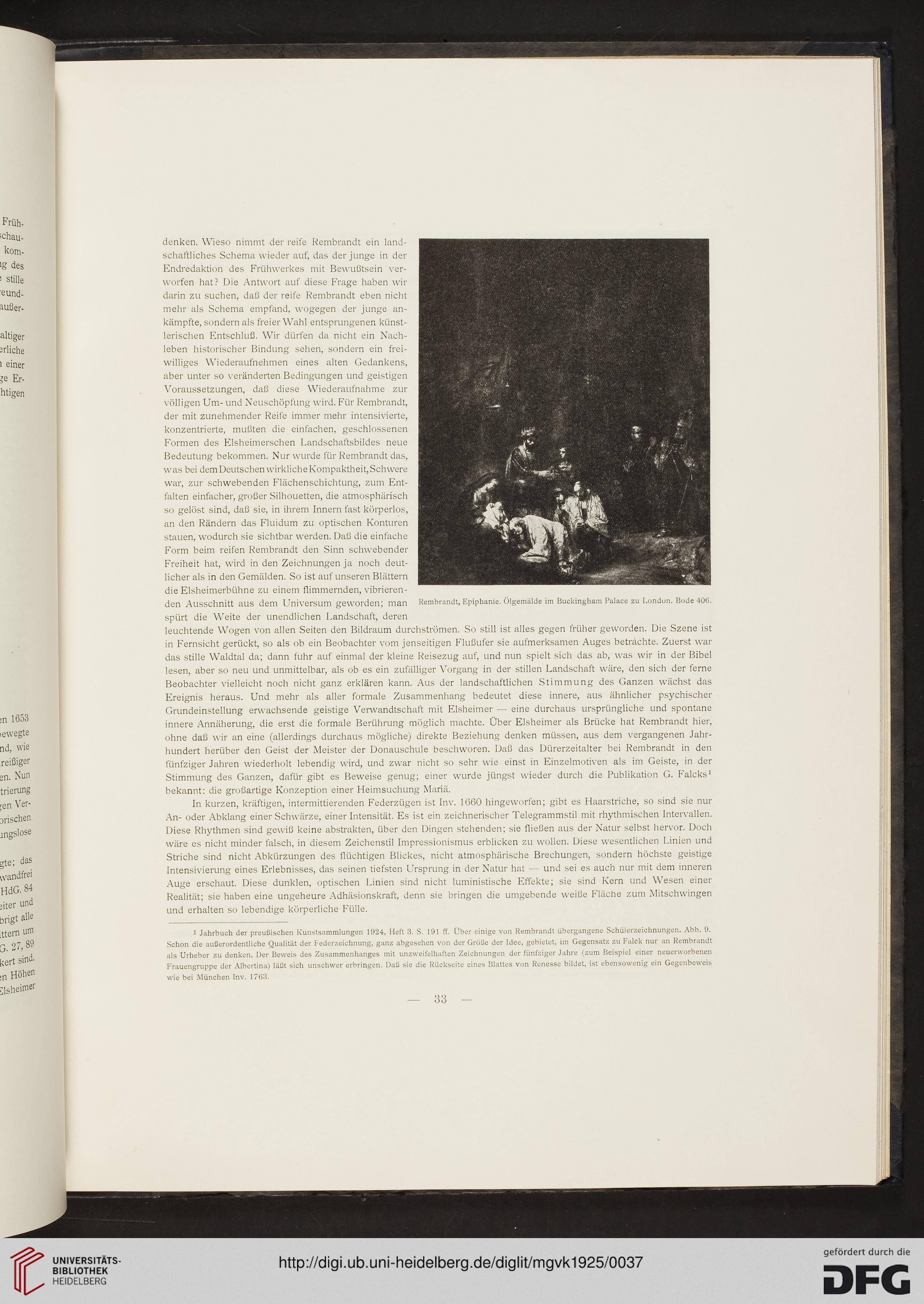IgffHffE
HHMHNRMHHRMHHHHH9
denken. Wieso nimmt der reife Rembrandt ein land-
schaftliches Schema wieder auf, das der junge in der
Endredaktion des Frühwerkes mit Bewußtsein ver-
worfen hat? Die Antwort auf diese Frage haben wir
darin zu suchen, daß der reife Rembrandt eben nicht
mehr als Schema empfand, wogegen der junge an-
kämpfte, sondern als freier Wahl entsprungenen künst-
lerischen Entschluß. Wir dürfen da nicht ein Nach-
leben historischer Bindung sehen, sondern ein frei-
williges Wiederaufnehmen eines alten Gedankens,
aber unter so veränderten Bedingungen und geistigen
Voraussetzungen, daß diese Wiederaufnahme zur
völligen Um- und Neuschöpfung wird. Für Rembrandt,
der mit zunehmender Reife immer mehr intensivierte,
konzentrierte, mußten die einfachen, geschlossenen
Formen des Elsheimerschen Landschaftsbildes neue
Bedeutung bekommen. Nur wurde für Rembrandt das,
was bei demDeutschenwirklicheKompaktheit,Schwere
war, zur schwebenden Flächenschichtung, zum Ent-
falten einfacher, großer Silhouetten, die atmosphärisch
so gelöst sind, daß sie, in ihrem Innern fast körperlos,
an den Rändern das Fluidum zu optischen Konturen
stauen, wodurch sie sichtbar werden. Daß die einfache
Form beim reifen Rembrandt den Sinn schwebender
Freiheit hat, wird in den Zeichnungen ja noch deut-
licher als in den Gemälden. So ist auf unseren Blättern
die Elsheimerbühne zu einem flimmernden, vibrieren-
den Ausschnitt aus dem Universum geworden; man
spürt die Weite der unendlichen Landschaft, deren
leuchtende Wogen von allen Seiten den Bildraum durchströmen. So still ist alles gegen früher geworden. Die Szene ist
in Fernsicht gerückt, so als ob ein Beobachter vom jenseitigen Flußufer sie aufmerksamen Auges beträchte. Zuerst war
das stille Waldtal da; dann fuhr auf einmal der kleine Reisezug auf, und nun spielt sich das ab, was wir in der Bibel
lesen, aber so neu und unmittelbar, als ob es ein zufälliger Vorgang in der stillen Landschaft wäre, den sich der ferne
Beobachter vielleicht noch nicht ganz erklären kann. Aus der landschaftlichen Stimmung des Ganzen wächst das
Ereignis heraus. Und mehr als aller formale Zusammenhang bedeutet diese innere, aus ähnlicher psychischer
Grundeinstellung erwachsende geistige Verwandtschaft mit Elsheimer — eine durchaus ursprüngliche und spontane
innere Annäherung, die erst die formale Berührung möglich machte. Über Elsheimer als Brücke hat Rembrandt hier,
ohne daß wir an eine (allerdings durchaus mögliche) direkte Beziehung denken müssen, aus dem vergangenen Jahr-
hundert herüber den Geist der Meister der Donauschule beschworen. Daß das Dürerzeitalter bei Rembrandt in den
fünfziger Jahren wiederholt lebendig wird, und zwar nicht so sehr wie einst in Einzelmotiven als im Geiste, in der
Stimmung des Ganzen, dafür gibt es Beweise genug; einer wurde jüngst wieder durch die Publikation G. Falcks1
bekannt: die großartige Konzeption einer Heimsuchung Maria.
In kurzen, kräftigen, intermittierenden Federzügen ist Inv. 1660 hingeworfen; gibt es Haarstriche, so sind sie nur
An- oder Abklang einer Schwärze, einer Intensität. Es ist ein zeichnerischer Telegrammstil mit rhythmischen Intervallen.
Diese Rhythmen sind gewiß keine abstrakten, über den Dingen stehenden; sie fließen aus der Natur selbst hervor. Doch
wäre es nicht minder falsch, in diesem Zeichenstil Impressionismus erblicken zu wollen. Diese wesentlichen Linien und
Striche sind nicht Abkürzungen des flüchtigen Blickes, nicht atmosphärische Brechungen, sondern höchste geistige
Intensivierung eines Erlebnisses, das seinen tiefsten Ursprung in der Natur hat — und sei es auch nur mit dem inneren
Auge erschaut. Diese dunklen, optischen Linien sind nicht luministische Effekte; sie sind Kern und Wesen einer
Realität; sie haben eine ungeheure Adhäsionskraft, denn sie bringen die umgebende weiße Fläche zum Mitschwingen
und erhalten so lebendige körperliche Fülle.
Rembrandt, Epiphanie. Ölgemälde im Buckingham Palace zu London. Bode 406.
1 Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 1924, Heft 3. S. 191 ff. Über einige von Rembrandt übergangene Schülerzeichnungen. Abb. 9.
Schon die außerordentliche Qualität der I'ederzeichnung, ganz abgesehen von der Größe der Idee, gebietet, im Gegensatz zu Falck nur an Rembrandt
als Urheber zu denken. Der Beweis des Zusammenhanges mit unzweifelhaften Zeichnungen der fünfziger Jahre (zum Beispiel einer neuerworbenen
Frauengruppe der Albertina) läßt sich unschwer erbringen. Daß sie die Rückseite eines Blattes von Renesse bildet, ist ebensowenig ein Gegenbeweis
wie bei München Inv. 1763.
33
HHMHNRMHHRMHHHHH9
denken. Wieso nimmt der reife Rembrandt ein land-
schaftliches Schema wieder auf, das der junge in der
Endredaktion des Frühwerkes mit Bewußtsein ver-
worfen hat? Die Antwort auf diese Frage haben wir
darin zu suchen, daß der reife Rembrandt eben nicht
mehr als Schema empfand, wogegen der junge an-
kämpfte, sondern als freier Wahl entsprungenen künst-
lerischen Entschluß. Wir dürfen da nicht ein Nach-
leben historischer Bindung sehen, sondern ein frei-
williges Wiederaufnehmen eines alten Gedankens,
aber unter so veränderten Bedingungen und geistigen
Voraussetzungen, daß diese Wiederaufnahme zur
völligen Um- und Neuschöpfung wird. Für Rembrandt,
der mit zunehmender Reife immer mehr intensivierte,
konzentrierte, mußten die einfachen, geschlossenen
Formen des Elsheimerschen Landschaftsbildes neue
Bedeutung bekommen. Nur wurde für Rembrandt das,
was bei demDeutschenwirklicheKompaktheit,Schwere
war, zur schwebenden Flächenschichtung, zum Ent-
falten einfacher, großer Silhouetten, die atmosphärisch
so gelöst sind, daß sie, in ihrem Innern fast körperlos,
an den Rändern das Fluidum zu optischen Konturen
stauen, wodurch sie sichtbar werden. Daß die einfache
Form beim reifen Rembrandt den Sinn schwebender
Freiheit hat, wird in den Zeichnungen ja noch deut-
licher als in den Gemälden. So ist auf unseren Blättern
die Elsheimerbühne zu einem flimmernden, vibrieren-
den Ausschnitt aus dem Universum geworden; man
spürt die Weite der unendlichen Landschaft, deren
leuchtende Wogen von allen Seiten den Bildraum durchströmen. So still ist alles gegen früher geworden. Die Szene ist
in Fernsicht gerückt, so als ob ein Beobachter vom jenseitigen Flußufer sie aufmerksamen Auges beträchte. Zuerst war
das stille Waldtal da; dann fuhr auf einmal der kleine Reisezug auf, und nun spielt sich das ab, was wir in der Bibel
lesen, aber so neu und unmittelbar, als ob es ein zufälliger Vorgang in der stillen Landschaft wäre, den sich der ferne
Beobachter vielleicht noch nicht ganz erklären kann. Aus der landschaftlichen Stimmung des Ganzen wächst das
Ereignis heraus. Und mehr als aller formale Zusammenhang bedeutet diese innere, aus ähnlicher psychischer
Grundeinstellung erwachsende geistige Verwandtschaft mit Elsheimer — eine durchaus ursprüngliche und spontane
innere Annäherung, die erst die formale Berührung möglich machte. Über Elsheimer als Brücke hat Rembrandt hier,
ohne daß wir an eine (allerdings durchaus mögliche) direkte Beziehung denken müssen, aus dem vergangenen Jahr-
hundert herüber den Geist der Meister der Donauschule beschworen. Daß das Dürerzeitalter bei Rembrandt in den
fünfziger Jahren wiederholt lebendig wird, und zwar nicht so sehr wie einst in Einzelmotiven als im Geiste, in der
Stimmung des Ganzen, dafür gibt es Beweise genug; einer wurde jüngst wieder durch die Publikation G. Falcks1
bekannt: die großartige Konzeption einer Heimsuchung Maria.
In kurzen, kräftigen, intermittierenden Federzügen ist Inv. 1660 hingeworfen; gibt es Haarstriche, so sind sie nur
An- oder Abklang einer Schwärze, einer Intensität. Es ist ein zeichnerischer Telegrammstil mit rhythmischen Intervallen.
Diese Rhythmen sind gewiß keine abstrakten, über den Dingen stehenden; sie fließen aus der Natur selbst hervor. Doch
wäre es nicht minder falsch, in diesem Zeichenstil Impressionismus erblicken zu wollen. Diese wesentlichen Linien und
Striche sind nicht Abkürzungen des flüchtigen Blickes, nicht atmosphärische Brechungen, sondern höchste geistige
Intensivierung eines Erlebnisses, das seinen tiefsten Ursprung in der Natur hat — und sei es auch nur mit dem inneren
Auge erschaut. Diese dunklen, optischen Linien sind nicht luministische Effekte; sie sind Kern und Wesen einer
Realität; sie haben eine ungeheure Adhäsionskraft, denn sie bringen die umgebende weiße Fläche zum Mitschwingen
und erhalten so lebendige körperliche Fülle.
Rembrandt, Epiphanie. Ölgemälde im Buckingham Palace zu London. Bode 406.
1 Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 1924, Heft 3. S. 191 ff. Über einige von Rembrandt übergangene Schülerzeichnungen. Abb. 9.
Schon die außerordentliche Qualität der I'ederzeichnung, ganz abgesehen von der Größe der Idee, gebietet, im Gegensatz zu Falck nur an Rembrandt
als Urheber zu denken. Der Beweis des Zusammenhanges mit unzweifelhaften Zeichnungen der fünfziger Jahre (zum Beispiel einer neuerworbenen
Frauengruppe der Albertina) läßt sich unschwer erbringen. Daß sie die Rückseite eines Blattes von Renesse bildet, ist ebensowenig ein Gegenbeweis
wie bei München Inv. 1763.
33