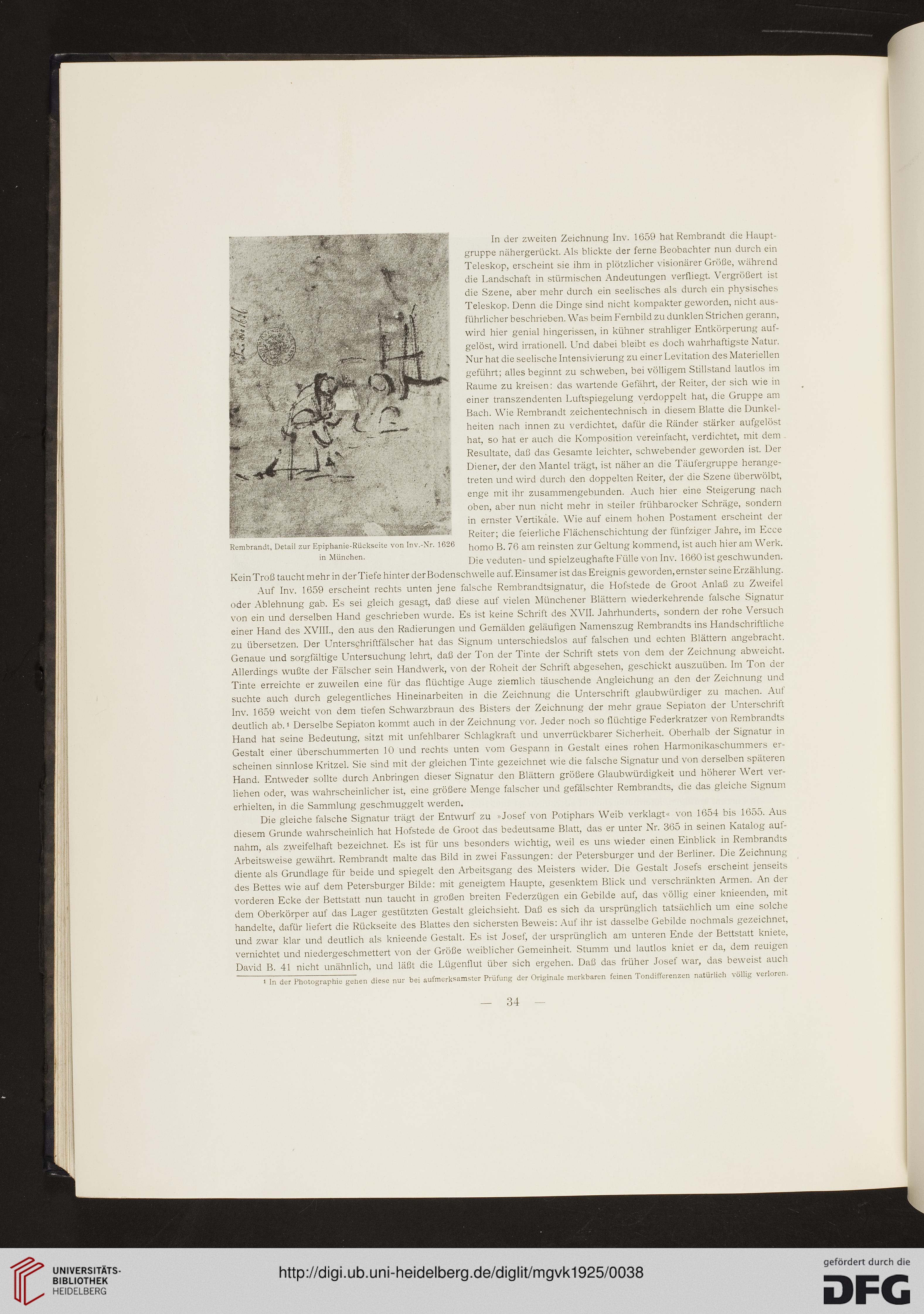Rembrandt, Detail zur Epiphanie-Rückseite von Inv.-Nr. 1626
in München.
In der zweiten Zeichnung Inv. 1659 hat Rembrandt die Haupt-
gruppe nähergerückt. Als blickte der ferne Beobachter nun durch ein
Teleskop, erscheint sie ihm in plötzlicher visionärer Größe, während
die Landschaft in stürmischen Andeutungen verfliegt. Vergrößert ist
die Szene, aber mehr durch ein seelisches als durch ein physisches
Teleskop. Denn die Dinge sind nicht kompakter geworden, nicht aus-
führlicher beschrieben. Was beim Fernbild zu dunklen Strichen gerann,
wird hier genial hingerissen, in kühner strahliger Entkörperung auf-
gelöst, wird irrationell. Und dabei bleibt es doch wahrhaftigste Natur.
Nur hat die seelische Intensivierung zu einer Levitation des Materiellen
geführt; alles beginnt zu schweben, bei völligem Stillstand lautlos im
Räume zu kreisen: das wartende Gefährt, der Reiter, der sich wie in
einer transzendenten Luftspiegelung verdoppelt hat, die Gruppe am
Bach. Wie Rembrandt zeichentechnisch in diesem Blatte die Dunkel-
heiten nach innen zu verdichtet, dafür die Ränder stärker aufgelöst
hat, so hat er auch die Komposition vereinfacht, verdichtet, mit dem -
Resultate, daß das Gesamte leichter, schwebender geworden ist. Der
Diener, der den Mantel trägt, ist näher an die Täufergruppe herange-
treten und wird durch den doppelten Reiter, der die Szene überwölbt,
enge mit ihr zusammengebunden. Auch hier eine Steigerung nach
oben, aber nun nicht mehr in steiler frühbarocker Schräge, sondern
in ernster Vertikale. Wie auf einem hohen Postament erscheint der
Reiter; die feierliche Flächenschichtung der fünfziger Jahre, im Ecce
homo B. 76 am reinsten zur Geltung kommend, ist auch hier am Werk.
Die veduten- und spielzeughafte Fülle von Inv. 1660 ist geschwunden.
Kein Troß taucht mehr in der Tiefe hinter der Bodenschwelle auf. Einsamer ist das Ereignis geworden, ernster seine Erzählung.
Auf Inv. 1659 erscheint rechts unten jene falsche Rembrandtsignatur, die Hofstede de Groot Anlaß zu Zweifel
oder Ablehnung gab. Es sei gleich gesagt, daß diese auf vielen Münchener Blättern wiederkehrende falsche Signatur
von ein und derselben Hand geschrieben wurde. Es ist keine Schrift des XVII. Jahrhunderts, sondern der rohe Versuch
einer Hand des XVIII., den aus den Radierungen und Gemälden geläufigen Namenszug Rembrandts ins Handschriftliche
zu übersetzen. Der Unterschriftfälscher hat das Signum unterschiedslos auf falschen und echten Blättern angebracht.
Genaue und sorgfältige Untersuchung lehrt, daß der Ton der Tinte der Schrift stets von dem der Zeichnung abweicht.
Allerdings wußte der Fälscher sein Handwerk, von der Roheit der Schrift abgesehen, geschickt auszuüben. Im Ton der
Tinte erreichte er zuweilen eine für das flüchtige Auge ziemlich täuschende Angleichung an den der Zeichnung und
suchte auch durch gelegentliches Hineinarbeiten in die Zeichnung die Unterschrift glaubwürdiger zu machen. Auf
Inv. 1659 weicht von dem tiefen Schwarzbraun des Bisters der Zeichnung der mehr graue Sepiaton der Unterschrift
deutlich ab.1 Derselbe Sepiaton kommt auch in der Zeichnung vor. Jeder noch so flüchtige Federkratzer von Rembrandts
Hand hat seine Bedeutung, sitzt mit unfehlbarer Schlagkraft und unverrückbarer Sicherheit. Oberhalb der Signatur in
Gestalt einer überschummerten 10 und rechts unten vom Gespann in Gestalt eines rohen Harmonikaschummers er-
scheinen sinnlose Kritzel. Sie sind mit der gleichen Tinte gezeichnet wie die falsche Signatur und von derselben späteren
Hand. Entweder sollte durch Anbringen dieser Signatur den Blättern größere Glaubwürdigkeit und höherer Wert ver-
liehen oder, was wahrscheinlicher ist, eine größere Menge falscher und gefälschter Rembrandts, die das gleiche Signum
erhielten, in die Sammlung geschmuggelt werden.
Die gleiche falsche Signatur trägt der Entwurf zu »Josef von Potiphars Weib verklagt« von 1654 bis 1655. Aus
diesem Grunde wahrscheinlich hat Hofstede de Groot das bedeutsame Blatt, das er unter Nr. 365 in seinen Katalog auf-
nahm, als zweifelhaft bezeichnet. Es ist für uns besonders wichtig, weil es uns wieder einen Einblick in Rembrandts
Arbeitsweise gewährt. Rembrandt malte das Bild in zwei Fassungen: der Petersburger und der Berliner. Die Zeichnung
diente als Grundlage für beide und spiegelt den Arbeitsgang des Meisters wider. Die Gestalt Josefs erscheint jenseits
des Bettes wie auf dem Petersburger Bilde: mit geneigtem Haupte, gesenktem Blick und verschränkten Armen. An der
vorderen Ecke der Bettstatt nun taucht in großen breiten Federzügen ein Gebilde auf, das völlig einer knieenden, mit
dem Oberkörper auf das Lager gestützten Gestalt gleichsieht. Daß es sich da ursprünglich tatsächlich um eine solche
handelte, dafür liefert die Rückseite des Blattes den sichersten Beweis: Auf ihr ist dasselbe Gebilde nochmals gezeichnet,
und zwar klar und deutlich als knieende Gestalt. Es ist Josef, der ursprünglich am unteren Ende der Bettstatt kniete,
vernichtet und niedergeschmettert von der Größe weiblicher Gemeinheit. Stumm und lautlos kniet er da, dem reuigen
David B. 41 nicht unähnlich, und läßt die Lügenflut über sich ergehen. Daß das früher Josef war, das beweist auch
i In der Photographie gehen diese nur bei aufmerksamster Prüfung der Originale merkbaren feinen Tondifferenzen natürlich völlig verloren.
— 34
in München.
In der zweiten Zeichnung Inv. 1659 hat Rembrandt die Haupt-
gruppe nähergerückt. Als blickte der ferne Beobachter nun durch ein
Teleskop, erscheint sie ihm in plötzlicher visionärer Größe, während
die Landschaft in stürmischen Andeutungen verfliegt. Vergrößert ist
die Szene, aber mehr durch ein seelisches als durch ein physisches
Teleskop. Denn die Dinge sind nicht kompakter geworden, nicht aus-
führlicher beschrieben. Was beim Fernbild zu dunklen Strichen gerann,
wird hier genial hingerissen, in kühner strahliger Entkörperung auf-
gelöst, wird irrationell. Und dabei bleibt es doch wahrhaftigste Natur.
Nur hat die seelische Intensivierung zu einer Levitation des Materiellen
geführt; alles beginnt zu schweben, bei völligem Stillstand lautlos im
Räume zu kreisen: das wartende Gefährt, der Reiter, der sich wie in
einer transzendenten Luftspiegelung verdoppelt hat, die Gruppe am
Bach. Wie Rembrandt zeichentechnisch in diesem Blatte die Dunkel-
heiten nach innen zu verdichtet, dafür die Ränder stärker aufgelöst
hat, so hat er auch die Komposition vereinfacht, verdichtet, mit dem -
Resultate, daß das Gesamte leichter, schwebender geworden ist. Der
Diener, der den Mantel trägt, ist näher an die Täufergruppe herange-
treten und wird durch den doppelten Reiter, der die Szene überwölbt,
enge mit ihr zusammengebunden. Auch hier eine Steigerung nach
oben, aber nun nicht mehr in steiler frühbarocker Schräge, sondern
in ernster Vertikale. Wie auf einem hohen Postament erscheint der
Reiter; die feierliche Flächenschichtung der fünfziger Jahre, im Ecce
homo B. 76 am reinsten zur Geltung kommend, ist auch hier am Werk.
Die veduten- und spielzeughafte Fülle von Inv. 1660 ist geschwunden.
Kein Troß taucht mehr in der Tiefe hinter der Bodenschwelle auf. Einsamer ist das Ereignis geworden, ernster seine Erzählung.
Auf Inv. 1659 erscheint rechts unten jene falsche Rembrandtsignatur, die Hofstede de Groot Anlaß zu Zweifel
oder Ablehnung gab. Es sei gleich gesagt, daß diese auf vielen Münchener Blättern wiederkehrende falsche Signatur
von ein und derselben Hand geschrieben wurde. Es ist keine Schrift des XVII. Jahrhunderts, sondern der rohe Versuch
einer Hand des XVIII., den aus den Radierungen und Gemälden geläufigen Namenszug Rembrandts ins Handschriftliche
zu übersetzen. Der Unterschriftfälscher hat das Signum unterschiedslos auf falschen und echten Blättern angebracht.
Genaue und sorgfältige Untersuchung lehrt, daß der Ton der Tinte der Schrift stets von dem der Zeichnung abweicht.
Allerdings wußte der Fälscher sein Handwerk, von der Roheit der Schrift abgesehen, geschickt auszuüben. Im Ton der
Tinte erreichte er zuweilen eine für das flüchtige Auge ziemlich täuschende Angleichung an den der Zeichnung und
suchte auch durch gelegentliches Hineinarbeiten in die Zeichnung die Unterschrift glaubwürdiger zu machen. Auf
Inv. 1659 weicht von dem tiefen Schwarzbraun des Bisters der Zeichnung der mehr graue Sepiaton der Unterschrift
deutlich ab.1 Derselbe Sepiaton kommt auch in der Zeichnung vor. Jeder noch so flüchtige Federkratzer von Rembrandts
Hand hat seine Bedeutung, sitzt mit unfehlbarer Schlagkraft und unverrückbarer Sicherheit. Oberhalb der Signatur in
Gestalt einer überschummerten 10 und rechts unten vom Gespann in Gestalt eines rohen Harmonikaschummers er-
scheinen sinnlose Kritzel. Sie sind mit der gleichen Tinte gezeichnet wie die falsche Signatur und von derselben späteren
Hand. Entweder sollte durch Anbringen dieser Signatur den Blättern größere Glaubwürdigkeit und höherer Wert ver-
liehen oder, was wahrscheinlicher ist, eine größere Menge falscher und gefälschter Rembrandts, die das gleiche Signum
erhielten, in die Sammlung geschmuggelt werden.
Die gleiche falsche Signatur trägt der Entwurf zu »Josef von Potiphars Weib verklagt« von 1654 bis 1655. Aus
diesem Grunde wahrscheinlich hat Hofstede de Groot das bedeutsame Blatt, das er unter Nr. 365 in seinen Katalog auf-
nahm, als zweifelhaft bezeichnet. Es ist für uns besonders wichtig, weil es uns wieder einen Einblick in Rembrandts
Arbeitsweise gewährt. Rembrandt malte das Bild in zwei Fassungen: der Petersburger und der Berliner. Die Zeichnung
diente als Grundlage für beide und spiegelt den Arbeitsgang des Meisters wider. Die Gestalt Josefs erscheint jenseits
des Bettes wie auf dem Petersburger Bilde: mit geneigtem Haupte, gesenktem Blick und verschränkten Armen. An der
vorderen Ecke der Bettstatt nun taucht in großen breiten Federzügen ein Gebilde auf, das völlig einer knieenden, mit
dem Oberkörper auf das Lager gestützten Gestalt gleichsieht. Daß es sich da ursprünglich tatsächlich um eine solche
handelte, dafür liefert die Rückseite des Blattes den sichersten Beweis: Auf ihr ist dasselbe Gebilde nochmals gezeichnet,
und zwar klar und deutlich als knieende Gestalt. Es ist Josef, der ursprünglich am unteren Ende der Bettstatt kniete,
vernichtet und niedergeschmettert von der Größe weiblicher Gemeinheit. Stumm und lautlos kniet er da, dem reuigen
David B. 41 nicht unähnlich, und läßt die Lügenflut über sich ergehen. Daß das früher Josef war, das beweist auch
i In der Photographie gehen diese nur bei aufmerksamster Prüfung der Originale merkbaren feinen Tondifferenzen natürlich völlig verloren.
— 34