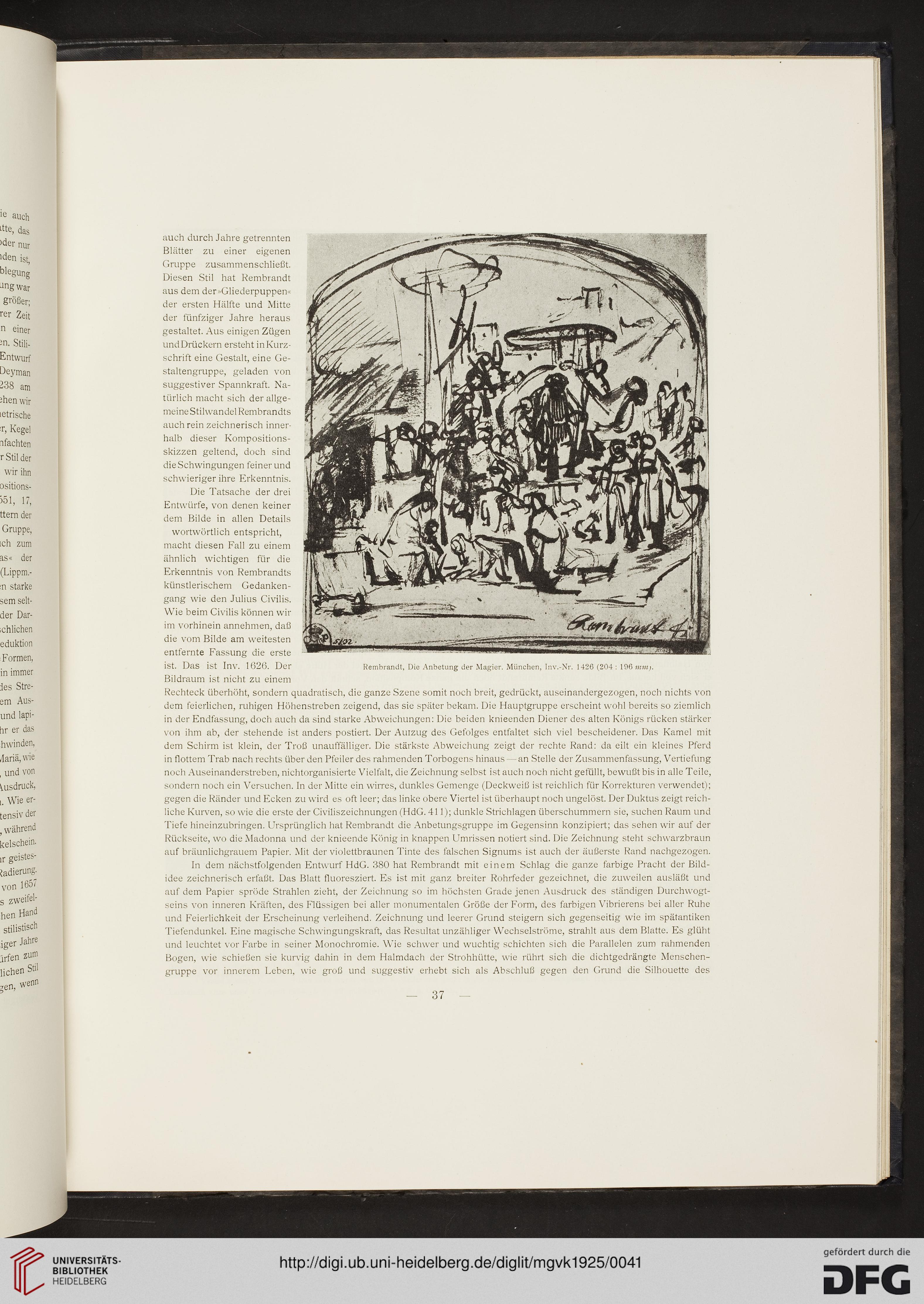■
■m
«■■■■■■■
auch
e, das
er nur
en ist,
egung
auch durch Jahre getrennten
Blätter zu einer eigenen
Gruppe zusammenschließt.
Diesen Stil hat Rembrandt
aus dem der»Gliederpuppen«
der ersten Hälfte und Mitte
der fünfziger Jahre heraus
gestaltet. Aus einigen Zügen
undDrückern ersteht in Kurz-
schrift eine Gestalt, eine Ge-
staltengruppe, geladen von
suggestiver Spannkraft. Na-
türlich macht sich der allge-
meine Stilwandel Rembrandts
auch rein zeichnerisch inner-
halb dieser Kompositions-
skizzen geltend, doch sind
die Schwingungen feiner und
schwieriger ihre Erkenntnis.
Die Tatsache der drei
Entwürfe, von denen keiner
dem Bilde in allen Details
wortwörtlich entspricht,
macht diesen Fall zu einem
ähnlich wichtigen für die
Erkenntnis von Rembrandts
künstlerischem Gedanken-
gang wie den Julius Civilis.
Wie beim Civilis können wir
im vorhinein annehmen, daß
die vom Bilde am weitesten
entfernte Fassung die erste
ist. Das ist Inv. 1626. Der
Bildraum ist nicht zu einem
Rechteck überhöht, sondern quadratisch, die ganze Szene somit noch breit, gedrückt, auseinandergezogen, noch nichts von
dem feierlichen, ruhigen Höhenstreben zeigend, das sie später bekam. Die Hauptgruppe erscheint wohl bereits so ziemlich
in der Endfassung, doch auch da sind starke Abweichungen: Die beiden knieenden Diener des alten Königs rücken stärker
von ihm ab, der stehende ist anders postiert. Der Auizug des Gefolges entfaltet sich viel bescheidener. Das Kamel mit
dem Schirm ist klein, der Troß unauffälliger. Die stärkste Abweichung zeigt der rechte Rand: da eilt ein kleines Pferd
in flottem Trab nach rechts über den Pfeiler des rahmenden Torbogens hinaus — an Stelle der Zusammenfassung, Vertiefung
noch Auseinanderstreben, nichtorganisierte Vielfalt, die Zeichnung selbst ist auch noch nicht gefüllt, bewußt bis in alle Teile,
sondern noch ein Versuchen. In der Mitte ein wirres, dunkles Gemenge (Deckweiß ist reichlich für Korrekturen verwendet);
gegen die Ränder und Ecken zu wird es oft leer; das linke obere Viertel ist überhaupt noch ungelöst. Der Duktus zeigt reich-
liche Kurven, so wie die erste der Civiliszeichnungen (HdG. 411); dunkle Strichlagen überschummern sie, suchen Raum und
Tiefe hineinzubringen. Ursprünglich hat Rembrandt die Anbetungsgruppe im Gegensinn konzipiert; das sehen wir auf der
Rückseite, wo die Madonna und der knieende König in knappen Umrissen notiert sind. Die Zeichnung steht schwarzbraun
auf bräunlichgrauem Papier. Mit der violettbraunen Tinte des falschen Signums ist auch der äußerste Rand nachgezogen.
In dem nächstfolgenden Entwurf HdG. 380 hat Rembrandt mit einem Schlag die ganze farbige Pracht der Bild-
idee zeichnerisch erfaßt. Das Blatt fluoresziert. Es ist mit ganz breiter Rohrfeder gezeichnet, die zuweilen ausläßt und
auf dem Papier spröde Strahlen zieht, der Zeichnung so im höchsten Grade jenen Ausdruck des ständigen Durchwogt-
seins von inneren Kräften, des Flüssigen bei aller monumentalen Größe der Form, des farbigen Vibrierens bei aller Ruhe
und Feierlichkeit der Erscheinung verleihend. Zeichnung und leerer Grund steigern sich gegenseitig wie im spätantiken
Tiefendunkel. Eine magische Schwingungskraft, das Resultat unzähliger Wechselströme, strahlt aus dem Blatte. Es glüht
und leuchtet vor Farbe in seiner Monochromie. Wie schwer und wuchtig schichten sich die Parallelen zum rahmenden
Bogen, wie schießen sie kurvig dahin in dem Halmdach der Strohhütte, wie rührt sich die dichtgedrängte Menschen-
gruppe vor innerem Leben, wie groß und suggestiv erhebt sich als Abschluß gegen den Grund die Silhouette des
Rembrandt, Die Anbetung der Magier. München, Inv.-Nr. 1426 (204 : 196 mm).
37
■m
«■■■■■■■
auch
e, das
er nur
en ist,
egung
auch durch Jahre getrennten
Blätter zu einer eigenen
Gruppe zusammenschließt.
Diesen Stil hat Rembrandt
aus dem der»Gliederpuppen«
der ersten Hälfte und Mitte
der fünfziger Jahre heraus
gestaltet. Aus einigen Zügen
undDrückern ersteht in Kurz-
schrift eine Gestalt, eine Ge-
staltengruppe, geladen von
suggestiver Spannkraft. Na-
türlich macht sich der allge-
meine Stilwandel Rembrandts
auch rein zeichnerisch inner-
halb dieser Kompositions-
skizzen geltend, doch sind
die Schwingungen feiner und
schwieriger ihre Erkenntnis.
Die Tatsache der drei
Entwürfe, von denen keiner
dem Bilde in allen Details
wortwörtlich entspricht,
macht diesen Fall zu einem
ähnlich wichtigen für die
Erkenntnis von Rembrandts
künstlerischem Gedanken-
gang wie den Julius Civilis.
Wie beim Civilis können wir
im vorhinein annehmen, daß
die vom Bilde am weitesten
entfernte Fassung die erste
ist. Das ist Inv. 1626. Der
Bildraum ist nicht zu einem
Rechteck überhöht, sondern quadratisch, die ganze Szene somit noch breit, gedrückt, auseinandergezogen, noch nichts von
dem feierlichen, ruhigen Höhenstreben zeigend, das sie später bekam. Die Hauptgruppe erscheint wohl bereits so ziemlich
in der Endfassung, doch auch da sind starke Abweichungen: Die beiden knieenden Diener des alten Königs rücken stärker
von ihm ab, der stehende ist anders postiert. Der Auizug des Gefolges entfaltet sich viel bescheidener. Das Kamel mit
dem Schirm ist klein, der Troß unauffälliger. Die stärkste Abweichung zeigt der rechte Rand: da eilt ein kleines Pferd
in flottem Trab nach rechts über den Pfeiler des rahmenden Torbogens hinaus — an Stelle der Zusammenfassung, Vertiefung
noch Auseinanderstreben, nichtorganisierte Vielfalt, die Zeichnung selbst ist auch noch nicht gefüllt, bewußt bis in alle Teile,
sondern noch ein Versuchen. In der Mitte ein wirres, dunkles Gemenge (Deckweiß ist reichlich für Korrekturen verwendet);
gegen die Ränder und Ecken zu wird es oft leer; das linke obere Viertel ist überhaupt noch ungelöst. Der Duktus zeigt reich-
liche Kurven, so wie die erste der Civiliszeichnungen (HdG. 411); dunkle Strichlagen überschummern sie, suchen Raum und
Tiefe hineinzubringen. Ursprünglich hat Rembrandt die Anbetungsgruppe im Gegensinn konzipiert; das sehen wir auf der
Rückseite, wo die Madonna und der knieende König in knappen Umrissen notiert sind. Die Zeichnung steht schwarzbraun
auf bräunlichgrauem Papier. Mit der violettbraunen Tinte des falschen Signums ist auch der äußerste Rand nachgezogen.
In dem nächstfolgenden Entwurf HdG. 380 hat Rembrandt mit einem Schlag die ganze farbige Pracht der Bild-
idee zeichnerisch erfaßt. Das Blatt fluoresziert. Es ist mit ganz breiter Rohrfeder gezeichnet, die zuweilen ausläßt und
auf dem Papier spröde Strahlen zieht, der Zeichnung so im höchsten Grade jenen Ausdruck des ständigen Durchwogt-
seins von inneren Kräften, des Flüssigen bei aller monumentalen Größe der Form, des farbigen Vibrierens bei aller Ruhe
und Feierlichkeit der Erscheinung verleihend. Zeichnung und leerer Grund steigern sich gegenseitig wie im spätantiken
Tiefendunkel. Eine magische Schwingungskraft, das Resultat unzähliger Wechselströme, strahlt aus dem Blatte. Es glüht
und leuchtet vor Farbe in seiner Monochromie. Wie schwer und wuchtig schichten sich die Parallelen zum rahmenden
Bogen, wie schießen sie kurvig dahin in dem Halmdach der Strohhütte, wie rührt sich die dichtgedrängte Menschen-
gruppe vor innerem Leben, wie groß und suggestiv erhebt sich als Abschluß gegen den Grund die Silhouette des
Rembrandt, Die Anbetung der Magier. München, Inv.-Nr. 1426 (204 : 196 mm).
37