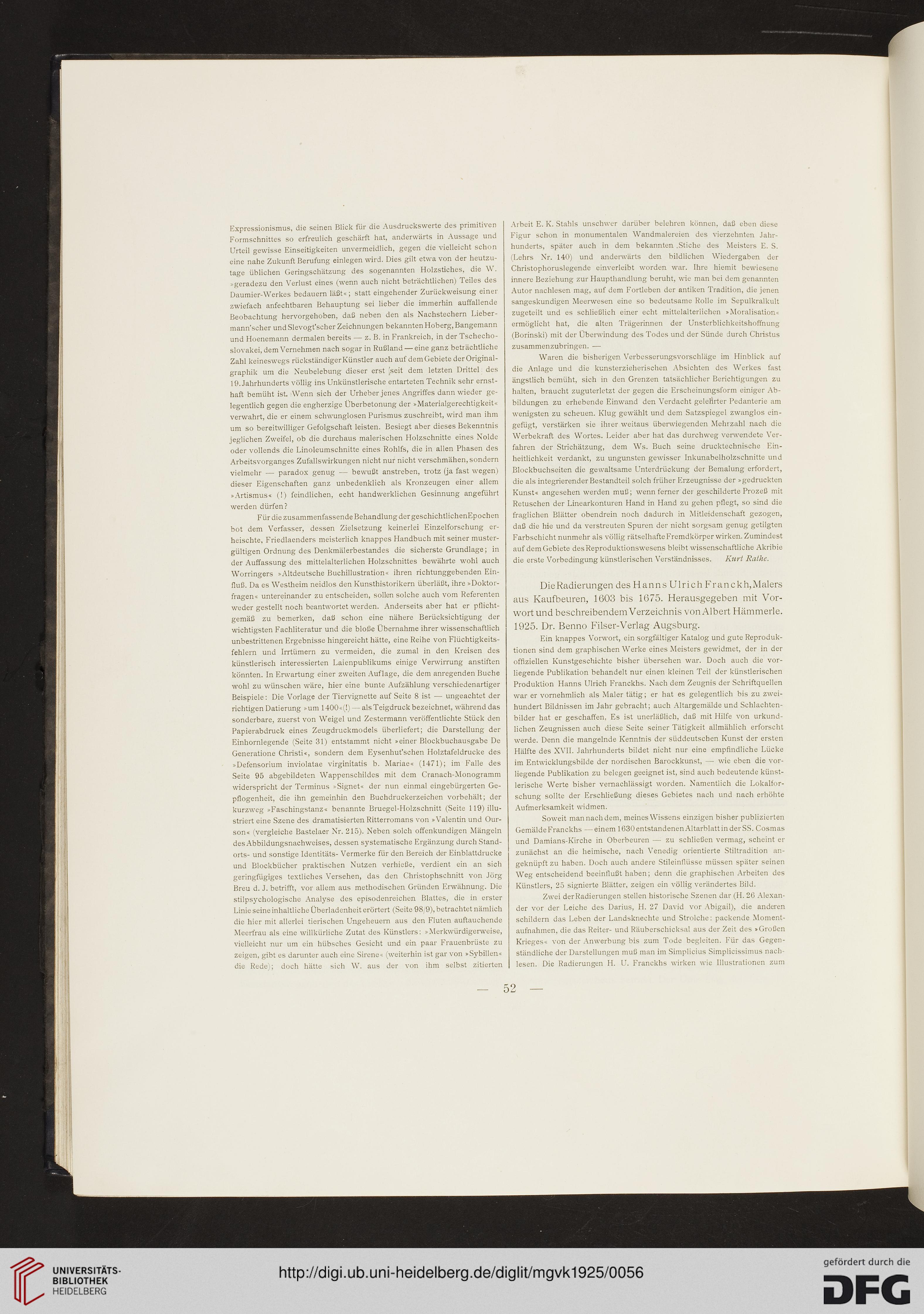Expressionismus, die seinen Blick für die Ausdruckswerte des primitiven
Formschnittes so erfreulich geschärft hat, anderwärts in Aussage und
Urteil gewisse Einseitigkeiten unvermeidlich, gegen die vielleicht schon
eine nahe Zukunft Berufung einlegen wird. Dies gilt etwa von der heutzu-
tage üblichen Geringschätzung des sogenannten Holzstiches, die W.
»geradezu den Verlust eines (wenn auch nicht beträchtlichen) Teiles des
Daumier-Werkes bedauern läßt«; statt eingehender Zurückweisung einer
zwiefach anfechtbaren Behauptung sei lieber die immerhin auffallende
Beobachtung hervorgehoben, daß neben den als Nachstechern Lieber-
mann'scher und Slevogt'scher Zeichnungen bekannten Hoberg, Bangemann
und Hoenemann dermalen bereits — z. B. in Frankreich, in der Tschecho-
slovakei, dem Vernehmen nach sogar in Rußland — eine ganz beträchtliche
Zahl keineswegs rückständiger Künstler auch auf dem Gebiete der Original-
graphik um die Neubelebung dieser erst Jseit dem letzten Drittel des
19. Jahrhunderts völlig ins Unkünstlerische entarteten Technik sehr ernst-
haft bemüht ist. Wenn sich der Urheber jenes Angriffes dann wieder ge-
legentlich gegen die engherzige Überbetonung der »Materialgerechtigkeit«
verwahrt, die er einem schwunglosen Purismus zuschreibt, wird man ihm
um so bereitwilliger Gefolgschaft leisten. Besiegt aber dieses Bekenntnis
jeglichen Zweifel, ob die durchaus malerischen Holzschnitte eines Noldc
oder vollends die Linoleumschnitte eines Rohlfs, die in allen Phasen des
Arbeitsvorganges Zufallswirkungen nicht nur nicht verschmähen, sondern
vielmehr — paradox genug — bewußt anstreben, trotz (ja fast wegen)
dieser Eigenschaften ganz unbedenklich als Kronzeugen einer allem
»Artismus« (!) feindlichen, echt handwerklichen Gesinnung angeführt
werden dürfen?
Für die zusammenfassende Behandlung der geschichtlichenEpochen
bot dem Verfasser, dessen Zielsetzung keinerlei Einzelforschung er-
heischte, Friedlaenders meisterlich knappes Handbuch mit seiner muster-
gültigen Ordnung des Denkmälerbestandes die sicherste Grundlage; in
der Auffassung des mittelalterlichen Holzschnittes bewährte wohl auch
Worringers »Altdeutsche Buchillustration« ihren richtunggebenden Ein-
fluß. Da es Westheim neidlos den Kunsthistorikern überläßt, ihre »Doktor-
fragen« untereinander zu entscheiden, sollen solche auch vom Referenten
weder gestellt noch beantwortet werden. Anderseits aber hat er pflicht-
gemäß zu bemerken, daß schon eine nähere Berücksichtigung der
wichtigsten Fachliteratur und die bloße Übernahme ihrer wissenschaftlich
unbestrittenen Ergebnisse hingereicht hätte, eine Reihe von Flüchtigkeits-
fehlern und Irrtümern zu vermeiden, die zumal in den Kreisen des
künstlerisch interessierten Laienpublikums einige Verwirrung anstiften
könnten. In Erwartung einer zweiten Auflage, die dem anregenden Buche
wohl zu wünschen wäre, hier eine bunte Aufzählung verschiedenartiger
Beispiele: Die Vorlage der Tiervignette auf Seite 8 ist — ungeachtet der
richtigen Datierung »um 1400«(!)— als Teigdruck bezeichnet, während das
sonderbare, zuerst von Weigel und Zestermann veröffentlichte Stück den
Papierabdruck eines Zeugdruckmodels überliefert; die Darstellung der
Einhornlegende (Seite 31) entstammt nicht »einer Blockbuchausgabe De
Generatione Christi«, sondern dem Eysenhut'schen Holztafeldrucke des
»Defensorium inviolatae virginitatis b. Mariae« (1471); im Falle des
Seite 95 abgebildeten Wappenschildes mit dem Cranach-Monogramm
widerspricht der Terminus »Signet« der nun einmal eingebürgerten Ge-
pflogenheit, die ihn gemeinhin den Buchdruckerzeichen vorbehält; der
kurzweg »Faschingstanz« benannte Bruegel-Holzschnitt (Seite 119) illu-
striert eine Szene des dramatisierten Ritterromans von »Valentin und Our-
son« (vergleiche Bastelaer Nr. 215). Neben solch offenkundigen Mängeln
des Abbildungsnachweises, dessen systematische Ergänzung durch Stand-
orts- und sonstige Identitäts- Vermerke für den Bereich der Einblattdrucke
und Blockbücher praktischen Nutzen verhieße, verdient ein an sich
geringfügiges textliches Versehen, das den Christophschnitt von Jörg
Breu d. J. betrifft, vor allem aus methodischen Gründen Erwähnung. Die
stilpsychologische Analyse des episodenreichen Blattes, die in erster
Linie seine inhaltliche Überladenheit erörtert (Seite 98/9), betrachtet nämlich
die hier mit allerlei tierischen Ungeheuern aus den Fluten auftauchende
Meerfrau als eine willkürliche Zutat des Künstlers: »Merkwürdigerweise,
vielleicht nur um ein hübsches Gesicht und ein. paar Frauenbrüste zu
zeigen, gibt es darunter auch eine Sirene« (weiterhin ist gar von »Sybillen«
die Rede); doch hätte sich W. aus der von ihm selbst zitierten
Arbeit E. K. Stahls unschwer darüber belehren können, daß eben diese
Figur schon in monumentalen Wandmalereien des vierzehnten Jahr-
hunderts, später auch in dem bekannten .Stiche des Meisters E. S.
(Lehrs Nr. 140) und anderwärts den bildlichen Wiedergaben der
Christophoruslegende einverleibt worden war. Ihre hiemit bewiesene
innere Beziehung zur Haupthandlung beruht, wie man bei dem genannten
Autor nachlesen mag, auf dem Fortleben der antiken Tradition, die jenen
sangeskundigen Meerwesen eine so bedeutsame Rolle im Sepulkralkult
zugeteilt und es schließlich einer echt mittelalterlichen »Moralisation«
ermöglicht hat, die alten Trägerinnen der Unsterblichkeitshoffnung
(Borinski) mit der Überwindung des Todes und der Sünde durch Christus
zusammenzubringen. —
Waren die bisherigen Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf
die Anlage und die kunsterzieherischen Absichten des Werkes fast
ängstlich bemüht, sich in den Grenzen tatsächlicher Berichtigungen zu
halten, braucht zuguterletzt der gegen die Erscheinungsform einiger Ab-
bildungen zu erhebende Einwand den Verdacht gelehrter Pedanterie am
wenigsten zu scheuen. Klug gewählt und dem Satzspiegel zwanglos ein-
gefügt, verstärken sie ihier weitaus überwiegenden Mehrzahl nach die
Werbekraft des Wortes. Leider aber hat das durchweg verwendete Ver-
fahren der Strichätzung, dem Ws. Buch seine drucktechnische Ein-
heitlichkeit verdankt, zu Ungunsten gewisser Inkunabelholzschnitte und
Blockbuchseiten die gewaltsame Unterdrückung der Bemalung erfordert,
die als integrierender Bestandteil solch früher Erzeugnisse der »gedruckten
Kunst« angesehen werden muß; wenn ferner der geschilderte Prozeß mit
Retuschen der Linearkonturen Hand in Hand zu gehen pflegt, so sind die
fraglichen Blätter obendrein noch dadurch in Mitleidenschaft gezogen,
daß die hie und da verstreuten Spuren der nicht sorgsam genug getilgten
Farbschicht nunmehr als völlig rätselhafte Fremdkörper wirken. Zumindest
auf dem Gebiete desReproduktionswesens bleibt wissenschaftliche Akribie
die erste Vorbedingung künstlerischen Verständnisses. Kurt Eathe.
Die Radierungen des H a n n s U1 r i c h F r a n c k h, Malers
aus Kaufbeuren, 1603 bis 1675. Herausgegeben mit Vor-
wort und beschreibendem Verzeichnis von Albert Hämmerle.
1925. Dr. Benno Filser-Verlag Augsburg.
Ein knappes Vorwort, ein sorgfältiger Katalog und gute Reproduk-
tionen sind dem graphischen Werke eines Meisters gewidmet, der in der
offiziellen Kunstgeschichte bisher übersehen war. Doch auch die vor-
liegende Publikation behandelt nur einen kleinen Teil der künstlerischen
Produktion Hanns Ulrich Franckhs. Nach dem Zeugnis der Schriftquellen
war er vornehmlich als Maler tätig; er hat es gelegentlich bis zu zwei-
hundert Bildnissen im Jahr gebracht; auch Altargemälde und Schlachten-
bilder hat er geschaffen. Es ist unerläßlich, daß mit Hilfe von urkund-
lichen Zeugnissen auch diese Seite seiner Tätigkeit allmählich erforscht
werde. Denn die mangelnde Kenntnis der süddeutschen Kunst der ersten
Hälfte des XVII. Jahrhunderts bildet nicht nur eine empfindliche Lücke
im Entwicklungsbilde der nordischen Barockkunst, — wie eben die vor-
liegende Publikation zu belegen geeignet ist, sind auch bedeutende künst-
lerische Werte bisher vernachlässigt worden. Namentlich die Lokalfor-
schung sollte der Erschließung dieses Gebietes nach und nach erhöhte
Aufmerksamkeit widmen.
Soweit man nach dem, meines Wissens einzigen bisher publizierten
GemäldeFranckhs —einem 1630entstandenenAltarblattinderSS. Cosmas
und Damians-Kirche in Oberbeuren — zu schließen vermag, scheint er
zunächst an die heimische, nach Venedig orientierte Stiltradition an-
geknüpft zu haben. Doch auch andere Stileinflüsse müssen später seinen
Weg entscheidend beeinflußt haben; denn die graphischen Arbeiten des
Künstlers, 25 signierte Blätter, zeigen ein völlig verändertes Bild.
Zwei derRadierungen stellen historische Szenen dar (H. 26 Alexan-
der vor der Leiche des Darius, H. 27 David vor Abigail), die anderen
schildern das Leben der Landsknechte und Strolche: packende Moment-
aufnahmen, die das Reiter- und Räuberschicksal aus der Zeit des »Großen
Krieges« von der Anwerbung bis zum Tode begleiten. Für das Gegen-
ständliche der Darstellungen muß man im Simplicius Simplicissimus nach-
lesen. Die Radierungen H. U. Franckhs wirken wie Illustrationen zum
52
Formschnittes so erfreulich geschärft hat, anderwärts in Aussage und
Urteil gewisse Einseitigkeiten unvermeidlich, gegen die vielleicht schon
eine nahe Zukunft Berufung einlegen wird. Dies gilt etwa von der heutzu-
tage üblichen Geringschätzung des sogenannten Holzstiches, die W.
»geradezu den Verlust eines (wenn auch nicht beträchtlichen) Teiles des
Daumier-Werkes bedauern läßt«; statt eingehender Zurückweisung einer
zwiefach anfechtbaren Behauptung sei lieber die immerhin auffallende
Beobachtung hervorgehoben, daß neben den als Nachstechern Lieber-
mann'scher und Slevogt'scher Zeichnungen bekannten Hoberg, Bangemann
und Hoenemann dermalen bereits — z. B. in Frankreich, in der Tschecho-
slovakei, dem Vernehmen nach sogar in Rußland — eine ganz beträchtliche
Zahl keineswegs rückständiger Künstler auch auf dem Gebiete der Original-
graphik um die Neubelebung dieser erst Jseit dem letzten Drittel des
19. Jahrhunderts völlig ins Unkünstlerische entarteten Technik sehr ernst-
haft bemüht ist. Wenn sich der Urheber jenes Angriffes dann wieder ge-
legentlich gegen die engherzige Überbetonung der »Materialgerechtigkeit«
verwahrt, die er einem schwunglosen Purismus zuschreibt, wird man ihm
um so bereitwilliger Gefolgschaft leisten. Besiegt aber dieses Bekenntnis
jeglichen Zweifel, ob die durchaus malerischen Holzschnitte eines Noldc
oder vollends die Linoleumschnitte eines Rohlfs, die in allen Phasen des
Arbeitsvorganges Zufallswirkungen nicht nur nicht verschmähen, sondern
vielmehr — paradox genug — bewußt anstreben, trotz (ja fast wegen)
dieser Eigenschaften ganz unbedenklich als Kronzeugen einer allem
»Artismus« (!) feindlichen, echt handwerklichen Gesinnung angeführt
werden dürfen?
Für die zusammenfassende Behandlung der geschichtlichenEpochen
bot dem Verfasser, dessen Zielsetzung keinerlei Einzelforschung er-
heischte, Friedlaenders meisterlich knappes Handbuch mit seiner muster-
gültigen Ordnung des Denkmälerbestandes die sicherste Grundlage; in
der Auffassung des mittelalterlichen Holzschnittes bewährte wohl auch
Worringers »Altdeutsche Buchillustration« ihren richtunggebenden Ein-
fluß. Da es Westheim neidlos den Kunsthistorikern überläßt, ihre »Doktor-
fragen« untereinander zu entscheiden, sollen solche auch vom Referenten
weder gestellt noch beantwortet werden. Anderseits aber hat er pflicht-
gemäß zu bemerken, daß schon eine nähere Berücksichtigung der
wichtigsten Fachliteratur und die bloße Übernahme ihrer wissenschaftlich
unbestrittenen Ergebnisse hingereicht hätte, eine Reihe von Flüchtigkeits-
fehlern und Irrtümern zu vermeiden, die zumal in den Kreisen des
künstlerisch interessierten Laienpublikums einige Verwirrung anstiften
könnten. In Erwartung einer zweiten Auflage, die dem anregenden Buche
wohl zu wünschen wäre, hier eine bunte Aufzählung verschiedenartiger
Beispiele: Die Vorlage der Tiervignette auf Seite 8 ist — ungeachtet der
richtigen Datierung »um 1400«(!)— als Teigdruck bezeichnet, während das
sonderbare, zuerst von Weigel und Zestermann veröffentlichte Stück den
Papierabdruck eines Zeugdruckmodels überliefert; die Darstellung der
Einhornlegende (Seite 31) entstammt nicht »einer Blockbuchausgabe De
Generatione Christi«, sondern dem Eysenhut'schen Holztafeldrucke des
»Defensorium inviolatae virginitatis b. Mariae« (1471); im Falle des
Seite 95 abgebildeten Wappenschildes mit dem Cranach-Monogramm
widerspricht der Terminus »Signet« der nun einmal eingebürgerten Ge-
pflogenheit, die ihn gemeinhin den Buchdruckerzeichen vorbehält; der
kurzweg »Faschingstanz« benannte Bruegel-Holzschnitt (Seite 119) illu-
striert eine Szene des dramatisierten Ritterromans von »Valentin und Our-
son« (vergleiche Bastelaer Nr. 215). Neben solch offenkundigen Mängeln
des Abbildungsnachweises, dessen systematische Ergänzung durch Stand-
orts- und sonstige Identitäts- Vermerke für den Bereich der Einblattdrucke
und Blockbücher praktischen Nutzen verhieße, verdient ein an sich
geringfügiges textliches Versehen, das den Christophschnitt von Jörg
Breu d. J. betrifft, vor allem aus methodischen Gründen Erwähnung. Die
stilpsychologische Analyse des episodenreichen Blattes, die in erster
Linie seine inhaltliche Überladenheit erörtert (Seite 98/9), betrachtet nämlich
die hier mit allerlei tierischen Ungeheuern aus den Fluten auftauchende
Meerfrau als eine willkürliche Zutat des Künstlers: »Merkwürdigerweise,
vielleicht nur um ein hübsches Gesicht und ein. paar Frauenbrüste zu
zeigen, gibt es darunter auch eine Sirene« (weiterhin ist gar von »Sybillen«
die Rede); doch hätte sich W. aus der von ihm selbst zitierten
Arbeit E. K. Stahls unschwer darüber belehren können, daß eben diese
Figur schon in monumentalen Wandmalereien des vierzehnten Jahr-
hunderts, später auch in dem bekannten .Stiche des Meisters E. S.
(Lehrs Nr. 140) und anderwärts den bildlichen Wiedergaben der
Christophoruslegende einverleibt worden war. Ihre hiemit bewiesene
innere Beziehung zur Haupthandlung beruht, wie man bei dem genannten
Autor nachlesen mag, auf dem Fortleben der antiken Tradition, die jenen
sangeskundigen Meerwesen eine so bedeutsame Rolle im Sepulkralkult
zugeteilt und es schließlich einer echt mittelalterlichen »Moralisation«
ermöglicht hat, die alten Trägerinnen der Unsterblichkeitshoffnung
(Borinski) mit der Überwindung des Todes und der Sünde durch Christus
zusammenzubringen. —
Waren die bisherigen Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf
die Anlage und die kunsterzieherischen Absichten des Werkes fast
ängstlich bemüht, sich in den Grenzen tatsächlicher Berichtigungen zu
halten, braucht zuguterletzt der gegen die Erscheinungsform einiger Ab-
bildungen zu erhebende Einwand den Verdacht gelehrter Pedanterie am
wenigsten zu scheuen. Klug gewählt und dem Satzspiegel zwanglos ein-
gefügt, verstärken sie ihier weitaus überwiegenden Mehrzahl nach die
Werbekraft des Wortes. Leider aber hat das durchweg verwendete Ver-
fahren der Strichätzung, dem Ws. Buch seine drucktechnische Ein-
heitlichkeit verdankt, zu Ungunsten gewisser Inkunabelholzschnitte und
Blockbuchseiten die gewaltsame Unterdrückung der Bemalung erfordert,
die als integrierender Bestandteil solch früher Erzeugnisse der »gedruckten
Kunst« angesehen werden muß; wenn ferner der geschilderte Prozeß mit
Retuschen der Linearkonturen Hand in Hand zu gehen pflegt, so sind die
fraglichen Blätter obendrein noch dadurch in Mitleidenschaft gezogen,
daß die hie und da verstreuten Spuren der nicht sorgsam genug getilgten
Farbschicht nunmehr als völlig rätselhafte Fremdkörper wirken. Zumindest
auf dem Gebiete desReproduktionswesens bleibt wissenschaftliche Akribie
die erste Vorbedingung künstlerischen Verständnisses. Kurt Eathe.
Die Radierungen des H a n n s U1 r i c h F r a n c k h, Malers
aus Kaufbeuren, 1603 bis 1675. Herausgegeben mit Vor-
wort und beschreibendem Verzeichnis von Albert Hämmerle.
1925. Dr. Benno Filser-Verlag Augsburg.
Ein knappes Vorwort, ein sorgfältiger Katalog und gute Reproduk-
tionen sind dem graphischen Werke eines Meisters gewidmet, der in der
offiziellen Kunstgeschichte bisher übersehen war. Doch auch die vor-
liegende Publikation behandelt nur einen kleinen Teil der künstlerischen
Produktion Hanns Ulrich Franckhs. Nach dem Zeugnis der Schriftquellen
war er vornehmlich als Maler tätig; er hat es gelegentlich bis zu zwei-
hundert Bildnissen im Jahr gebracht; auch Altargemälde und Schlachten-
bilder hat er geschaffen. Es ist unerläßlich, daß mit Hilfe von urkund-
lichen Zeugnissen auch diese Seite seiner Tätigkeit allmählich erforscht
werde. Denn die mangelnde Kenntnis der süddeutschen Kunst der ersten
Hälfte des XVII. Jahrhunderts bildet nicht nur eine empfindliche Lücke
im Entwicklungsbilde der nordischen Barockkunst, — wie eben die vor-
liegende Publikation zu belegen geeignet ist, sind auch bedeutende künst-
lerische Werte bisher vernachlässigt worden. Namentlich die Lokalfor-
schung sollte der Erschließung dieses Gebietes nach und nach erhöhte
Aufmerksamkeit widmen.
Soweit man nach dem, meines Wissens einzigen bisher publizierten
GemäldeFranckhs —einem 1630entstandenenAltarblattinderSS. Cosmas
und Damians-Kirche in Oberbeuren — zu schließen vermag, scheint er
zunächst an die heimische, nach Venedig orientierte Stiltradition an-
geknüpft zu haben. Doch auch andere Stileinflüsse müssen später seinen
Weg entscheidend beeinflußt haben; denn die graphischen Arbeiten des
Künstlers, 25 signierte Blätter, zeigen ein völlig verändertes Bild.
Zwei derRadierungen stellen historische Szenen dar (H. 26 Alexan-
der vor der Leiche des Darius, H. 27 David vor Abigail), die anderen
schildern das Leben der Landsknechte und Strolche: packende Moment-
aufnahmen, die das Reiter- und Räuberschicksal aus der Zeit des »Großen
Krieges« von der Anwerbung bis zum Tode begleiten. Für das Gegen-
ständliche der Darstellungen muß man im Simplicius Simplicissimus nach-
lesen. Die Radierungen H. U. Franckhs wirken wie Illustrationen zum
52