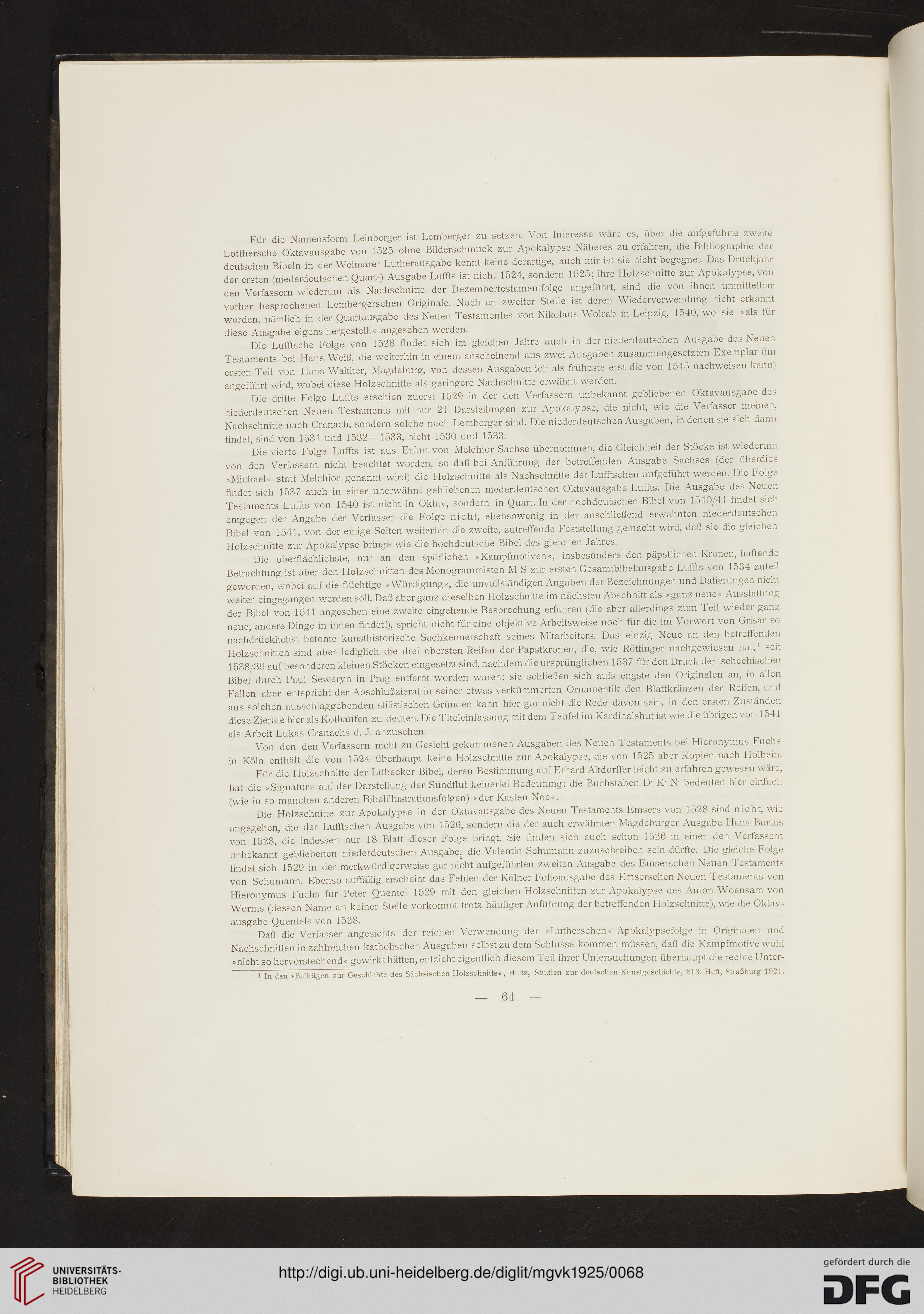Für die Namensform Leinberger ist Lemberger zu setzen. Von Interesse wäre es, über die aufgeführte zweite
Lotthersche Oktavausgabe von 1525 ohne Bilderschmuck zur Apokalypse Näheres zu erfahren, die Bibliographie der
deutschen Bibeln in der Weimarer Lutherausgabe kennt keine derartige, auch mir ist sie nicht begegnet. Das Druckjahr
der ersten (niederdeutschen Quart-) Ausgabe Luffts ist nicht 1524, sondern 1525; ihre Holzschnitte zur Apokalypse, von
den Verfassern wiederum als Nachschnitte der Dezembertestamentfolge angeführt, sind die von ihnen unmittelbar
vorher besprochenen Lembergerschen Originale. Noch an zweiter Stelle ist deren Wiederverwendung nicht erkannt
worden, nämlich in der Quartausgabe des Neuen Testamentes von Nikolaus Wolrab in Leipzig, 1540, wo sie »als für
diese Ausgabe eigens hergestellt« angesehen werden.
Die Lufftsche Folge von 1526 findet sich im gleichen Jahre auch in der niederdeutschen Ausgabe des Neuen
Testaments bei Hans Weiß, die weiterhin in einem anscheinend aus zwei Ausgaben zusammengesetzten Exemplar (im
ersten Teil von Hans Walther, Magdeburg, von dessen Ausgaben ich als früheste erst die von 1545 nachweisen kann)
angeführt wird, wobei diese Holzschnitte als geringere Nachschnitte erwähnt werden.
Die dritte Folge Luffts erschien zuerst 1529 in der den Verfassern unbekannt gebliebenen Oktavausgabe des
niederdeutschen Neuen Testaments mit nur 21 Darstellungen zur Apokalypse, die nicht, wie die Verfasser meinen,
Nachschnitte nach Cranach, sondern solche nach Lemberger sind. Die niederdeutschen Ausgaben, in denen sie sich dann
findet, sind von 1531 und 1532—1533, nicht 1530 und 1533.
Die vierte Folge Luffts ist aus Erfurt von Melchior Sachse übernommen, die Gleichheit der Stöcke ist wiederum
von den Verfassern nicht beachtet worden, so daß bei Anführung der betreffenden Ausgabe Sachses (der überdies
»Michael« statt Melchior genannt wird) die Holzschnitte als Nachschnitte der Lufftschen aufgeführt werden. Die Folge
findet sich 1537 auch in einer unerwähnt gebliebenen niederdeutschen Oktavausgabe Luffts. Die Ausgabe des Neuen
Testaments Luffts von 1540 ist nicht in Oktav, sondern in Quart. In der hochdeutschen Bibel von 1540/41 findet sich
entgegen der Angabe der Verfasser die Folge nicht, ebensowenig in der anschließend erwähnten niederdeutschen
Bibel von 1541, von der einige Seiten weiterhin die zweite, zutreffende Feststellung gemacht wird, daß sie die gleichen
Holzschnitte zur Apokalypse bringe wie die hochdeutsche Bibel des gleichen Jahres.
Die oberflächlichste, nur an den spärlichen »Kampfmotiven«, insbesondere den päpstlichen Kronen, haftende
Betrachtung ist aber den Holzschnitten des Monogrammisten M S zur ersten Gesamtbibelausgabe Luffts von 1534 zuteil
geworden, wobei auf die flüchtige »Würdigung«, die unvollständigen Angaben der Bezeichnungen und Datierungen nicht
weiter eingegangen werden soll. Daß aber ganz dieselben Holzschnitte im nächsten Abschnitt als »ganz neue« Ausstattung
der Bibel von 1541 angesehen eine zweite eingehende Besprechung erfahren (die aber allerdings zum Teil wieder ganz
neue, andere Dinge in ihnen findet!), spricht nicht für eine objektive Arbeitsweise noch für die im Vorwort von Grisar so
nachdrücklichst betonte kunsthistorische Sachkennerschaft seines Mitarbeiters. Das einzig Neue an den betreffenden
Holzschnitten sind aber lediglich die drei obersten Reifen der Papstkronen, die, wie Röttinger nachgewiesen hat,1 seit
1538/39 auf besonderen kleinen Stöcken eingesetzt sind, nachdem die ursprünglichen 1537 für den Druck der tschechischen
Bibel durch Paul Seweryn in Prag entfernt worden waren: sie schließen sich aufs engste den Originalen an, in allen
Fällen aber entspricht der Abschlußzierat in seiner etwas verkümmerten Ornamentik den Blattkränzen der Reifen, und
aus solchen ausschlaggebenden stilistischen Gründen kann hier gar nicht die Rede davon sein, in den ersten Zuständen
diese Zierate hier als Kothaufen zu deuten. Die Titeleinfassung mit dem Teufel im Kardinalshut ist wie die übrigen von 1541
als Arbeit Lukas Cranachs d. J. anzusehen.
Von den den Verfassern nicht zu Gesicht gekommenen Ausgaben des Neuen Testaments bei Hieronymus Fuchs
in Köln enthält die von 1524 überhaupt keine Holzschnitte zur Apokalypse, die von 1525 aber Kopien nach Holbein.
Für die Holzschnitte der Lübecker Bibel, deren Bestimmung auf Erhard Altdorffer leicht zu erfahren gewesen wäre,
hat die »Signatur« auf der Darstellung der Sündflut keinerlei Bedeutung: die Buchstaben D' Iv N bedeuten hier einfach
(wie in so manchen anderen Bibelillustrationsfolgen) »der Kasten Noe«.
Die Holzschnitte zur Apokalypse in der Oktavausgabe des Neuen Testaments Emsers von 1528 sind nicht, wie
angegeben, die der Lufftschen Ausgabe von 1526, sondern die der auch erwähnten Magdeburger Ausgabe Hans Barths
von 1528, die indessen nur 18 Blatt dieser Folge bringt. Sie finden sich auch schon 1526 in einer den Verfassern
unbekannt gebliebenen niederdeutschen Ausgabe, die Valentin Schumann zuzuschreiben sein dürfte. Die gleiche Folge
findet sich 1529 in der merkwürdigerweise gar nicht aufgeführten zweiten Ausgabe des Emserschen Neuen Testaments
von Schumann. Ebenso auffällig erscheint das Fehlen der Kölner Folioausgabe des Emserschen Neuen Testaments von
Hieronymus Fuchs für Peter Quentel 1529 mit den gleichen Holzschnitten zur Apokalypse des Anton Woensam von
Worms (dessen Name an keiner Stelle vorkommt trotz häufiger Anführung der betreffenden Holzschnitte), wie die Oktav-
ausgabe Quentels von 1528.
Daß die Verfasser angesichts der reichen Verwendung der »Lutherschen« Apokalypsefolge in Originalen und
Nachschnitten in zahlreichen katholischen Ausgaben selbst zu dem Schlüsse kommen müssen, daß die Kampfmotive wohl
»nicht so hervorstechend« gewirkt hätten, entzieht eigentlich diesem Teil ihrer Untersuchungen überhaupt die rechte Unter-
1 In den »Beiträgen zur Geschichte des Sächsischen Holzschnitts<, Heitz, Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 213, Heft, Straßburg 1921.
64
Lotthersche Oktavausgabe von 1525 ohne Bilderschmuck zur Apokalypse Näheres zu erfahren, die Bibliographie der
deutschen Bibeln in der Weimarer Lutherausgabe kennt keine derartige, auch mir ist sie nicht begegnet. Das Druckjahr
der ersten (niederdeutschen Quart-) Ausgabe Luffts ist nicht 1524, sondern 1525; ihre Holzschnitte zur Apokalypse, von
den Verfassern wiederum als Nachschnitte der Dezembertestamentfolge angeführt, sind die von ihnen unmittelbar
vorher besprochenen Lembergerschen Originale. Noch an zweiter Stelle ist deren Wiederverwendung nicht erkannt
worden, nämlich in der Quartausgabe des Neuen Testamentes von Nikolaus Wolrab in Leipzig, 1540, wo sie »als für
diese Ausgabe eigens hergestellt« angesehen werden.
Die Lufftsche Folge von 1526 findet sich im gleichen Jahre auch in der niederdeutschen Ausgabe des Neuen
Testaments bei Hans Weiß, die weiterhin in einem anscheinend aus zwei Ausgaben zusammengesetzten Exemplar (im
ersten Teil von Hans Walther, Magdeburg, von dessen Ausgaben ich als früheste erst die von 1545 nachweisen kann)
angeführt wird, wobei diese Holzschnitte als geringere Nachschnitte erwähnt werden.
Die dritte Folge Luffts erschien zuerst 1529 in der den Verfassern unbekannt gebliebenen Oktavausgabe des
niederdeutschen Neuen Testaments mit nur 21 Darstellungen zur Apokalypse, die nicht, wie die Verfasser meinen,
Nachschnitte nach Cranach, sondern solche nach Lemberger sind. Die niederdeutschen Ausgaben, in denen sie sich dann
findet, sind von 1531 und 1532—1533, nicht 1530 und 1533.
Die vierte Folge Luffts ist aus Erfurt von Melchior Sachse übernommen, die Gleichheit der Stöcke ist wiederum
von den Verfassern nicht beachtet worden, so daß bei Anführung der betreffenden Ausgabe Sachses (der überdies
»Michael« statt Melchior genannt wird) die Holzschnitte als Nachschnitte der Lufftschen aufgeführt werden. Die Folge
findet sich 1537 auch in einer unerwähnt gebliebenen niederdeutschen Oktavausgabe Luffts. Die Ausgabe des Neuen
Testaments Luffts von 1540 ist nicht in Oktav, sondern in Quart. In der hochdeutschen Bibel von 1540/41 findet sich
entgegen der Angabe der Verfasser die Folge nicht, ebensowenig in der anschließend erwähnten niederdeutschen
Bibel von 1541, von der einige Seiten weiterhin die zweite, zutreffende Feststellung gemacht wird, daß sie die gleichen
Holzschnitte zur Apokalypse bringe wie die hochdeutsche Bibel des gleichen Jahres.
Die oberflächlichste, nur an den spärlichen »Kampfmotiven«, insbesondere den päpstlichen Kronen, haftende
Betrachtung ist aber den Holzschnitten des Monogrammisten M S zur ersten Gesamtbibelausgabe Luffts von 1534 zuteil
geworden, wobei auf die flüchtige »Würdigung«, die unvollständigen Angaben der Bezeichnungen und Datierungen nicht
weiter eingegangen werden soll. Daß aber ganz dieselben Holzschnitte im nächsten Abschnitt als »ganz neue« Ausstattung
der Bibel von 1541 angesehen eine zweite eingehende Besprechung erfahren (die aber allerdings zum Teil wieder ganz
neue, andere Dinge in ihnen findet!), spricht nicht für eine objektive Arbeitsweise noch für die im Vorwort von Grisar so
nachdrücklichst betonte kunsthistorische Sachkennerschaft seines Mitarbeiters. Das einzig Neue an den betreffenden
Holzschnitten sind aber lediglich die drei obersten Reifen der Papstkronen, die, wie Röttinger nachgewiesen hat,1 seit
1538/39 auf besonderen kleinen Stöcken eingesetzt sind, nachdem die ursprünglichen 1537 für den Druck der tschechischen
Bibel durch Paul Seweryn in Prag entfernt worden waren: sie schließen sich aufs engste den Originalen an, in allen
Fällen aber entspricht der Abschlußzierat in seiner etwas verkümmerten Ornamentik den Blattkränzen der Reifen, und
aus solchen ausschlaggebenden stilistischen Gründen kann hier gar nicht die Rede davon sein, in den ersten Zuständen
diese Zierate hier als Kothaufen zu deuten. Die Titeleinfassung mit dem Teufel im Kardinalshut ist wie die übrigen von 1541
als Arbeit Lukas Cranachs d. J. anzusehen.
Von den den Verfassern nicht zu Gesicht gekommenen Ausgaben des Neuen Testaments bei Hieronymus Fuchs
in Köln enthält die von 1524 überhaupt keine Holzschnitte zur Apokalypse, die von 1525 aber Kopien nach Holbein.
Für die Holzschnitte der Lübecker Bibel, deren Bestimmung auf Erhard Altdorffer leicht zu erfahren gewesen wäre,
hat die »Signatur« auf der Darstellung der Sündflut keinerlei Bedeutung: die Buchstaben D' Iv N bedeuten hier einfach
(wie in so manchen anderen Bibelillustrationsfolgen) »der Kasten Noe«.
Die Holzschnitte zur Apokalypse in der Oktavausgabe des Neuen Testaments Emsers von 1528 sind nicht, wie
angegeben, die der Lufftschen Ausgabe von 1526, sondern die der auch erwähnten Magdeburger Ausgabe Hans Barths
von 1528, die indessen nur 18 Blatt dieser Folge bringt. Sie finden sich auch schon 1526 in einer den Verfassern
unbekannt gebliebenen niederdeutschen Ausgabe, die Valentin Schumann zuzuschreiben sein dürfte. Die gleiche Folge
findet sich 1529 in der merkwürdigerweise gar nicht aufgeführten zweiten Ausgabe des Emserschen Neuen Testaments
von Schumann. Ebenso auffällig erscheint das Fehlen der Kölner Folioausgabe des Emserschen Neuen Testaments von
Hieronymus Fuchs für Peter Quentel 1529 mit den gleichen Holzschnitten zur Apokalypse des Anton Woensam von
Worms (dessen Name an keiner Stelle vorkommt trotz häufiger Anführung der betreffenden Holzschnitte), wie die Oktav-
ausgabe Quentels von 1528.
Daß die Verfasser angesichts der reichen Verwendung der »Lutherschen« Apokalypsefolge in Originalen und
Nachschnitten in zahlreichen katholischen Ausgaben selbst zu dem Schlüsse kommen müssen, daß die Kampfmotive wohl
»nicht so hervorstechend« gewirkt hätten, entzieht eigentlich diesem Teil ihrer Untersuchungen überhaupt die rechte Unter-
1 In den »Beiträgen zur Geschichte des Sächsischen Holzschnitts<, Heitz, Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 213, Heft, Straßburg 1921.
64