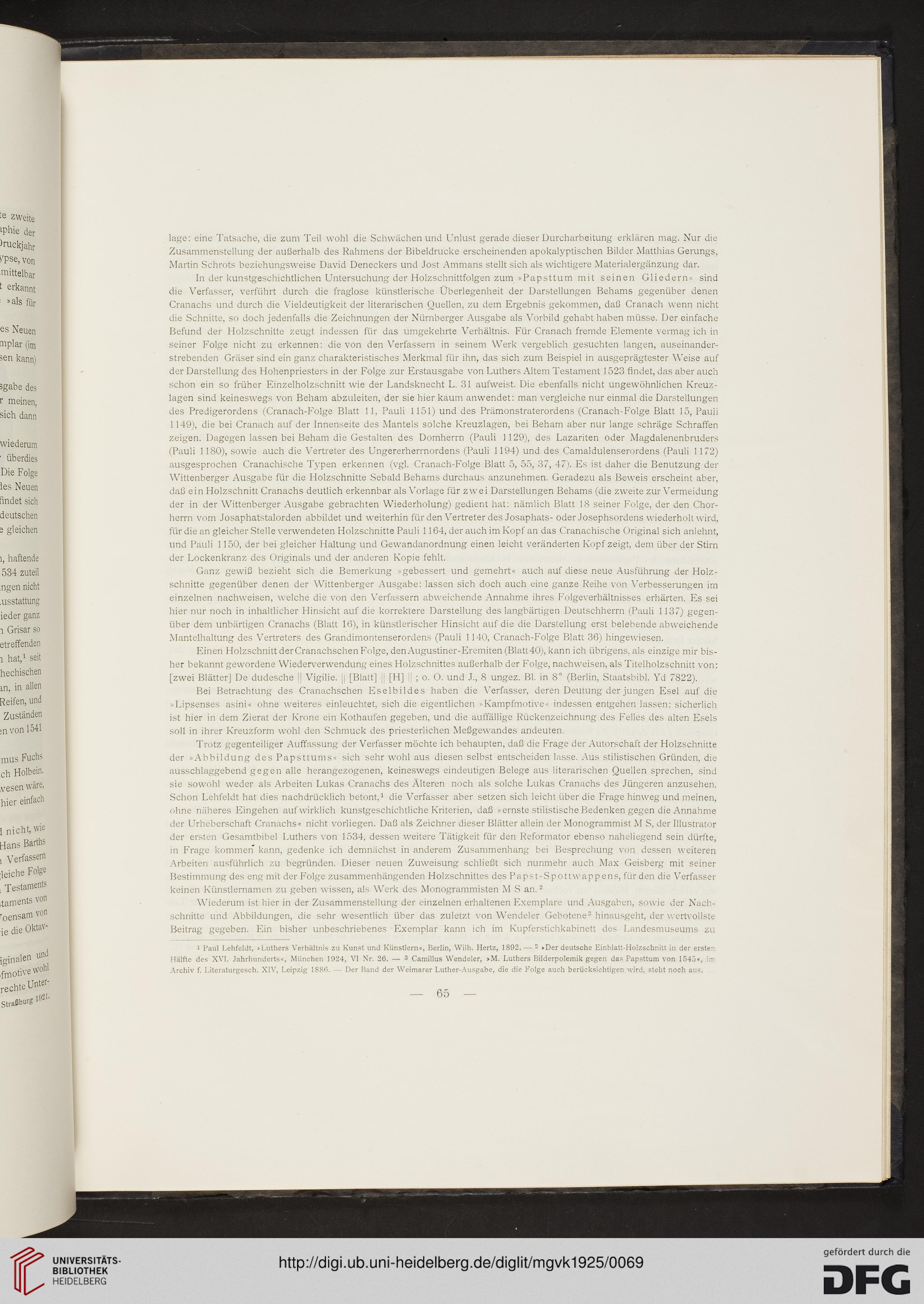■■■■■
läge: eine Tatsache, die zum Teil wohl die Schwächen und Unlust gerade dieser Durcharbeitung erklären mag. Nur die
Zusammenstellung der außerhalb des Rahmens der Bibeldrucke erscheinenden apokalyptischen Bilder Matthias Gerungs,
Martin Schrots beziehungsweise David Deneckers und Jost Ammans stellt sich als wichtigere Materialergänzung dar.
In der kunstgeschichtlichen Untersuchung der Holzschnittfolgen zum »Papsttum mit seinen Gliedern« sind
die Verfasser, verführt durch die fraglose künstlerische Überlegenheit der Darstellungen Behams gegenüber denen
Cranachs und durch die Vieldeutigkeit der literarischen Quellen, zu dem Ergebnis gekommen, daß Cranach wenn nicht
die Schnitte, so doch jedenfalls die Zeichnungen der Nürnberger Ausgabe als Vorbild gehabt haben müsse. Der einfache
Befund der Holzschnitte zeugt indessen für das umgekehrte Verhältnis. Für Cranach fremde Elemente vermag ich in
seiner Folge nicht zu erkennen: die von den Verfassern in seinem Werk vergeblich gesuchten langen, auseinander-
strebenden Gräser sind ein ganz charakteristisches Merkmal für ihn, das sich zum Beispiel in ausgeprägtester Weise auf
der Darstellung des Hohenpriesters in der Folge zur Erstausgabe von Luthers Altem Testament 1523 findet, das aber auch
schon ein so früher Einzelholzschnitt wie der Landsknecht L. 31 aufweist. Die ebenfalls nicht ungewöhnlichen Kreuz-
lagen sind keineswegs von Beham abzuleiten, der sie hier kaum anwendet: man vergleiche nur einmal die Darstellungen
des Predigerordens (Cranach-Folge Blatt 11. Pauli 1151) und des Prämonstraterordens (Cranach-Folge Blatt 15, Pauli
1149), die bei Cranach auf der Innenseite des Mantels solche Kreuzlagen, bei Beham aber nur lange schräge Schraffen
zeigen. Dagegen lassen bei Beham die Gestalten des Domherrn (Pauli 1129), des Lazariten oder Magdalenenbruders
(Pauli 1180), sowie auch die Vertreter des Ungererherrnordens (Pauli 1194) und des Camaldulenserordens (Pauli 1172)
ausgesprochen Cranachische Typen erkennen (vgl. Cranach-Folge Blatt 5, 55, 37, 47). Es ist daher die Benutzung der
Wittenberger Ausgabe für die Holzschnitte Sebald Behams durchaus anzunehmen. Geradezu als Beweis erscheint aber,
daß ein Holzschnitt Cranachs deutlich erkennbar als Vorlage für zwei Darstellungen Behams (die zweite zur Vermeidung
der in der Wittenberger Ausgabe gebrachten Wiederholung) gedient hat: nämlich Blatt 18 seiner Folge, der den Chor-
herrn vom Josaphatstalorden abbildet und weiterhin für den Vertreter des Josaphats- oder Josephsordens wiederholt wird,
für die an gleicher Stelle verwendeten Holzschnitte Pauli 1164, der auch im Kopf an das Cranachische Original sich anlehnt,
und Pauli 1150, der bei gleicher Haltung und Gewandanordnung einen leicht veränderten Kopf zeigt, dem über der Stirn
der Lockenkranz des Originals und der anderen Kopie fehlt.
Ganz gewiß bezieht sich die Bemerkung »gebessert und gemehrt« auch auf diese neue Ausführung der Holz-
schnitte gegenüber denen der Wittenberger Ausgabe: lassen sich doch auch eine ganze Reihe von Verbesserungen im
einzelnen nachweisen, welche die von den Verfassern abweichende Annahme ihres Folgeverhältnisses erhärten. Es sei
hier nur noch in inhaltlicher Hinsicht auf die korrektere Darstellung des langbärtigen Deutschherrn (Pauli 1137) gegen-
über dem unbärtigen Cranachs (Blatt 16), in künstlerischer Hinsicht auf die die Darstellung erst belebende abweichende
Mantelhaltung des Vertreters des Grandimontenserordens (Pauli 1140, Cranach-Folge Blatt 36) hingewiesen.
Einen Holzschnitt der Cranachschen Folge, den Augustiner-Eremiten (Blatt 40), kann ich übrigens, als einzige mir bis-
her bekannt gewordene Wiederverwendung eines Holzschnittes außerhalb der Folge, nachweisen, als Titelholzschnitt von:
[zwei BlätterJ De dudesche [J Vigilie. jj [Blatt] || [H] |l ; o. O. und J., 8 ungez. Bl. in 8° (Berlin, Staatsbibl. Yd 7822).
Bei Betrachtung des Cranachschen Eselbildes haben die Verfasser, deren Deutung der jungen Esel auf die
»Lipsenses asini« ohne weiteres einleuchtet, sich die eigentlichen »Kampfmotive« indessen entgehen lassen: sicherlich
ist hier in dem Zierat der Krone ein Kothaufen gegeben, und die auffällige Rückenzeichnung des Felles des alten Esels
soll in ihrer Kreuzform wohl den Schmuck des priesterlichen Meßgewandes andeuten.
Trotz gegenteiliger Auffassung der Verfasser möchte ich behaupten, daß die Frage der Autorschaft der Holzschnitte
der »Abbildung des Papsttums« sich sehr wohl aus diesen selbst entscheiden lasse. Aus stilistischen Gründen, die
ausschlaggebend gegen alle herangezogenen, keineswegs eindeutigen Belege aus literarischen Quellen sprechen, sind
sie sowohl weder als Arbeiten Lukas Cranachs des Älteren noch als solche Lukas Cranachs des Jüngeren anzusehen.
Schon Lehfeldt hat dies nachdrücklich betont,1 die Verfasser aber setzen sich leicht über die Frage hinweg und meinen,
ohne näheres Eingehen auf wirklich kunstgeschichtliche Kriterien, daß »ernste stilistische Bedenken gegen die Annahme
der Urheberschaft Cranachs« nicht vorliegen. Daß als Zeichner dieser Blätter allein der Monogrammist M S, der Illustrator
der ersten Gesamtbibel Luthers von 1534, dessen weitere Tätigkeit für den Reformator ebenso naheliegend sein dürfte,
in Frage kommen kann, gedenke ich demnächst in anderem Zusammenhang bei Besprechung von dessen weiteren
Arbeiten ausführlich zu begründen. Dieser neuen Zuweisung schließt sich nunmehr auch Max Geisberg mit seiner
Bestimmung des eng mit der Folge zusammenhängenden Holzschnittes des Papst-Spottwappens, für den die Verfasser
keinen Künstlernamen zu geben wissen, als Werk des Monogrammisten M S an. "-
Wiederum ist hier in der Zusammenstellung der einzelnen erhaltenen Exemplare und Ausgaben, sowie der Nach-
schnitte und Abbildungen, die sehr wesentlich über das zuletzt von Wendeler Gebotene3 hinausgeht, der wertvollste
Beitrag gegeben. Ein bisher unbeschriebenes Exemplar kann ich im Kupferstichkabinett des Landesmuseums zu
iginalen un
fmotivevvoW
rechte Unter-
1 Paul Lehfeldt, »Luthers Verhältnis zu Kunst und Künstlern«, Berlin, Wilh. Hertz, 1892. — ~ >Der deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten
Hälfte des XVI. Jahrhunderts«, München 1924, VI Nr. 26. — 3 Camillus Wendeler, >M. Luthers Bilderpolemik gegen das Papsttum von 1545«, irr
Archiv f. Literaturgesch. XIV, Leipzig 1886. — Der Band der Weimarer Luther-Ausgabe, die die Folge auch berücksichtigen wird, steht noch aus.
— 65 —
läge: eine Tatsache, die zum Teil wohl die Schwächen und Unlust gerade dieser Durcharbeitung erklären mag. Nur die
Zusammenstellung der außerhalb des Rahmens der Bibeldrucke erscheinenden apokalyptischen Bilder Matthias Gerungs,
Martin Schrots beziehungsweise David Deneckers und Jost Ammans stellt sich als wichtigere Materialergänzung dar.
In der kunstgeschichtlichen Untersuchung der Holzschnittfolgen zum »Papsttum mit seinen Gliedern« sind
die Verfasser, verführt durch die fraglose künstlerische Überlegenheit der Darstellungen Behams gegenüber denen
Cranachs und durch die Vieldeutigkeit der literarischen Quellen, zu dem Ergebnis gekommen, daß Cranach wenn nicht
die Schnitte, so doch jedenfalls die Zeichnungen der Nürnberger Ausgabe als Vorbild gehabt haben müsse. Der einfache
Befund der Holzschnitte zeugt indessen für das umgekehrte Verhältnis. Für Cranach fremde Elemente vermag ich in
seiner Folge nicht zu erkennen: die von den Verfassern in seinem Werk vergeblich gesuchten langen, auseinander-
strebenden Gräser sind ein ganz charakteristisches Merkmal für ihn, das sich zum Beispiel in ausgeprägtester Weise auf
der Darstellung des Hohenpriesters in der Folge zur Erstausgabe von Luthers Altem Testament 1523 findet, das aber auch
schon ein so früher Einzelholzschnitt wie der Landsknecht L. 31 aufweist. Die ebenfalls nicht ungewöhnlichen Kreuz-
lagen sind keineswegs von Beham abzuleiten, der sie hier kaum anwendet: man vergleiche nur einmal die Darstellungen
des Predigerordens (Cranach-Folge Blatt 11. Pauli 1151) und des Prämonstraterordens (Cranach-Folge Blatt 15, Pauli
1149), die bei Cranach auf der Innenseite des Mantels solche Kreuzlagen, bei Beham aber nur lange schräge Schraffen
zeigen. Dagegen lassen bei Beham die Gestalten des Domherrn (Pauli 1129), des Lazariten oder Magdalenenbruders
(Pauli 1180), sowie auch die Vertreter des Ungererherrnordens (Pauli 1194) und des Camaldulenserordens (Pauli 1172)
ausgesprochen Cranachische Typen erkennen (vgl. Cranach-Folge Blatt 5, 55, 37, 47). Es ist daher die Benutzung der
Wittenberger Ausgabe für die Holzschnitte Sebald Behams durchaus anzunehmen. Geradezu als Beweis erscheint aber,
daß ein Holzschnitt Cranachs deutlich erkennbar als Vorlage für zwei Darstellungen Behams (die zweite zur Vermeidung
der in der Wittenberger Ausgabe gebrachten Wiederholung) gedient hat: nämlich Blatt 18 seiner Folge, der den Chor-
herrn vom Josaphatstalorden abbildet und weiterhin für den Vertreter des Josaphats- oder Josephsordens wiederholt wird,
für die an gleicher Stelle verwendeten Holzschnitte Pauli 1164, der auch im Kopf an das Cranachische Original sich anlehnt,
und Pauli 1150, der bei gleicher Haltung und Gewandanordnung einen leicht veränderten Kopf zeigt, dem über der Stirn
der Lockenkranz des Originals und der anderen Kopie fehlt.
Ganz gewiß bezieht sich die Bemerkung »gebessert und gemehrt« auch auf diese neue Ausführung der Holz-
schnitte gegenüber denen der Wittenberger Ausgabe: lassen sich doch auch eine ganze Reihe von Verbesserungen im
einzelnen nachweisen, welche die von den Verfassern abweichende Annahme ihres Folgeverhältnisses erhärten. Es sei
hier nur noch in inhaltlicher Hinsicht auf die korrektere Darstellung des langbärtigen Deutschherrn (Pauli 1137) gegen-
über dem unbärtigen Cranachs (Blatt 16), in künstlerischer Hinsicht auf die die Darstellung erst belebende abweichende
Mantelhaltung des Vertreters des Grandimontenserordens (Pauli 1140, Cranach-Folge Blatt 36) hingewiesen.
Einen Holzschnitt der Cranachschen Folge, den Augustiner-Eremiten (Blatt 40), kann ich übrigens, als einzige mir bis-
her bekannt gewordene Wiederverwendung eines Holzschnittes außerhalb der Folge, nachweisen, als Titelholzschnitt von:
[zwei BlätterJ De dudesche [J Vigilie. jj [Blatt] || [H] |l ; o. O. und J., 8 ungez. Bl. in 8° (Berlin, Staatsbibl. Yd 7822).
Bei Betrachtung des Cranachschen Eselbildes haben die Verfasser, deren Deutung der jungen Esel auf die
»Lipsenses asini« ohne weiteres einleuchtet, sich die eigentlichen »Kampfmotive« indessen entgehen lassen: sicherlich
ist hier in dem Zierat der Krone ein Kothaufen gegeben, und die auffällige Rückenzeichnung des Felles des alten Esels
soll in ihrer Kreuzform wohl den Schmuck des priesterlichen Meßgewandes andeuten.
Trotz gegenteiliger Auffassung der Verfasser möchte ich behaupten, daß die Frage der Autorschaft der Holzschnitte
der »Abbildung des Papsttums« sich sehr wohl aus diesen selbst entscheiden lasse. Aus stilistischen Gründen, die
ausschlaggebend gegen alle herangezogenen, keineswegs eindeutigen Belege aus literarischen Quellen sprechen, sind
sie sowohl weder als Arbeiten Lukas Cranachs des Älteren noch als solche Lukas Cranachs des Jüngeren anzusehen.
Schon Lehfeldt hat dies nachdrücklich betont,1 die Verfasser aber setzen sich leicht über die Frage hinweg und meinen,
ohne näheres Eingehen auf wirklich kunstgeschichtliche Kriterien, daß »ernste stilistische Bedenken gegen die Annahme
der Urheberschaft Cranachs« nicht vorliegen. Daß als Zeichner dieser Blätter allein der Monogrammist M S, der Illustrator
der ersten Gesamtbibel Luthers von 1534, dessen weitere Tätigkeit für den Reformator ebenso naheliegend sein dürfte,
in Frage kommen kann, gedenke ich demnächst in anderem Zusammenhang bei Besprechung von dessen weiteren
Arbeiten ausführlich zu begründen. Dieser neuen Zuweisung schließt sich nunmehr auch Max Geisberg mit seiner
Bestimmung des eng mit der Folge zusammenhängenden Holzschnittes des Papst-Spottwappens, für den die Verfasser
keinen Künstlernamen zu geben wissen, als Werk des Monogrammisten M S an. "-
Wiederum ist hier in der Zusammenstellung der einzelnen erhaltenen Exemplare und Ausgaben, sowie der Nach-
schnitte und Abbildungen, die sehr wesentlich über das zuletzt von Wendeler Gebotene3 hinausgeht, der wertvollste
Beitrag gegeben. Ein bisher unbeschriebenes Exemplar kann ich im Kupferstichkabinett des Landesmuseums zu
iginalen un
fmotivevvoW
rechte Unter-
1 Paul Lehfeldt, »Luthers Verhältnis zu Kunst und Künstlern«, Berlin, Wilh. Hertz, 1892. — ~ >Der deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten
Hälfte des XVI. Jahrhunderts«, München 1924, VI Nr. 26. — 3 Camillus Wendeler, >M. Luthers Bilderpolemik gegen das Papsttum von 1545«, irr
Archiv f. Literaturgesch. XIV, Leipzig 1886. — Der Band der Weimarer Luther-Ausgabe, die die Folge auch berücksichtigen wird, steht noch aus.
— 65 —