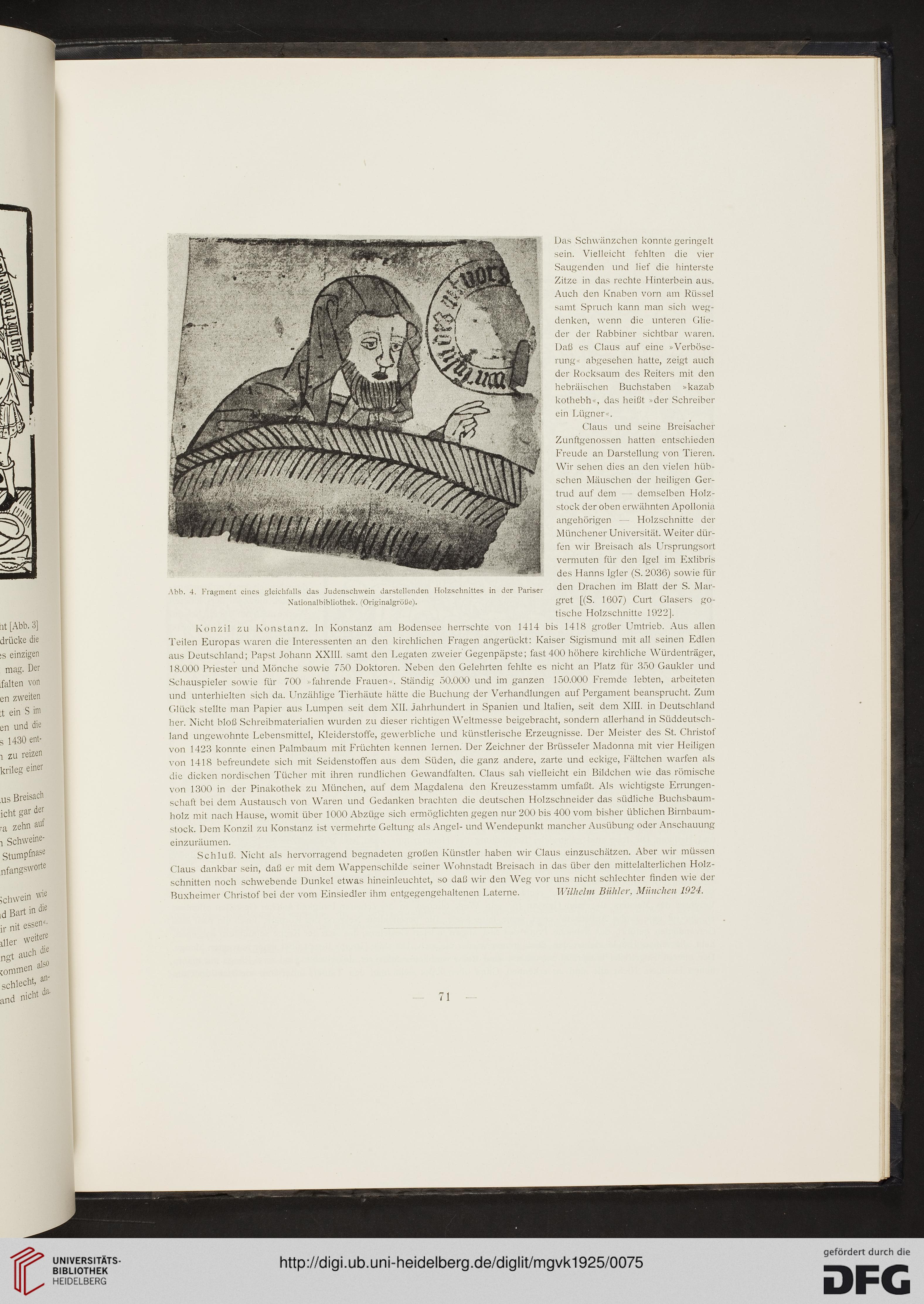«■■■■■■■■■■■■■^■■■■■^■■■■■■I
Das Schwänzchen konnte geringelt
sein. Vielleicht fehlten die vier
Saugenden und lief die hinterste
Zitze in das rechte Hinterbein aus.
Auch den Knaben vorn am Rüssel
samt Spruch kann man sich weg-
denken, wenn die unteren Glie-
der der Rabbiner sichtbar waren.
Daß es Claus auf eine »Verböse-
rung« abgesehen hatte, zeigt auch
der Rocksaum des Reiters mit den
hebräischen Buchstaben »kazab
kothebh«, das heißt »der Schreiber
ein Lügner«.
Claus und seine Breisacher
Zunftgenossen hatten entschieden
Freude an Darstellung von Tieren.
Wir sehen dies an den vielen hüb-
schen Mäuschen der heiligen Ger-
trud auf dem -- demselben Holz-
stock der oben erwähnten Apollonia
angehörigen ■ Holzschnitte der
Münchener Universität. Weiter dür-
fen wir Breisach als Ursprungsort
vermuten für den Igel im Exlibris
des Hanns Igler (S. 2036) sowie für
den Drachen im Blatt der S. Mar-
gret [(S. 1607) Curt Glasers go-
tische Holzschnitte 1922].
Konzil zu Konstanz. In Konstanz am Bodensee herrschte von 1414 bis 1418 großer Umhieb. Aus allen
Teilen Europas waren die Interessenten an den kirchlichen Fragen angerückt: Kaiser Sigismund mit all seinen Edlen
aus Deutschland; Papst Johann XXIII. samt den Legaten zweier Gegenpäpste; fast 400 höhere kirchliche Würdenträger,
18.000 Priester und Mönche sowie 750 Doktoren. Neben den Gelehrten fehlte es nicht an Platz für 350 Gaukler und
Schauspieler sowie für 700 «fahrende Frauen«. Ständig 50.000 und im ganzen 150.000 Fremde lebten, arbeiteten
und unterhielten sich da. Unzählige Tierhäute hätte die Buchung der Verhandlungen auf Pergament beansprucht. Zum
Glück stellte man Papier aus Lumpen seit dem XII. Jahrhundert in Spanien und Italien, seit dem XIII. in Deutschland
her. Nicht bloß Schreibmaterialien wurden zu dieser richtigen Weltmesse beigebracht, sondern allerhand in Süddeutsch-
land ungewohnte Lebensmittel, Kleiderstoffe, gewerbliche und künstlerische Erzeugnisse. Der Meister des St. Christof
von 1423 konnte einen Palmbaum mit Früchten kennen lernen. Der Zeichner der Brüsseler Madonna mit vier Heiligen
von 1418 befreundete sich mit Seidenstoffen aus dem Süden, die ganz andere, zarte und eckige, Fältchen warfen als
die dicken nordischen Tücher mit ihren rundlichen Gewandfalten. Claus sah vielleicht ein Bildchen wie das römische
von 1300 in der Pinakothek zu München, auf dem Magdalena den Kreuzesstamm umfaßt. Als wichtigste Errungen-
schaft bei dem Austausch von Waren und Gedanken brachten die deutschen Holzschneider das südliche Buchsbaum-
holz mit nach Hause, womit über 1000 Abzüge sich ermöglichten gegen nur 200 bis 400 vom bisher üblichen Birnbaum-
stock. Dem Konzil zu Konstanz ist vermehrte Geltung als Angel- und Wendepunkt mancher Ausübung oder Anschauung
einzuräumen.
Schluß. Nicht als hervorragend begnadeten großen Künstler haben wir Claus einzuschätzen. Aber wir müssen
Claus dankbar sein, daß er mit dem WTappenschilde seiner Wohnstadt Breisach in das über den mittelalterlichen Holz-
schnitten noch schwebende Dunkel etwas hineinleuchtet, so daß wir den Weg vor uns nicht schlechter finden wie der
Buxheimer Christof bei der vom Einsiedler ihm entgegengehaltenen Laterne. Wilhelm Bühler. München 1924.
Abb. 4. Fragment eines
gleichfalls das Judenschwein darstellenden Holzschnittes in der Pariser
Nationalbibliothek. ("Originalgröße).
71
Das Schwänzchen konnte geringelt
sein. Vielleicht fehlten die vier
Saugenden und lief die hinterste
Zitze in das rechte Hinterbein aus.
Auch den Knaben vorn am Rüssel
samt Spruch kann man sich weg-
denken, wenn die unteren Glie-
der der Rabbiner sichtbar waren.
Daß es Claus auf eine »Verböse-
rung« abgesehen hatte, zeigt auch
der Rocksaum des Reiters mit den
hebräischen Buchstaben »kazab
kothebh«, das heißt »der Schreiber
ein Lügner«.
Claus und seine Breisacher
Zunftgenossen hatten entschieden
Freude an Darstellung von Tieren.
Wir sehen dies an den vielen hüb-
schen Mäuschen der heiligen Ger-
trud auf dem -- demselben Holz-
stock der oben erwähnten Apollonia
angehörigen ■ Holzschnitte der
Münchener Universität. Weiter dür-
fen wir Breisach als Ursprungsort
vermuten für den Igel im Exlibris
des Hanns Igler (S. 2036) sowie für
den Drachen im Blatt der S. Mar-
gret [(S. 1607) Curt Glasers go-
tische Holzschnitte 1922].
Konzil zu Konstanz. In Konstanz am Bodensee herrschte von 1414 bis 1418 großer Umhieb. Aus allen
Teilen Europas waren die Interessenten an den kirchlichen Fragen angerückt: Kaiser Sigismund mit all seinen Edlen
aus Deutschland; Papst Johann XXIII. samt den Legaten zweier Gegenpäpste; fast 400 höhere kirchliche Würdenträger,
18.000 Priester und Mönche sowie 750 Doktoren. Neben den Gelehrten fehlte es nicht an Platz für 350 Gaukler und
Schauspieler sowie für 700 «fahrende Frauen«. Ständig 50.000 und im ganzen 150.000 Fremde lebten, arbeiteten
und unterhielten sich da. Unzählige Tierhäute hätte die Buchung der Verhandlungen auf Pergament beansprucht. Zum
Glück stellte man Papier aus Lumpen seit dem XII. Jahrhundert in Spanien und Italien, seit dem XIII. in Deutschland
her. Nicht bloß Schreibmaterialien wurden zu dieser richtigen Weltmesse beigebracht, sondern allerhand in Süddeutsch-
land ungewohnte Lebensmittel, Kleiderstoffe, gewerbliche und künstlerische Erzeugnisse. Der Meister des St. Christof
von 1423 konnte einen Palmbaum mit Früchten kennen lernen. Der Zeichner der Brüsseler Madonna mit vier Heiligen
von 1418 befreundete sich mit Seidenstoffen aus dem Süden, die ganz andere, zarte und eckige, Fältchen warfen als
die dicken nordischen Tücher mit ihren rundlichen Gewandfalten. Claus sah vielleicht ein Bildchen wie das römische
von 1300 in der Pinakothek zu München, auf dem Magdalena den Kreuzesstamm umfaßt. Als wichtigste Errungen-
schaft bei dem Austausch von Waren und Gedanken brachten die deutschen Holzschneider das südliche Buchsbaum-
holz mit nach Hause, womit über 1000 Abzüge sich ermöglichten gegen nur 200 bis 400 vom bisher üblichen Birnbaum-
stock. Dem Konzil zu Konstanz ist vermehrte Geltung als Angel- und Wendepunkt mancher Ausübung oder Anschauung
einzuräumen.
Schluß. Nicht als hervorragend begnadeten großen Künstler haben wir Claus einzuschätzen. Aber wir müssen
Claus dankbar sein, daß er mit dem WTappenschilde seiner Wohnstadt Breisach in das über den mittelalterlichen Holz-
schnitten noch schwebende Dunkel etwas hineinleuchtet, so daß wir den Weg vor uns nicht schlechter finden wie der
Buxheimer Christof bei der vom Einsiedler ihm entgegengehaltenen Laterne. Wilhelm Bühler. München 1924.
Abb. 4. Fragment eines
gleichfalls das Judenschwein darstellenden Holzschnittes in der Pariser
Nationalbibliothek. ("Originalgröße).
71