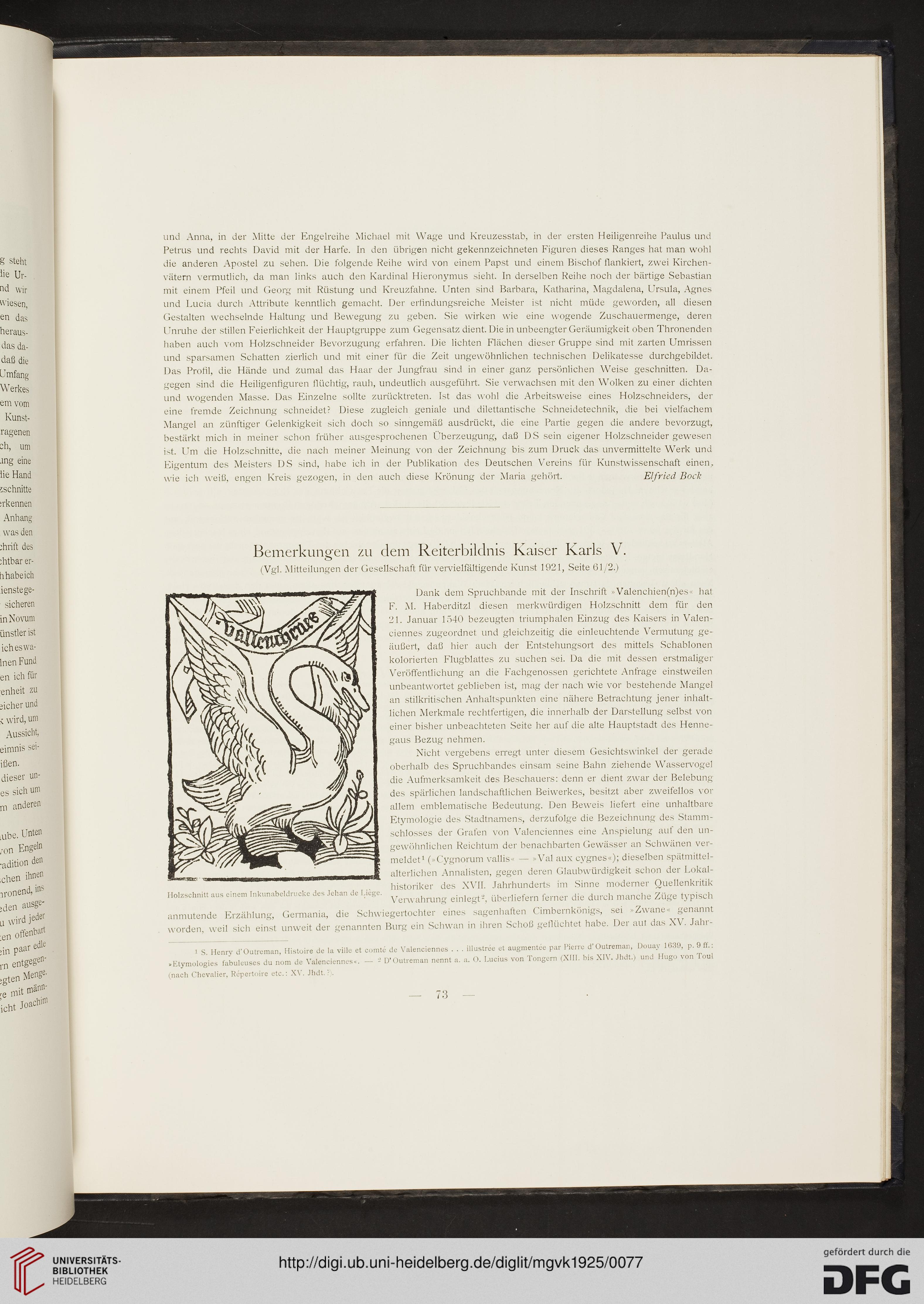und Anna, in der Mitte der Engelreihe Michael mit Wage und Kreuzesstab, in der ersten Heiligenreihe Paulus und
Petrus und rechts David mit der Harfe. In den übrigen nicht gekennzeichneten Figuren dieses Ranges hat man wohl
die anderen Apostel zu sehen. Die folgende Reihe wird von einem Papst und einem Bischof flankiert, zwei Kirchen-
vätern vermutlich, da man links auch den Kardinal Hieronymus sieht. In derselben Reihe noch der bärtige Sebastian
mit einem Pfeil und Georg mit Rüstung und Kreuzfahne. Unten sind Barbara, Katharina, Magdalena, Ursula, Agnes
und Lucia durch Attribute kenntlich gemacht. Der erfindungsreiche Meister ist nicht müde geworden, all diesen
Gestalten wechselnde Haltung und Bewegung zu geben. Sie wirken wie eine wogende Zuschauermenge, deren
Unruhe der stillen Feierlichkeit der Hauptgruppe zum Gegensatz dient. Die in unbeengter Geräumigkeit oben Thronenden
haben auch vom Holzschneider Bevorzugung erfahren. Die lichten Flächen dieser Gruppe sind mit zarten Umrissen
und sparsamen Schatten zierlich und mit einer für die Zeit ungewöhnlichen technischen Delikatesse durchgebildet.
Das Profil, die Hände und zumal das Haar der Jungfrau sind in einer ganz persönlichen Weise geschnitten. Da-
gegen sind die Heiligenfiguren flüchtig, rauh, undeutlich ausgeführt. Sie verwachsen mit den Wolken zu einer dichten
und wogenden Masse. Das Einzelne sollte zurücktreten. Ist das wohl die Arbeitsweise eines Holzschneiders, der
eine fremde Zeichnung schneidet? Diese zugleich geniale und dilettantische Schneidetechnik, die bei vielfachem
Mangel an zünftiger Gelenkigkeit sich doch so sinngemäß ausdrückt, die eine Partie gegen die andere bevorzugt,
bestärkt mich in meiner schon früher ausgesprochenen Überzeugung, daß DS sein eigener Holzschneider gewesen
ist. Um die Holzschnitte, die nach meiner Meinung von der Zeichnung bis zum Druck das unvermittelte Werk und
Eigentum des Meisters DS sind, habe ich in der Publikation des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft einen7
wie ich weiß, engen Kreis gezogen, in den auch diese Krönung der Maria gehört. Elfried Bock
anmutende E
worden, weil
Bemerkunu-en zu dem Reiterbilclms Kaiser Karls V.
o
(Vgl. Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1921, Seite 61/2.)
Dank dem Spruchbande mit der Inschrift »Valenchien(n)es» hat
F. M. Haberditzl diesen merkwürdigen Holzschnitt dem für den
21. Januar 1540 bezeugten triumphalen Einzug des Kaisers in Valen-
ciennes zugeordnet und gleichzeitig die einleuchtende Vermutung ge-
äußert, daß hier auch der Entstehungsort des mittels Schablonen
kolorierten Flugblattes zu suchen sei. Da die mit dessen erstmaliger
Veröffentlichung an die Fachgenossen gerichtete Anfrage einstweilen
unbeantwortet geblieben ist, mag der nach wie vor bestehende Mangel
an stilkritischen Anhaltspunkten eine nähere Betrachtung jener inhalt-
lichen Merkmale rechtfertigen, die innerhalb der Darstellung selbst von
einer bisher unbeachteten Seite her auf die alte Hauptstadt des Henne-
gaus Bezug nehmen.
Nicht vergebens erregt unter diesem Gesichtswinkel der gerade
oberhalb des Spruchbandes einsam seine Bahn ziehende Wasservogel
die Aufmerksamkeit des Beschauers: denn er dient zwar der Belebung
des spärlichen landschaftlichen Beiwerkes, besitzt aber zweifellos vor
allem emblematische Bedeutung. Den Beweis liefert eine unhaltbare
Etymologie des Stadtnamens, derzufolge die Bezeichnung des Stamm-
schlosses der Grafen von Valenciennes eine Anspielung auf den un-
gewöhnlichen Reichtum der benachbarten Gewässer an Schwänen ver-
meldet1 (»Cygnorum vallis« — »Val aux cygnes«); dieselben spätmittel-
alterlichen Annalisten, gegen deren Glaubwürdigkeit schon der Lokal-
historiker des XVII. Jahrhunderts im Sinne moderner Quellenkritik
Verwahrung einlegt-, überliefern ferner die durch manche Züge typisch
die Schwiegertochter eines sagenhaften Cimbernkönigs, sei »Zwane« genannt
benannten Burg ein Schwan in ihren Schoß geflüchtet habe. Der aul das XV. Jahr-
Holzschnitt aus einem Inkunabeldrucke des Jehan de Lieg
rzählung,
sich einst
Germania,
unweit der
i S. Henry d'Outreman, Histoire de la ville et corate de Valenciennes . . . illustree et augmentee par Pierre d'Outreman, Douay 1630, p. 9 ff.:
»Etymologies fabuleuses du nom de Valenciennes«. — * D'Outreman nennt a. a. 0. Lucius von Tongern (XIII. bis XIV. Jhdt.) und Hugo von Toul
(nach Chevalier, Repertoire etc.: XV. Jhdt.:- .
— 73
Petrus und rechts David mit der Harfe. In den übrigen nicht gekennzeichneten Figuren dieses Ranges hat man wohl
die anderen Apostel zu sehen. Die folgende Reihe wird von einem Papst und einem Bischof flankiert, zwei Kirchen-
vätern vermutlich, da man links auch den Kardinal Hieronymus sieht. In derselben Reihe noch der bärtige Sebastian
mit einem Pfeil und Georg mit Rüstung und Kreuzfahne. Unten sind Barbara, Katharina, Magdalena, Ursula, Agnes
und Lucia durch Attribute kenntlich gemacht. Der erfindungsreiche Meister ist nicht müde geworden, all diesen
Gestalten wechselnde Haltung und Bewegung zu geben. Sie wirken wie eine wogende Zuschauermenge, deren
Unruhe der stillen Feierlichkeit der Hauptgruppe zum Gegensatz dient. Die in unbeengter Geräumigkeit oben Thronenden
haben auch vom Holzschneider Bevorzugung erfahren. Die lichten Flächen dieser Gruppe sind mit zarten Umrissen
und sparsamen Schatten zierlich und mit einer für die Zeit ungewöhnlichen technischen Delikatesse durchgebildet.
Das Profil, die Hände und zumal das Haar der Jungfrau sind in einer ganz persönlichen Weise geschnitten. Da-
gegen sind die Heiligenfiguren flüchtig, rauh, undeutlich ausgeführt. Sie verwachsen mit den Wolken zu einer dichten
und wogenden Masse. Das Einzelne sollte zurücktreten. Ist das wohl die Arbeitsweise eines Holzschneiders, der
eine fremde Zeichnung schneidet? Diese zugleich geniale und dilettantische Schneidetechnik, die bei vielfachem
Mangel an zünftiger Gelenkigkeit sich doch so sinngemäß ausdrückt, die eine Partie gegen die andere bevorzugt,
bestärkt mich in meiner schon früher ausgesprochenen Überzeugung, daß DS sein eigener Holzschneider gewesen
ist. Um die Holzschnitte, die nach meiner Meinung von der Zeichnung bis zum Druck das unvermittelte Werk und
Eigentum des Meisters DS sind, habe ich in der Publikation des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft einen7
wie ich weiß, engen Kreis gezogen, in den auch diese Krönung der Maria gehört. Elfried Bock
anmutende E
worden, weil
Bemerkunu-en zu dem Reiterbilclms Kaiser Karls V.
o
(Vgl. Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1921, Seite 61/2.)
Dank dem Spruchbande mit der Inschrift »Valenchien(n)es» hat
F. M. Haberditzl diesen merkwürdigen Holzschnitt dem für den
21. Januar 1540 bezeugten triumphalen Einzug des Kaisers in Valen-
ciennes zugeordnet und gleichzeitig die einleuchtende Vermutung ge-
äußert, daß hier auch der Entstehungsort des mittels Schablonen
kolorierten Flugblattes zu suchen sei. Da die mit dessen erstmaliger
Veröffentlichung an die Fachgenossen gerichtete Anfrage einstweilen
unbeantwortet geblieben ist, mag der nach wie vor bestehende Mangel
an stilkritischen Anhaltspunkten eine nähere Betrachtung jener inhalt-
lichen Merkmale rechtfertigen, die innerhalb der Darstellung selbst von
einer bisher unbeachteten Seite her auf die alte Hauptstadt des Henne-
gaus Bezug nehmen.
Nicht vergebens erregt unter diesem Gesichtswinkel der gerade
oberhalb des Spruchbandes einsam seine Bahn ziehende Wasservogel
die Aufmerksamkeit des Beschauers: denn er dient zwar der Belebung
des spärlichen landschaftlichen Beiwerkes, besitzt aber zweifellos vor
allem emblematische Bedeutung. Den Beweis liefert eine unhaltbare
Etymologie des Stadtnamens, derzufolge die Bezeichnung des Stamm-
schlosses der Grafen von Valenciennes eine Anspielung auf den un-
gewöhnlichen Reichtum der benachbarten Gewässer an Schwänen ver-
meldet1 (»Cygnorum vallis« — »Val aux cygnes«); dieselben spätmittel-
alterlichen Annalisten, gegen deren Glaubwürdigkeit schon der Lokal-
historiker des XVII. Jahrhunderts im Sinne moderner Quellenkritik
Verwahrung einlegt-, überliefern ferner die durch manche Züge typisch
die Schwiegertochter eines sagenhaften Cimbernkönigs, sei »Zwane« genannt
benannten Burg ein Schwan in ihren Schoß geflüchtet habe. Der aul das XV. Jahr-
Holzschnitt aus einem Inkunabeldrucke des Jehan de Lieg
rzählung,
sich einst
Germania,
unweit der
i S. Henry d'Outreman, Histoire de la ville et corate de Valenciennes . . . illustree et augmentee par Pierre d'Outreman, Douay 1630, p. 9 ff.:
»Etymologies fabuleuses du nom de Valenciennes«. — * D'Outreman nennt a. a. 0. Lucius von Tongern (XIII. bis XIV. Jhdt.) und Hugo von Toul
(nach Chevalier, Repertoire etc.: XV. Jhdt.:- .
— 73