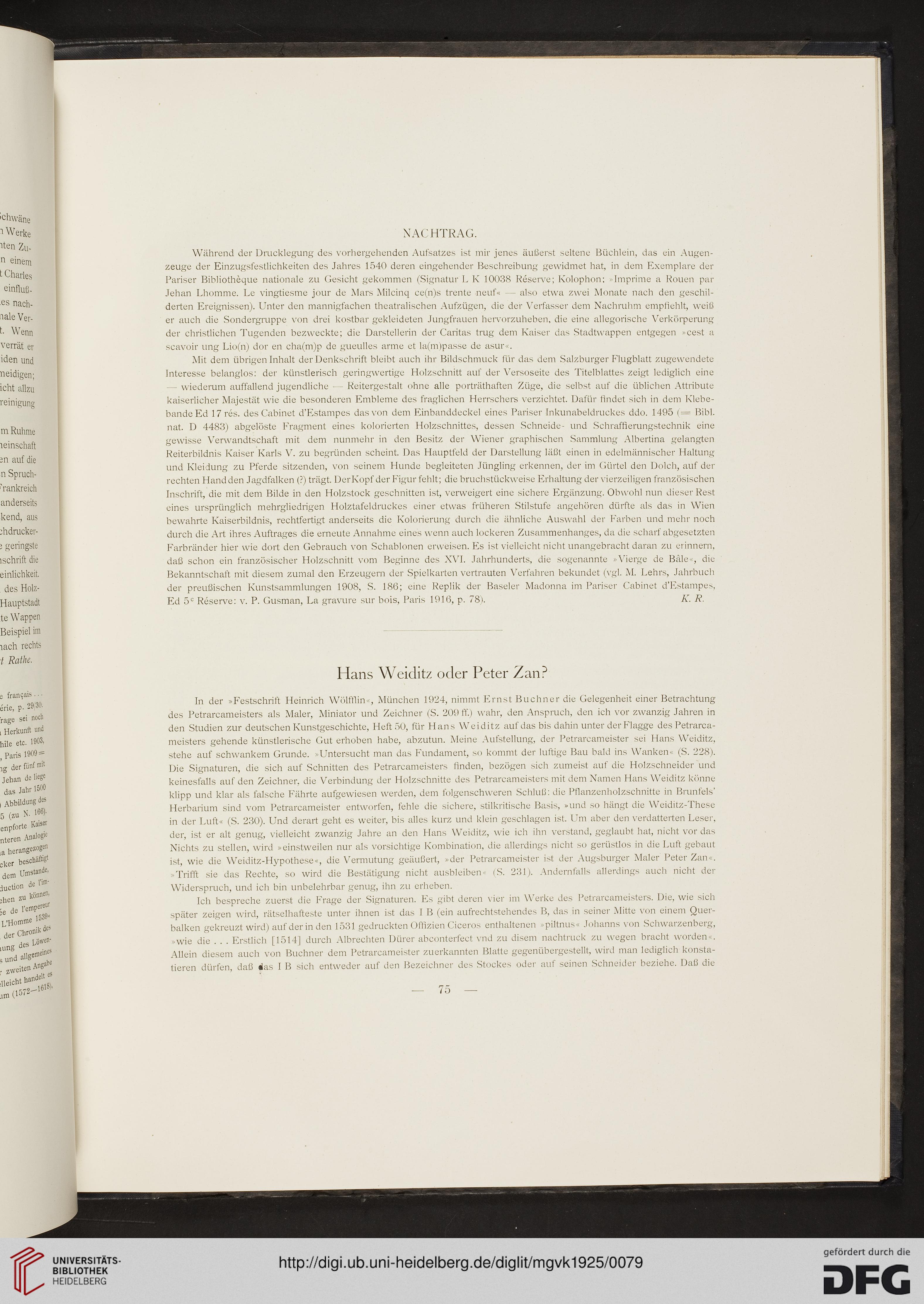IHIHHHHHH
NACHTRAG.
Während der Drucklegung des vorhergehenden Aufsatzes ist mir jenes äußerst seltene Büchlein, das ein Augen-
zeuge der Einzugsfestlichkeiten des Jahres 1540 deren eingehender Beschreibung gewidmet hat, in dem Exemplare der
Pariser Bibliotheque nationale zu Gesicht gekommen (Signatur L K 10038 Reserve; Kolophon: »Imprime a Rouen par
Jehan Lhomme. Le vingtiesme jour de Mars Milcinq ce(n)s trente neuf« — also etwa zwei Monate nach den geschil-
derten Ereignissen). Unter den mannigfachen theatralischen Aufzügen, die der Verfasser dem Nachruhm empfiehlt, weiß
er auch die Sondergruppe von drei kostbar gekleideten Jungfrauen hervorzuheben, die eine allegorische Verkörperung
der christlichen Tugenden bezweckte; die Darstellerin der Caritas trug dem Kaiser das Stadtwappen entgegen »cest a
scavoir ung Lio(n) dor en cha(m)p de gueulles arme et la(m)passe de asur«.
Mit dem übrigen Inhalt der Denkschrift bleibt auch ihr Bildschmuck für das dem Salzburger Flugblatt zugewendete
Interesse belanglos: der künstlerisch geringwertige Holzschnitt auf der Versoseite des Titelblattes zeigt lediglich eine
- wiederum auffallend jugendliche — Reitergestalt ohne alle porträthaften Züge, die selbst auf die üblichen Attribute
kaiserlicher Majestät wie die besonderen Embleme des fraglichen Herrschers verzichtet. Dafür findet sich in dem Klebe-
bande Ed 17 res. des Cabinet d'Estampes das von dem Einbanddeckel eines Pariser Inkunabeldruckes ddo. 1495 (= Bibl.
nat. D 4483) abgelöste Fragment eines kolorierten Holzschnittes, dessen Schneide- und Schraffierungstechnik eine
gewisse Verwandtschaft mit dem nunmehr in den Besitz der Wiener graphischen Sammlung Albertina gelangten
Reiterbildnis Kaiser Karls V. zu begründen scheint. Das Hauptfeld der Darstellung läßt einen in edelmännischer Haltung
und Kleidung zu Pferde sitzenden, von seinem Hunde begleiteten Jüngling erkennen, der im Gürtel den Dolch, auf der
rechten Hand den Jagdfalken (?) trägt. Der Kopf der Figur fehlt; die bruchstückweise Erhaltung der vierzeiligen französischen
Inschrift, die mit dem Bilde in den Holzstock geschnitten ist, verweigert eine sichere Ergänzung. Obwohl nun dieser Rest
eines ursprünglich mehrgliedrigen Holztafeldruckes einer etwas früheren Stilstufe angehören dürfte als das in Wien
bewahrte Kaiserbildnis, rechtfertigt anderseits die Kolorierung durch die ähnliche Auswahl der Farben und mehr noch
durch die Art ihres Auftrages die erneute Annahme eines wenn auch lockeren Zusammenhanges, da die scharf abgesetzten
Farbränder hier wie dort den Gebrauch von Schablonen erweisen. Es ist vielleicht nicht unangebracht daran zu erinnern,
daß schon ein französischer Holzschnitt vom Beginne des XVI. Jahrhunderts, die sogenannte »Vierge de Bäle«, die
Bekanntschaft mit diesem zumal den Erzeugern der Spielkarten vertrauten Verfahren bekundet (vgl. M. Lehrs, Jahrbuch
der preußischen Kunstsammlungen 1908, S. 186; eine Replik der Baseler Madonna im Pariser Cabinet d'Estampes,
Ed 5C Reserve: v. P. Gusman, La gravure sur bois, Paris 1916, p. 78). K. R.
Hans Weiditz oder Peter ZanD
In der »Festschrift Heinrich Wölfflin«, München 1924, nimmt Ernst Buchner die Gelegenheit einer Betrachtung
des Petrarcameisters als Maler, Miniator und Zeichner (S. 209 ff.) wahr, den Anspruch, den ich vor zwanzig Jahren in
den Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 50, für Hans Weiditz auf das bis dahin unter der Flagge des Petrarca-
meisters gehende künstlerische Gut erhoben habe, abzutun. Meine Aufstellung, der Petrarcameistet- sei Hans Weiditz,
stehe auf schwankem Grunde. »Untersucht man das Fundament, so kommt der luftige Bau bald ins Wanken« (S. 228).
Die Signaturen, die sich auf Schnitten des Petrarcameisters finden, bezögen sich zumeist auf die Holzschneider und
keinesfalls auf den Zeichner, die Verbindung der Holzschnitte des Petrarcameisters mit dem Namen Hans Weiditz könne
klipp und klar als falsche Fährte aufgewiesen werden, dem folgenschweren Schluß: die Pflanzenholzschnitte in Bmnfels'
Herbarium sind vom Petrarcameister entworfen, fehle die sichere, stilkritische Basis, »und so hängt die Weiditz-These
in der Luft« (S. 230). Und derart geht es weiter, bis alles kurz und klein geschlagen ist. Um aber den verdatterten Leser,
der, ist er alt genug, vielleicht zwanzig Jahre an den Hans Weiditz, wie ich ihn verstand, geglaubt hat, nicht vor das
Nichts zu stellen, wird »einstweilen nur als vorsichtige Kombination, die allerdings nicht so gerüstlos in die Luft gebaut
ist, wie die Weiditz-Hypothese«, die Vermutung geäußert, »der Petrarcameister ist der Augsburger Maler Peter Zan«.
»Trifft sie das Rechte, so wird die Bestätigung nicht ausbleiben- (S. 231). Andernfalls allerdings auch nicht der
Widerspruch, und ich bin unbelehrbar genug, ihn zu erheben.
Ich bespreche zuerst die Frage der Signaturen. Es gibt deren vier im Werke des Petrarcameisters. Die, wie sich
später zeigen wird, rätselhafteste unter ihnen ist das I B (ein aufrechtstehendes B, das in seiner Mitte von einem Quer-
balken gekreuzt wird) auf der in den 1531 gedruckten Offizien Ciceros enthaltenen »piltnus« Johanns von Schwarzenberg,
»wie die . . . Erstlich [1514] durch Albrechten Dürer abconterfect vnd zu disem nachtruck zu wegen bracht worden«.
Allein diesem auch von Buchner dem Petrarcameister zuerkannten Blatte gegenübergestellt, wird man lediglich konsta-
tieren dürfen, daß das I B sich entweder auf den Bezeichne!' des Stockes oder auf seinen Schneider beziehe. Daß die
75 —
NACHTRAG.
Während der Drucklegung des vorhergehenden Aufsatzes ist mir jenes äußerst seltene Büchlein, das ein Augen-
zeuge der Einzugsfestlichkeiten des Jahres 1540 deren eingehender Beschreibung gewidmet hat, in dem Exemplare der
Pariser Bibliotheque nationale zu Gesicht gekommen (Signatur L K 10038 Reserve; Kolophon: »Imprime a Rouen par
Jehan Lhomme. Le vingtiesme jour de Mars Milcinq ce(n)s trente neuf« — also etwa zwei Monate nach den geschil-
derten Ereignissen). Unter den mannigfachen theatralischen Aufzügen, die der Verfasser dem Nachruhm empfiehlt, weiß
er auch die Sondergruppe von drei kostbar gekleideten Jungfrauen hervorzuheben, die eine allegorische Verkörperung
der christlichen Tugenden bezweckte; die Darstellerin der Caritas trug dem Kaiser das Stadtwappen entgegen »cest a
scavoir ung Lio(n) dor en cha(m)p de gueulles arme et la(m)passe de asur«.
Mit dem übrigen Inhalt der Denkschrift bleibt auch ihr Bildschmuck für das dem Salzburger Flugblatt zugewendete
Interesse belanglos: der künstlerisch geringwertige Holzschnitt auf der Versoseite des Titelblattes zeigt lediglich eine
- wiederum auffallend jugendliche — Reitergestalt ohne alle porträthaften Züge, die selbst auf die üblichen Attribute
kaiserlicher Majestät wie die besonderen Embleme des fraglichen Herrschers verzichtet. Dafür findet sich in dem Klebe-
bande Ed 17 res. des Cabinet d'Estampes das von dem Einbanddeckel eines Pariser Inkunabeldruckes ddo. 1495 (= Bibl.
nat. D 4483) abgelöste Fragment eines kolorierten Holzschnittes, dessen Schneide- und Schraffierungstechnik eine
gewisse Verwandtschaft mit dem nunmehr in den Besitz der Wiener graphischen Sammlung Albertina gelangten
Reiterbildnis Kaiser Karls V. zu begründen scheint. Das Hauptfeld der Darstellung läßt einen in edelmännischer Haltung
und Kleidung zu Pferde sitzenden, von seinem Hunde begleiteten Jüngling erkennen, der im Gürtel den Dolch, auf der
rechten Hand den Jagdfalken (?) trägt. Der Kopf der Figur fehlt; die bruchstückweise Erhaltung der vierzeiligen französischen
Inschrift, die mit dem Bilde in den Holzstock geschnitten ist, verweigert eine sichere Ergänzung. Obwohl nun dieser Rest
eines ursprünglich mehrgliedrigen Holztafeldruckes einer etwas früheren Stilstufe angehören dürfte als das in Wien
bewahrte Kaiserbildnis, rechtfertigt anderseits die Kolorierung durch die ähnliche Auswahl der Farben und mehr noch
durch die Art ihres Auftrages die erneute Annahme eines wenn auch lockeren Zusammenhanges, da die scharf abgesetzten
Farbränder hier wie dort den Gebrauch von Schablonen erweisen. Es ist vielleicht nicht unangebracht daran zu erinnern,
daß schon ein französischer Holzschnitt vom Beginne des XVI. Jahrhunderts, die sogenannte »Vierge de Bäle«, die
Bekanntschaft mit diesem zumal den Erzeugern der Spielkarten vertrauten Verfahren bekundet (vgl. M. Lehrs, Jahrbuch
der preußischen Kunstsammlungen 1908, S. 186; eine Replik der Baseler Madonna im Pariser Cabinet d'Estampes,
Ed 5C Reserve: v. P. Gusman, La gravure sur bois, Paris 1916, p. 78). K. R.
Hans Weiditz oder Peter ZanD
In der »Festschrift Heinrich Wölfflin«, München 1924, nimmt Ernst Buchner die Gelegenheit einer Betrachtung
des Petrarcameisters als Maler, Miniator und Zeichner (S. 209 ff.) wahr, den Anspruch, den ich vor zwanzig Jahren in
den Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 50, für Hans Weiditz auf das bis dahin unter der Flagge des Petrarca-
meisters gehende künstlerische Gut erhoben habe, abzutun. Meine Aufstellung, der Petrarcameistet- sei Hans Weiditz,
stehe auf schwankem Grunde. »Untersucht man das Fundament, so kommt der luftige Bau bald ins Wanken« (S. 228).
Die Signaturen, die sich auf Schnitten des Petrarcameisters finden, bezögen sich zumeist auf die Holzschneider und
keinesfalls auf den Zeichner, die Verbindung der Holzschnitte des Petrarcameisters mit dem Namen Hans Weiditz könne
klipp und klar als falsche Fährte aufgewiesen werden, dem folgenschweren Schluß: die Pflanzenholzschnitte in Bmnfels'
Herbarium sind vom Petrarcameister entworfen, fehle die sichere, stilkritische Basis, »und so hängt die Weiditz-These
in der Luft« (S. 230). Und derart geht es weiter, bis alles kurz und klein geschlagen ist. Um aber den verdatterten Leser,
der, ist er alt genug, vielleicht zwanzig Jahre an den Hans Weiditz, wie ich ihn verstand, geglaubt hat, nicht vor das
Nichts zu stellen, wird »einstweilen nur als vorsichtige Kombination, die allerdings nicht so gerüstlos in die Luft gebaut
ist, wie die Weiditz-Hypothese«, die Vermutung geäußert, »der Petrarcameister ist der Augsburger Maler Peter Zan«.
»Trifft sie das Rechte, so wird die Bestätigung nicht ausbleiben- (S. 231). Andernfalls allerdings auch nicht der
Widerspruch, und ich bin unbelehrbar genug, ihn zu erheben.
Ich bespreche zuerst die Frage der Signaturen. Es gibt deren vier im Werke des Petrarcameisters. Die, wie sich
später zeigen wird, rätselhafteste unter ihnen ist das I B (ein aufrechtstehendes B, das in seiner Mitte von einem Quer-
balken gekreuzt wird) auf der in den 1531 gedruckten Offizien Ciceros enthaltenen »piltnus« Johanns von Schwarzenberg,
»wie die . . . Erstlich [1514] durch Albrechten Dürer abconterfect vnd zu disem nachtruck zu wegen bracht worden«.
Allein diesem auch von Buchner dem Petrarcameister zuerkannten Blatte gegenübergestellt, wird man lediglich konsta-
tieren dürfen, daß das I B sich entweder auf den Bezeichne!' des Stockes oder auf seinen Schneider beziehe. Daß die
75 —