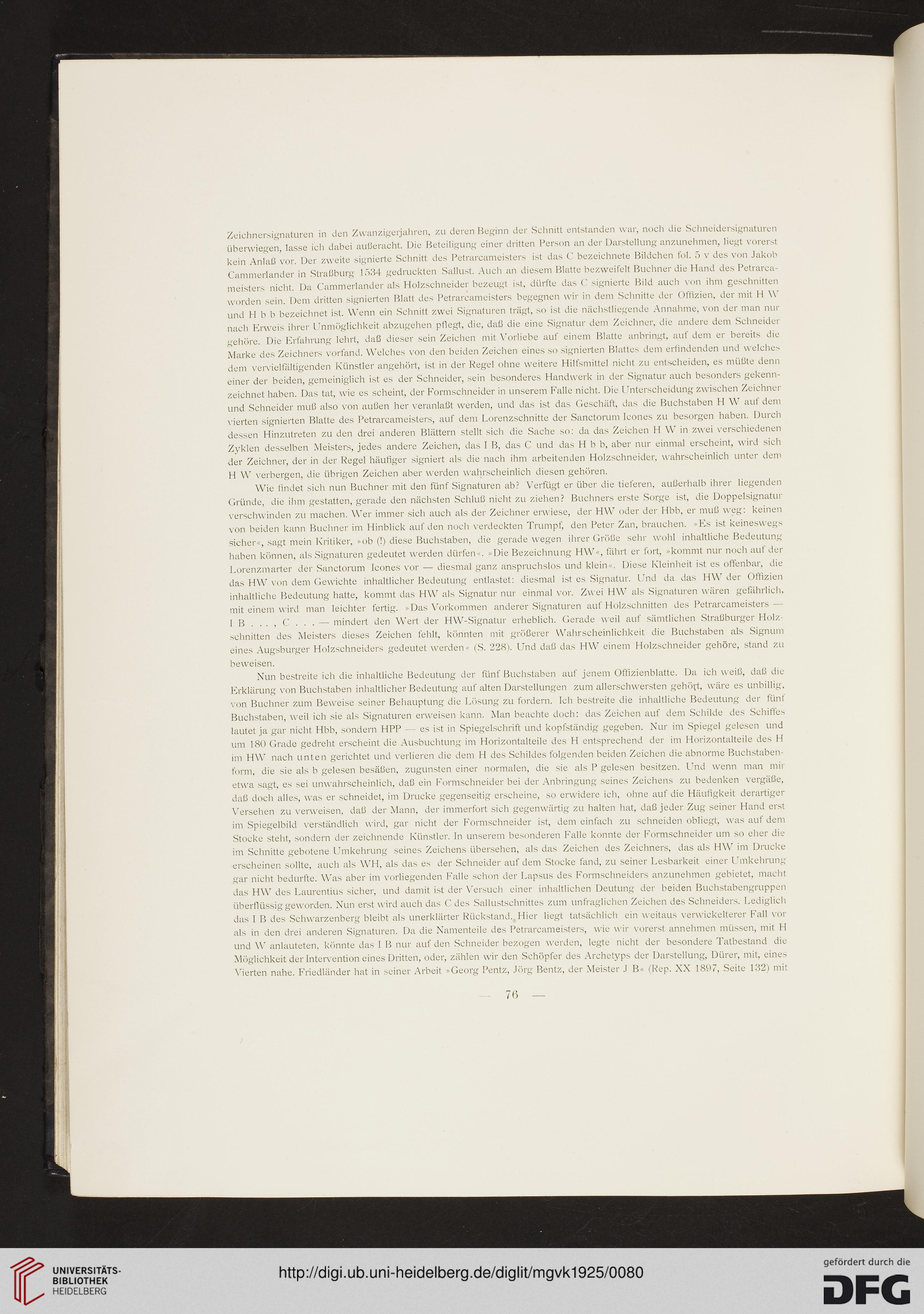Zeichnersignaturen in den Zwanzigerjahren, zu deren Beginn der Schnitt entstanden war, noch die Schneidersignaturen
überwiegen, lasse ich dabei außeracht. Die Beteiligung einer dritten Person an der Darstellung anzunehmen, liegt vorerst
kein Anlaß vor. Der zweite signierte Schnitt des Petrarcameisters ist das C bezeichnete Bildchen fol. 5 v des von Jakob
Cammerlander in Straßburg 1534 gedruckten Sallust. Auch an diesem Blatte bezweifelt Buchner die Hand des Petrarca-
meisters nicht. Da Cammerlander als Holzschneider bezeugt ist, dürfte das (' signierte Bild auch von ihm geschnitten
worden sein. Dem dritten signierten Blatt des Petrarcameisters begegnen wir in dem Schnitte der Offizien, der mit H W
und H b b bezeichnet ist. Wenn ein Schnitt zwei Signaturen trägt, so ist die nächstliegende Annahme, von der man nur
nach Erweis ihrer Unmöglichkeit abzugehen pflegt, die, daß die eine Signatur dem Zeichner, die andere dem Schneider
"'ehöre. Die Erfahrung lehrt, daß dieser sein Zeichen mit Vorliebe auf einem Blatte anbringt, auf dem er bereits die
Marke des Zeichners vorfand. Welches von den beiden Zeichen eines so signierten Blattes dem erfindenden und welches
dem vervielfältigenden Künstler angehört, ist in der Kegel ohne weitere Hilfsmittel nicht zu entscheiden, es müßte denn
einer der beiden, gemeiniglich ist es der Schneider, sein besonderes Handwerk in der Signatur auch besonders gekenn-
zeichnet haben. Das tat, wie es scheint, der Formschneider in unserem Falle nicht. Die Unterscheidung zwischen Zeichner
und Schneider muß also von außen her veranlaßt werden, und das ist das Geschäft, das die Buchstaben H W auf dem
vierten signierten Blatte des Petrarcameisters, auf dem Lorenzschnitte der Sanctorum Icones zu besorgen haben. Durch
dessen Hinzutreten zu den drei anderen Blättern stellt sich die Sache so: da das Zeichen H W in zwei verschiedenen
Zyklen desselben Meisters, jedes andere Zeichen, das I B, das C und das H b b, aber nur einmal erscheint, wird sich
der Zeichner, der in der Regel häufiger signiert als die nach ihm arbeitenden Holzschneider, wahrscheinlich unter dem
H W verbergen, die übrigen Zeichen aber werden wahrscheinlich diesen gehören.
Wie findet sich nun Büchner mit den fünf Signaturen ab? Verfügt er über die tieferen, außerhalb ihrer liegenden
Gründe, die ihm gestatten, gerade den nächsten Schluß nicht zu ziehen? Buchners erste Sorge ist, die Doppelsignatur
versehwinden zu machen. Wer immer sich auch als der Zeichner erwiese, der HW oder der Hbb, er muß weg: keinen
von beiden kann Büchner im Hinblick auf den noch verdeckten Trumpf, den Peter Zan, brauchen. »Es ist keineswegs
sicher«, sagt mein Kritiker, »ob (!) diese Buchstaben, die gerade wegen ihrer Größe sehr wohl inhaltliche Bedeutung
haben können, als Signaturen gedeutet werden dürfen«. »Die Bezeichnung HW«, fährt er fort, »kommt nur noch auf der
Lorenzmarter der Sanctorum Icones vor — diesmal ganz anspruchslos und klein«. Diese Kleinheit ist es offenbar, die
das HW von dem Gewichte inhaltlicher Bedeutung entlastet: diesmal ist es Signatur. Und da das HW der Offizien
inhaltliche Bedeutung hatte, kommt das HW als Signatur nur einmal vor. Zwei HW als Signaturen wären gefährlich,
mit einem wird man leichter fertig. »Das Vorkommen anderer Signaturen auf Holzschnitten des Petrarcameisters —
] B ...,('.. . — mindert den Wert der HW-Signatur erheblich. Gerade weil auf sämtlichen Straßburger Holz-
schnitten des Meisters dieses Zeichen fehlt, könnten mit größerer Wahrscheinlichkeit die Buchstaben als Signum
eines Augsburger Holzschneiders gedeutet werden« (S. 228). Und daß das HW einem Holzschneider gehöre, stand zu
beweisen.
Nun bestreite ich die inhaltliche Bedeutung der fünf Buchstaben auf jenem Offizienblatte. Da ich weiß, daß die
Erklärung von Buchstaben inhaltlicher Bedeutung auf alten Darstellungen zum all erschwersten gehört, wäre es unbillig,
von Buchner zum Beweise seiner Behauptung die Lösung zu fordern. Ich bestreite die inhaltliche Bedeutung der fünf
Buchstaben, weil ich sie als Signaturen erweisen kann. Man beachte doch: das Zeichen auf dem Schilde des Schiffes
lautet ja gar nicht Hbb, sondern HPP - - es ist in Spiegelschrift und kopfständig gegeben. Nur im Spiegel gelesen und
um 180 Grade gedreht erscheint die Ausbuchtung im Horizontalteile des H entsprechend der im Horizontalteile des H
im HW nach unten gerichtet und verlieren die dem H des Schildes folgenden beiden Zeichen die abnorme Buchstaben-
form, die sie als b gelesen besäßen, zugunsten einer normalen, die sie als P gelesen besitzen. Und wenn man mir
etwa sagt, es sei unwahrscheinlich, daß ein Formschneider bei der Anbringung seines Zeichens zu bedenken vergäße,
daß doch alles, was er schneidet, im Drucke gegenseitig erscheine, so erwidere ich, ohne auf die Häufigkeit derartiger
Versehen zu verweisen, daß der Mann, der immerfort sich gegenwärtig zu halten hat, daß jeder Zug seiner Hand erst
im Spiegelbild verständlieh wird, gar nicht der Formschneider ist, dem einfach zu schneiden obliegt, was auf dem
Stocke steht, sondern der zeichnende Künstler. In unserem besonderen Falle konnte der Formschneider um so eher die
im Schnitte gebotene Umkehrung seines Zeichens übersehen, als das Zeichen des Zeichners, das als HW im Drucke
erscheinen sollte, auch als WH, als das es der Schneider auf dem Stocke fand, zu seiner Lesbarkeit einer Umkehrung
gar nicht bedurfte. Was aber im vorliegenden Falle schon der Lapsus des Formschneiders anzunehmen gebietet, macht
das HW des Laurentius sicher, und damit ist der Versuch einer inhaltlichen Deutung der beiden Buchstabengruppen
überflüssig geworden. Nun erst wird auch das C des Sallustsehnittes zum unfraglichen Zeichen des Schneiders. Lediglich
das I B des Schwarzenberg bleibt als unerklärter Rückstand. Hier liegt tatsächlich ein weitaus verwickelterer Fall vor
als in den drei anderen Signaturen. Da die Namenteile des Petrarcameisters, wie wir vorerst annehmen müssen, mit H
und W anlauteten, könnte das I B nur auf den Schneider bezogen werden, legte nicht der besondere Tatbestand die
Möglichkeit derlntervention eines Dritten, oder, zählen wir den Schöpfer des Archetyps der Darstellung, Dürer, mit, eine^
Vierten nahe. Friedländer hat in seiner Arbeit »Georg Pentz, Jörg Bentz, der Meister J B« (Kep. NX 1897, Seite 132) mit
— 76
überwiegen, lasse ich dabei außeracht. Die Beteiligung einer dritten Person an der Darstellung anzunehmen, liegt vorerst
kein Anlaß vor. Der zweite signierte Schnitt des Petrarcameisters ist das C bezeichnete Bildchen fol. 5 v des von Jakob
Cammerlander in Straßburg 1534 gedruckten Sallust. Auch an diesem Blatte bezweifelt Buchner die Hand des Petrarca-
meisters nicht. Da Cammerlander als Holzschneider bezeugt ist, dürfte das (' signierte Bild auch von ihm geschnitten
worden sein. Dem dritten signierten Blatt des Petrarcameisters begegnen wir in dem Schnitte der Offizien, der mit H W
und H b b bezeichnet ist. Wenn ein Schnitt zwei Signaturen trägt, so ist die nächstliegende Annahme, von der man nur
nach Erweis ihrer Unmöglichkeit abzugehen pflegt, die, daß die eine Signatur dem Zeichner, die andere dem Schneider
"'ehöre. Die Erfahrung lehrt, daß dieser sein Zeichen mit Vorliebe auf einem Blatte anbringt, auf dem er bereits die
Marke des Zeichners vorfand. Welches von den beiden Zeichen eines so signierten Blattes dem erfindenden und welches
dem vervielfältigenden Künstler angehört, ist in der Kegel ohne weitere Hilfsmittel nicht zu entscheiden, es müßte denn
einer der beiden, gemeiniglich ist es der Schneider, sein besonderes Handwerk in der Signatur auch besonders gekenn-
zeichnet haben. Das tat, wie es scheint, der Formschneider in unserem Falle nicht. Die Unterscheidung zwischen Zeichner
und Schneider muß also von außen her veranlaßt werden, und das ist das Geschäft, das die Buchstaben H W auf dem
vierten signierten Blatte des Petrarcameisters, auf dem Lorenzschnitte der Sanctorum Icones zu besorgen haben. Durch
dessen Hinzutreten zu den drei anderen Blättern stellt sich die Sache so: da das Zeichen H W in zwei verschiedenen
Zyklen desselben Meisters, jedes andere Zeichen, das I B, das C und das H b b, aber nur einmal erscheint, wird sich
der Zeichner, der in der Regel häufiger signiert als die nach ihm arbeitenden Holzschneider, wahrscheinlich unter dem
H W verbergen, die übrigen Zeichen aber werden wahrscheinlich diesen gehören.
Wie findet sich nun Büchner mit den fünf Signaturen ab? Verfügt er über die tieferen, außerhalb ihrer liegenden
Gründe, die ihm gestatten, gerade den nächsten Schluß nicht zu ziehen? Buchners erste Sorge ist, die Doppelsignatur
versehwinden zu machen. Wer immer sich auch als der Zeichner erwiese, der HW oder der Hbb, er muß weg: keinen
von beiden kann Büchner im Hinblick auf den noch verdeckten Trumpf, den Peter Zan, brauchen. »Es ist keineswegs
sicher«, sagt mein Kritiker, »ob (!) diese Buchstaben, die gerade wegen ihrer Größe sehr wohl inhaltliche Bedeutung
haben können, als Signaturen gedeutet werden dürfen«. »Die Bezeichnung HW«, fährt er fort, »kommt nur noch auf der
Lorenzmarter der Sanctorum Icones vor — diesmal ganz anspruchslos und klein«. Diese Kleinheit ist es offenbar, die
das HW von dem Gewichte inhaltlicher Bedeutung entlastet: diesmal ist es Signatur. Und da das HW der Offizien
inhaltliche Bedeutung hatte, kommt das HW als Signatur nur einmal vor. Zwei HW als Signaturen wären gefährlich,
mit einem wird man leichter fertig. »Das Vorkommen anderer Signaturen auf Holzschnitten des Petrarcameisters —
] B ...,('.. . — mindert den Wert der HW-Signatur erheblich. Gerade weil auf sämtlichen Straßburger Holz-
schnitten des Meisters dieses Zeichen fehlt, könnten mit größerer Wahrscheinlichkeit die Buchstaben als Signum
eines Augsburger Holzschneiders gedeutet werden« (S. 228). Und daß das HW einem Holzschneider gehöre, stand zu
beweisen.
Nun bestreite ich die inhaltliche Bedeutung der fünf Buchstaben auf jenem Offizienblatte. Da ich weiß, daß die
Erklärung von Buchstaben inhaltlicher Bedeutung auf alten Darstellungen zum all erschwersten gehört, wäre es unbillig,
von Buchner zum Beweise seiner Behauptung die Lösung zu fordern. Ich bestreite die inhaltliche Bedeutung der fünf
Buchstaben, weil ich sie als Signaturen erweisen kann. Man beachte doch: das Zeichen auf dem Schilde des Schiffes
lautet ja gar nicht Hbb, sondern HPP - - es ist in Spiegelschrift und kopfständig gegeben. Nur im Spiegel gelesen und
um 180 Grade gedreht erscheint die Ausbuchtung im Horizontalteile des H entsprechend der im Horizontalteile des H
im HW nach unten gerichtet und verlieren die dem H des Schildes folgenden beiden Zeichen die abnorme Buchstaben-
form, die sie als b gelesen besäßen, zugunsten einer normalen, die sie als P gelesen besitzen. Und wenn man mir
etwa sagt, es sei unwahrscheinlich, daß ein Formschneider bei der Anbringung seines Zeichens zu bedenken vergäße,
daß doch alles, was er schneidet, im Drucke gegenseitig erscheine, so erwidere ich, ohne auf die Häufigkeit derartiger
Versehen zu verweisen, daß der Mann, der immerfort sich gegenwärtig zu halten hat, daß jeder Zug seiner Hand erst
im Spiegelbild verständlieh wird, gar nicht der Formschneider ist, dem einfach zu schneiden obliegt, was auf dem
Stocke steht, sondern der zeichnende Künstler. In unserem besonderen Falle konnte der Formschneider um so eher die
im Schnitte gebotene Umkehrung seines Zeichens übersehen, als das Zeichen des Zeichners, das als HW im Drucke
erscheinen sollte, auch als WH, als das es der Schneider auf dem Stocke fand, zu seiner Lesbarkeit einer Umkehrung
gar nicht bedurfte. Was aber im vorliegenden Falle schon der Lapsus des Formschneiders anzunehmen gebietet, macht
das HW des Laurentius sicher, und damit ist der Versuch einer inhaltlichen Deutung der beiden Buchstabengruppen
überflüssig geworden. Nun erst wird auch das C des Sallustsehnittes zum unfraglichen Zeichen des Schneiders. Lediglich
das I B des Schwarzenberg bleibt als unerklärter Rückstand. Hier liegt tatsächlich ein weitaus verwickelterer Fall vor
als in den drei anderen Signaturen. Da die Namenteile des Petrarcameisters, wie wir vorerst annehmen müssen, mit H
und W anlauteten, könnte das I B nur auf den Schneider bezogen werden, legte nicht der besondere Tatbestand die
Möglichkeit derlntervention eines Dritten, oder, zählen wir den Schöpfer des Archetyps der Darstellung, Dürer, mit, eine^
Vierten nahe. Friedländer hat in seiner Arbeit »Georg Pentz, Jörg Bentz, der Meister J B« (Kep. NX 1897, Seite 132) mit
— 76