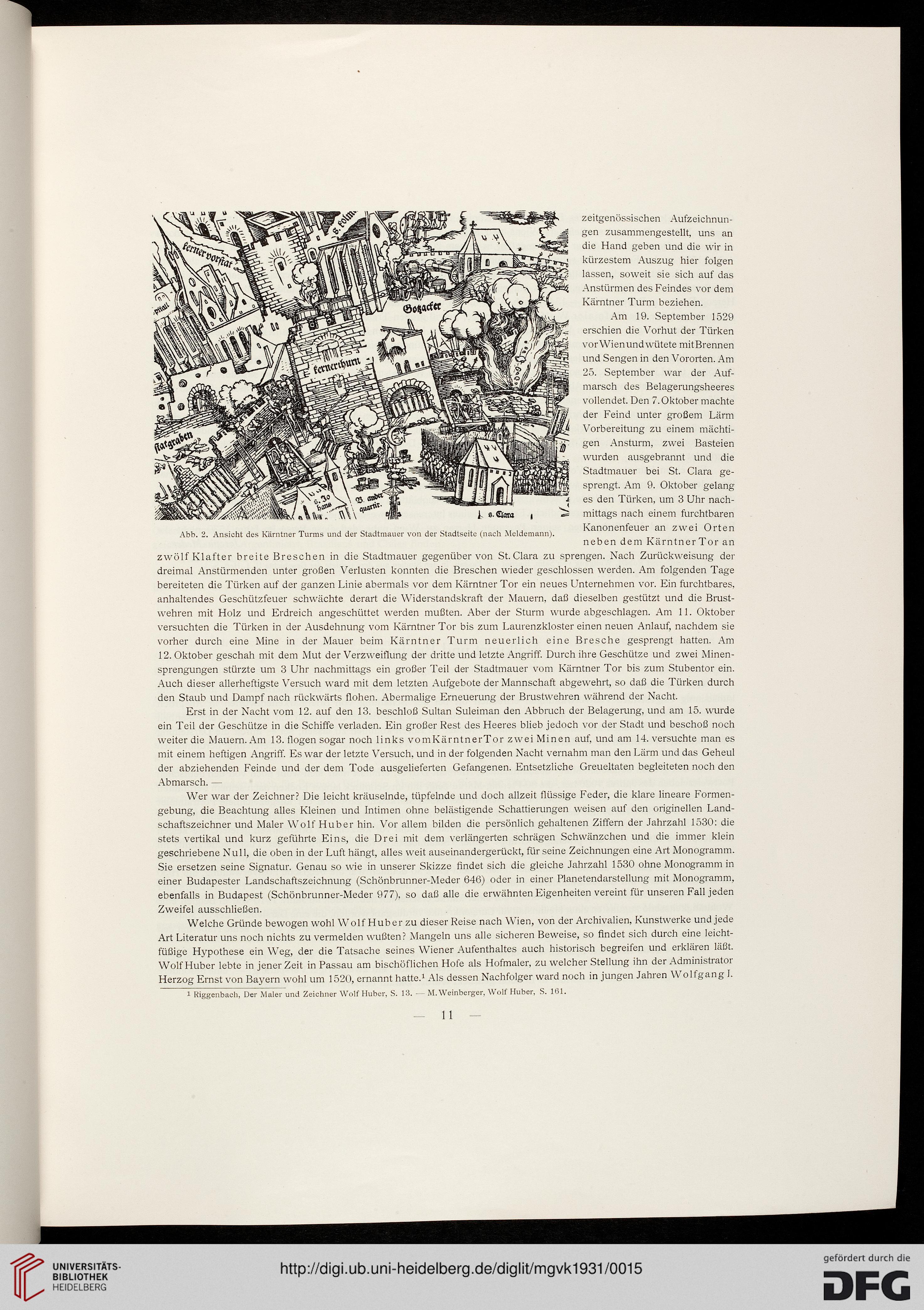zeitgenössischen Aufzeichnun-
gen zusammengestellt, uns an
die Hand geben und die wir in
kürzestem Auszug hier folgen
lassen, soweit sie sich auf das
Anstürmen des Feindes vor dem
Kärntner Turm beziehen.
Am 19. September 1529
erschien die Vorhut der Türken
vorWienundwütete mitBrennen
und Sengen in den Vororten. Am
25. September war der Auf-
marsch des Belagerungsheeres
vollendet. Den 7. Oktober machte
der Feind unter großem Lärm
Vorbereitung zu einem mächti-
gen Ansturm, zwei Basteien
wurden ausgebrannt und die
Stadtmauer bei St. Clara ge-
sprengt. Am 9. Oktober gelang
es den Türken, um 3 Uhr nach-
mittags nach einem furchtbaren
Kanonenfeuer an zwei Orten
neben dem KärntnerTor an
Abb. 2. Ansicht des Kärntner Turms und der Stadtmauer von der Stadtseite (nach Meldemann).
zwölf Klafter breite Breschen in die Stadtmauer gegenüber von St. Clara zu sprengen. Nach Zurückweisung der
dreimal Anstürmenden unter großen Verlusten konnten die Breschen wieder geschlossen werden. Am folgenden Tage
bereiteten die Türken auf der ganzen Linie abermals vor dem KärntnerTor ein neues Unternehmen vor. Ein furchtbares,
anhaltendes Geschützfeuer schwächte derart die Widerstandskraft der Mauern, daß dieselben gestützt und die Brust-
wehren mit Holz und Erdreich angeschüttet werden mußten. Aber der Sturm wurde abgeschlagen. Am 11. Oktober
versuchten die Türken in der Ausdehnung vom Kärntner Tor bis zum Laurenzkloster einen neuen Anlauf, nachdem sie
vorher durch eine Mine in der Mauer beim Kärntner Turm neuerlich eine Bresche gesprengt hatten. Am
12. Oktober geschah mit dem Mut der Verzweiflung der dritte und letzte Angriff. Durch ihre Geschütze und zwei Minen-
sprengungen stürzte um 3 Uhr nachmittags ein großer Teil der Stadtmauer vom Kärntner Tor bis zum Stubentor ein.
Auch dieser allerheftigste Versuch ward mit dem letzten Aufgebote der Mannschaft abgewehrt, so daß die Türken durch
den Staub und Dampf nach rückwärts flohen. Abermalige Erneuerung der Brustwehren während der Nacht.
Erst in der Nacht vom 12. auf den 13. beschloß Sultan Suleiman den Abbruch der Belagerung, und am 15. wurde
ein Teil der Geschütze in die Schiffe verladen. Ein großer Rest des Heeres blieb jedoch vor der Stadt und beschoß noch
weiter die Mauern. Am 13. flogen sogar noch links vomKärntnerTor zwei Minen auf, und am 14. versuchte man es
mit einem heftigen Angriff. Es war der letzte Versuch, und in der folgenden Nacht vernahm man den Lärm und das Geheul
der abziehenden Feinde und der dem Tode ausgelieferten Gefangenen. Entsetzliche Greueltaten begleiteten noch den
Abmarsch. —
Wer war der Zeichner? Die leicht kräuselnde, tüpfelnde und doch allzeit flüssige Feder, die klare lineare Formen-
gebung, die Beachtung alles Kleinen und Intimen ohne belästigende Schattierungen weisen auf den originellen Land-
schaftszeichner und Maler Wolf Huber hin. Vor allem bilden die persönlich gehaltenen Ziffern der Jahrzahl 1530: die
stets vertikal und kurz geführte Eins, die Drei mit dem verlängerten schrägen Schwänzchen und die immer klein
geschriebene Null, die oben in der Luft hängt, alles weit auseinandergerückt, für seine Zeichnungen eine Art Monogramm.
Sie ersetzen seine Signatur. Genau so wie in unserer Skizze findet sich die gleiche Jahrzahl 1530 ohne Monogramm in
einer Budapester Landschaftszeichnung (Schönbrunner-Meder 646) oder in einer Planetendarstellung mit Monogramm,
ebenfalls in Budapest (Schönbrunner-Meder 977), so daß alle die erwähnten Eigenheiten vereint für unseren Fall jeden
Zweifel ausschließen.
Welche Gründe bewogen wohl WolfHuberzu dieser Reise nach Wien, von der Archivalien, Kunstwerke und jede
Art Literatur uns noch nichts zu vermelden wußten? Mangeln uns alle sicheren Beweise, so findet sich durch eine leicht-
füßige Hypothese ein Weg, der die Tatsache seines Wiener Aufenthaltes auch historisch begreifen und erklären läßt.
Wolf Huber lebte in jener Zeit in Passau am bischöflichen Hofe als Hofmaler, zu welcher Stellung ihn der Administrator
Herzog Ernst von Bayern wohl um 1520, ernannt hatte.1 Als dessen Nachfolger ward noch in jungen Jahren Wolfgang J.
1 Riggenbach, Der Maler und Zeichner Wolf Huber, S. 13. — M. Weinberger, Wolf Huber, S. 161.
gen zusammengestellt, uns an
die Hand geben und die wir in
kürzestem Auszug hier folgen
lassen, soweit sie sich auf das
Anstürmen des Feindes vor dem
Kärntner Turm beziehen.
Am 19. September 1529
erschien die Vorhut der Türken
vorWienundwütete mitBrennen
und Sengen in den Vororten. Am
25. September war der Auf-
marsch des Belagerungsheeres
vollendet. Den 7. Oktober machte
der Feind unter großem Lärm
Vorbereitung zu einem mächti-
gen Ansturm, zwei Basteien
wurden ausgebrannt und die
Stadtmauer bei St. Clara ge-
sprengt. Am 9. Oktober gelang
es den Türken, um 3 Uhr nach-
mittags nach einem furchtbaren
Kanonenfeuer an zwei Orten
neben dem KärntnerTor an
Abb. 2. Ansicht des Kärntner Turms und der Stadtmauer von der Stadtseite (nach Meldemann).
zwölf Klafter breite Breschen in die Stadtmauer gegenüber von St. Clara zu sprengen. Nach Zurückweisung der
dreimal Anstürmenden unter großen Verlusten konnten die Breschen wieder geschlossen werden. Am folgenden Tage
bereiteten die Türken auf der ganzen Linie abermals vor dem KärntnerTor ein neues Unternehmen vor. Ein furchtbares,
anhaltendes Geschützfeuer schwächte derart die Widerstandskraft der Mauern, daß dieselben gestützt und die Brust-
wehren mit Holz und Erdreich angeschüttet werden mußten. Aber der Sturm wurde abgeschlagen. Am 11. Oktober
versuchten die Türken in der Ausdehnung vom Kärntner Tor bis zum Laurenzkloster einen neuen Anlauf, nachdem sie
vorher durch eine Mine in der Mauer beim Kärntner Turm neuerlich eine Bresche gesprengt hatten. Am
12. Oktober geschah mit dem Mut der Verzweiflung der dritte und letzte Angriff. Durch ihre Geschütze und zwei Minen-
sprengungen stürzte um 3 Uhr nachmittags ein großer Teil der Stadtmauer vom Kärntner Tor bis zum Stubentor ein.
Auch dieser allerheftigste Versuch ward mit dem letzten Aufgebote der Mannschaft abgewehrt, so daß die Türken durch
den Staub und Dampf nach rückwärts flohen. Abermalige Erneuerung der Brustwehren während der Nacht.
Erst in der Nacht vom 12. auf den 13. beschloß Sultan Suleiman den Abbruch der Belagerung, und am 15. wurde
ein Teil der Geschütze in die Schiffe verladen. Ein großer Rest des Heeres blieb jedoch vor der Stadt und beschoß noch
weiter die Mauern. Am 13. flogen sogar noch links vomKärntnerTor zwei Minen auf, und am 14. versuchte man es
mit einem heftigen Angriff. Es war der letzte Versuch, und in der folgenden Nacht vernahm man den Lärm und das Geheul
der abziehenden Feinde und der dem Tode ausgelieferten Gefangenen. Entsetzliche Greueltaten begleiteten noch den
Abmarsch. —
Wer war der Zeichner? Die leicht kräuselnde, tüpfelnde und doch allzeit flüssige Feder, die klare lineare Formen-
gebung, die Beachtung alles Kleinen und Intimen ohne belästigende Schattierungen weisen auf den originellen Land-
schaftszeichner und Maler Wolf Huber hin. Vor allem bilden die persönlich gehaltenen Ziffern der Jahrzahl 1530: die
stets vertikal und kurz geführte Eins, die Drei mit dem verlängerten schrägen Schwänzchen und die immer klein
geschriebene Null, die oben in der Luft hängt, alles weit auseinandergerückt, für seine Zeichnungen eine Art Monogramm.
Sie ersetzen seine Signatur. Genau so wie in unserer Skizze findet sich die gleiche Jahrzahl 1530 ohne Monogramm in
einer Budapester Landschaftszeichnung (Schönbrunner-Meder 646) oder in einer Planetendarstellung mit Monogramm,
ebenfalls in Budapest (Schönbrunner-Meder 977), so daß alle die erwähnten Eigenheiten vereint für unseren Fall jeden
Zweifel ausschließen.
Welche Gründe bewogen wohl WolfHuberzu dieser Reise nach Wien, von der Archivalien, Kunstwerke und jede
Art Literatur uns noch nichts zu vermelden wußten? Mangeln uns alle sicheren Beweise, so findet sich durch eine leicht-
füßige Hypothese ein Weg, der die Tatsache seines Wiener Aufenthaltes auch historisch begreifen und erklären läßt.
Wolf Huber lebte in jener Zeit in Passau am bischöflichen Hofe als Hofmaler, zu welcher Stellung ihn der Administrator
Herzog Ernst von Bayern wohl um 1520, ernannt hatte.1 Als dessen Nachfolger ward noch in jungen Jahren Wolfgang J.
1 Riggenbach, Der Maler und Zeichner Wolf Huber, S. 13. — M. Weinberger, Wolf Huber, S. 161.