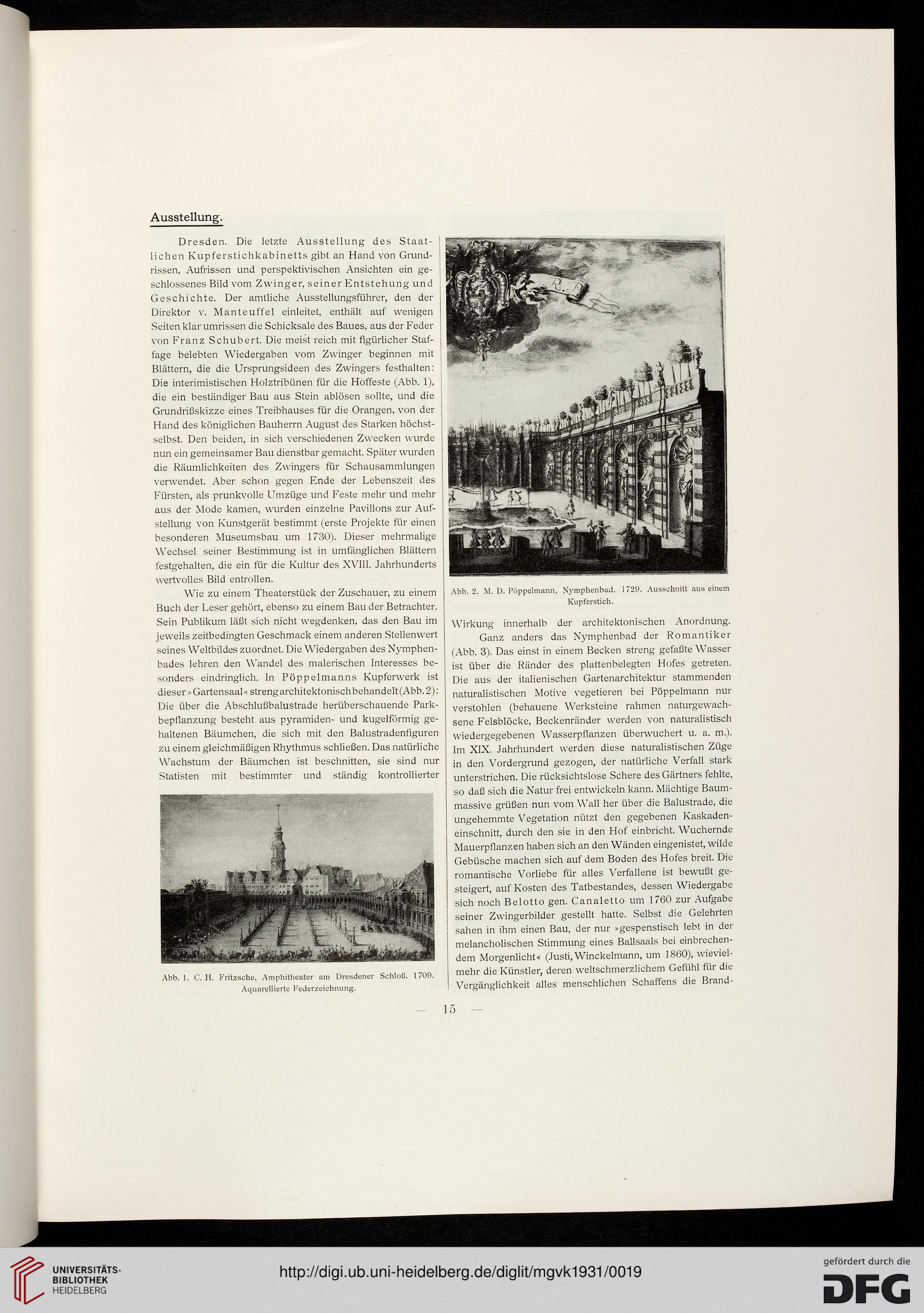Ausstellung.
Dresden. Die letzte Ausstellung des Staat-
lichen Kupferstichkabinetts gibt an Hand von Grund-
rissen, Aufrissen und perspektivischen Ansichten ein ge-
schlossenes Bild vom Zwinger, seiner Entstehung und
Geschichte. Der amtliche Ausstellungsführer, den der
Direktor v. Manteuffel einleitet, enthält auf wenigen
Seiten klar umrissen die Schicksale des Baues, aus der Feder
von Franz Schubert. Die meist reich mit figürlicher Staf-
fage belebten Wiedergaben vom Zwinger beginnen mit
Blättern, die die Ursprungsideen des Zwingers festhalten:
Die interimistischen Holztribünen für die Hoffeste (Abb. 1),
die ein beständiger Bau aus Stein ablösen sollte, und die
Grundrißskizze eines Treibhauses für die Orangen, von der
Hand des königlichen Bauherrn August des Starken höchst-
selbst. Den beiden, in sich verschiedenen Zwecken wurde
nun ein gemeinsamer Bau dienstbar gemacht. Später wurden
die Räumlichkeiten des Zwingers für Schausammlungen
verwendet. Aber schon gegen Ende der Lebenszeit des
Fürsten, als prunkvolle Umzüge und Feste mehr und mehr
aus der Mode kamen, wurden einzelne Pavillons zur Auf-
stellung von Kunstgerät bestimmt (erste Projekte für einen
besonderen Museumsbau um 1730). Dieser mehrmalige
Wechsel seiner Bestimmung ist in umfänglichen Blättern
festgehalten, die ein für die Kultur des XVIII. Jahrhunderts
wertvolles Bild entrollen.
Wie zu einem Theaterstück der Zuschauer, zu einem
Buch der Leser gehört, ebenso zu einem Bau der Betrachter.
Sein Publikum läßt sich nicht wegdenken, das den Bau im
jeweils zeitbedingten Geschmack einem anderen Stellenwert
seines Weltbildes zuordnet. Die Wiedergaben des Nymphen-
bades lehren den Wandel des malerischen Interesses be-
sonders eindringlich. In Pöppelmanns Kupferwerk ist
dieser » Gartensaal« strengarchitektonisch behandelt (Abb. 2):
Die über die Abschlußbalustrade herüberschauende Park-
bepflanzung besteht aus pyramiden- und kugelförmig ge-
haltenen Bäumchen, die sich mit den Balustradenfiguren
zu einem gleichmäßigen Rhythmus schließen. Das natürliche
Wachstum der Bäumchen ist beschnitten, sie sind nur
Statisten mit bestimmter und ständig kontrollierter
Abb. 1. C. H. Fritzsche, Amphitheater am Dresdener Schloß. 1709.
Aquarellierte Federzeichnung.
Abb. 2. M. D. Pöppelmann, Nymphenbad. 1729. Ausschnitt aus einem
Kupferstich.
Wirkung innerhalb der architektonischen Anordnung.
Ganz anders das Nymphenbad der Romantiker
(Abb. 3). Das einst in einem Becken streng gefaßte Wasser
ist über die Ränder des plattenbelegten Hofes getreten.
Die aus der italienischen Gartenarchitektur stammenden
naturalistischen Motive vegetieren bei Pöppelmann nur
verstohlen (behauene Werksteine rahmen naturgewach-
sene Felsblöcke, Beckenränder werden von naturalistisch
wiedergegebenen Wasserpflanzen überwuchert u. a. m.).
Im XIX. Jahrhundert werden diese naturalistischen Züge
in den Vordergrund gezogen, der natürliche Verfall stark
unterstrichen. Die rücksichtslose Schere des Gärtners fehlte,
so daß sich die Natur frei entwickeln kann. Mächtige Baum-
massive grüßen nun vom Wall her über die Balustrade, die
ungehemmte Vegetation nützt den gegebenen Kaskaden-
einschnitt, durch den sie in den Hof einbricht. Wuchernde
Mauerpflanzen haben sich an den Wänden eingenistet, wilde
Gebüsche machen sich auf dem Boden des Hofes breit. Diu
romantische Vorliebe für alles Verfallene ist bewußt ge-
steigert, auf Kosten des Tatbestandes, dessen Wiedergabe
sich noch Beiotto gen. Canaletto um 1760 zur Aufgabe
seiner Zwingerbilder gestellt hatte. Selbst die Gelehrten
sahen in ihm einen Bau, der nur »gespenstisch lebt in der
melancholischen Stimmung eines Ballsaals bei einbrechen-
dem Morgenlicht« (Justi, Winckelmann, um 1860), wieviel-
mehr die Künstler, deren weltschmerzlichem Gefühl für die
Vergänglichkeit alles menschlichen Schaffens die Brand-
is
Dresden. Die letzte Ausstellung des Staat-
lichen Kupferstichkabinetts gibt an Hand von Grund-
rissen, Aufrissen und perspektivischen Ansichten ein ge-
schlossenes Bild vom Zwinger, seiner Entstehung und
Geschichte. Der amtliche Ausstellungsführer, den der
Direktor v. Manteuffel einleitet, enthält auf wenigen
Seiten klar umrissen die Schicksale des Baues, aus der Feder
von Franz Schubert. Die meist reich mit figürlicher Staf-
fage belebten Wiedergaben vom Zwinger beginnen mit
Blättern, die die Ursprungsideen des Zwingers festhalten:
Die interimistischen Holztribünen für die Hoffeste (Abb. 1),
die ein beständiger Bau aus Stein ablösen sollte, und die
Grundrißskizze eines Treibhauses für die Orangen, von der
Hand des königlichen Bauherrn August des Starken höchst-
selbst. Den beiden, in sich verschiedenen Zwecken wurde
nun ein gemeinsamer Bau dienstbar gemacht. Später wurden
die Räumlichkeiten des Zwingers für Schausammlungen
verwendet. Aber schon gegen Ende der Lebenszeit des
Fürsten, als prunkvolle Umzüge und Feste mehr und mehr
aus der Mode kamen, wurden einzelne Pavillons zur Auf-
stellung von Kunstgerät bestimmt (erste Projekte für einen
besonderen Museumsbau um 1730). Dieser mehrmalige
Wechsel seiner Bestimmung ist in umfänglichen Blättern
festgehalten, die ein für die Kultur des XVIII. Jahrhunderts
wertvolles Bild entrollen.
Wie zu einem Theaterstück der Zuschauer, zu einem
Buch der Leser gehört, ebenso zu einem Bau der Betrachter.
Sein Publikum läßt sich nicht wegdenken, das den Bau im
jeweils zeitbedingten Geschmack einem anderen Stellenwert
seines Weltbildes zuordnet. Die Wiedergaben des Nymphen-
bades lehren den Wandel des malerischen Interesses be-
sonders eindringlich. In Pöppelmanns Kupferwerk ist
dieser » Gartensaal« strengarchitektonisch behandelt (Abb. 2):
Die über die Abschlußbalustrade herüberschauende Park-
bepflanzung besteht aus pyramiden- und kugelförmig ge-
haltenen Bäumchen, die sich mit den Balustradenfiguren
zu einem gleichmäßigen Rhythmus schließen. Das natürliche
Wachstum der Bäumchen ist beschnitten, sie sind nur
Statisten mit bestimmter und ständig kontrollierter
Abb. 1. C. H. Fritzsche, Amphitheater am Dresdener Schloß. 1709.
Aquarellierte Federzeichnung.
Abb. 2. M. D. Pöppelmann, Nymphenbad. 1729. Ausschnitt aus einem
Kupferstich.
Wirkung innerhalb der architektonischen Anordnung.
Ganz anders das Nymphenbad der Romantiker
(Abb. 3). Das einst in einem Becken streng gefaßte Wasser
ist über die Ränder des plattenbelegten Hofes getreten.
Die aus der italienischen Gartenarchitektur stammenden
naturalistischen Motive vegetieren bei Pöppelmann nur
verstohlen (behauene Werksteine rahmen naturgewach-
sene Felsblöcke, Beckenränder werden von naturalistisch
wiedergegebenen Wasserpflanzen überwuchert u. a. m.).
Im XIX. Jahrhundert werden diese naturalistischen Züge
in den Vordergrund gezogen, der natürliche Verfall stark
unterstrichen. Die rücksichtslose Schere des Gärtners fehlte,
so daß sich die Natur frei entwickeln kann. Mächtige Baum-
massive grüßen nun vom Wall her über die Balustrade, die
ungehemmte Vegetation nützt den gegebenen Kaskaden-
einschnitt, durch den sie in den Hof einbricht. Wuchernde
Mauerpflanzen haben sich an den Wänden eingenistet, wilde
Gebüsche machen sich auf dem Boden des Hofes breit. Diu
romantische Vorliebe für alles Verfallene ist bewußt ge-
steigert, auf Kosten des Tatbestandes, dessen Wiedergabe
sich noch Beiotto gen. Canaletto um 1760 zur Aufgabe
seiner Zwingerbilder gestellt hatte. Selbst die Gelehrten
sahen in ihm einen Bau, der nur »gespenstisch lebt in der
melancholischen Stimmung eines Ballsaals bei einbrechen-
dem Morgenlicht« (Justi, Winckelmann, um 1860), wieviel-
mehr die Künstler, deren weltschmerzlichem Gefühl für die
Vergänglichkeit alles menschlichen Schaffens die Brand-
is