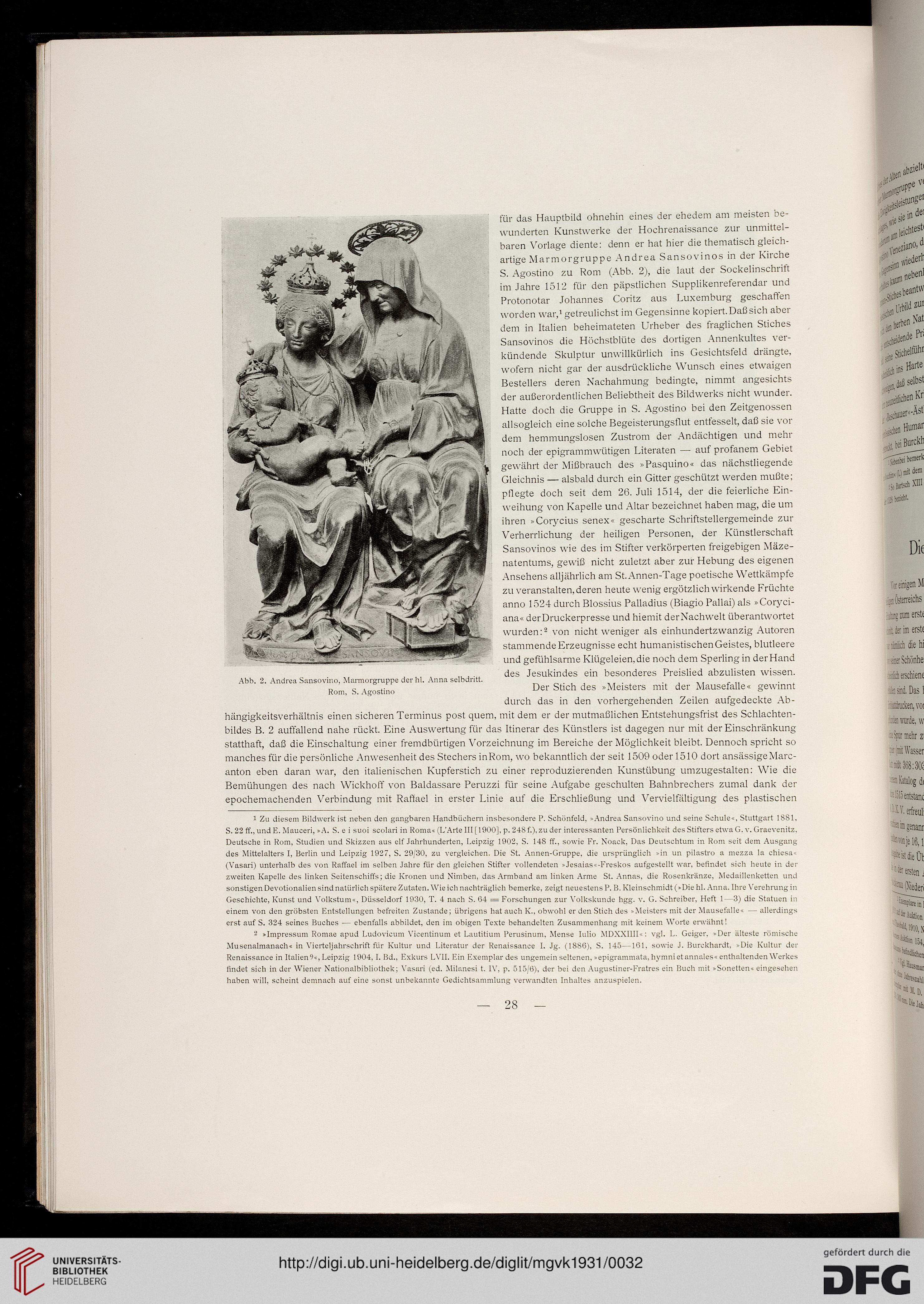für das Hauptbild ohnehin eines der ehedem am meisten be-
wunderten Kunstwerke der Hochrenaissance zur unmittel-
baren Vorlage diente: denn er hat hier die thematisch gleich-
artige .Marmorgruppe Andrea Sansovinos in der Kirche
S. Agostino zu Rom (Abb. 2), die laut der Sockelinschrift
im Jahre 1512 für den papstlichen Supplikenreferendar und
Protonotar Johannes Coritz aus Luxemburg geschaffen
worden war,1 getreulichst im Gegensinne kopiert. Daß sich aber
dem in Italien beheimateten Urheber des fraglichen Stiches
Sansovinos die Höchstblüte des dortigen Annenkultes ver-
kündende Skulptur unwillkürlich ins Gesichtsfeld drängte,
wofern nicht gar der ausdrückliche Wunsch eines etwaigen
Bestellers deren Nachahmung bedingte, nimmt angesichts
der außerordentlichen Beliebtheit des Bildwerks nicht wunder.
Hatte doch die Gruppe in S. Agostino bei den Zeitgenossen
allsogleich eine solche Begeisterungsflut entfesselt, daß sie vor
dem hemmungslosen Zustrom der Andächtigen und mehr
noch der epigrammwütigen Literaten — auf profanem Gebiet
gewährt der Mißbrauch des »Pasquino« das nächstliegende
Gleichnis — alsbald durch ein Gitter geschützt werden mußte:
pflegte doch seit dem 26. Juli 1514, der die feierliche Ein-
weihung von Kapelle und Altar bezeichnet haben mag, die um
ihren »Corycius senex« gescharte Schriftstellergemeinde zur
Verherrlichung der heiligen Personen, der Künstlerschaft
Sansovinos wie des im Stifter verkörperten freigebigen Mäze-
natentums, gewiß nicht zuletzt aber zur Hebung des eigenen
Ansehens alljährlich am St. Annen-Tage poetische Wettkämpfe
zu veranstalten, deren heute wenig ergötzlich wirkende Früchte
anno 1524 durch Blossius Palladius (Biagio Pallai) als »Coryci-
ana« derDruckerpresse und hiemit derNachwelt überantwortet
wurden:2 von nicht weniger als einhundertzwanzig Autoren
stammende Erzeugnisse echt humanistischen Geistes, blutleere
und gefühlsarme Klügeleien, die noch dem Sperling in der Hand
des Jesukindes ein besonderes Preislied abzulisten wissen.
Der Stich des »Meisters mit der Mausefalle« gewinnt
durch das in den vorhergehenden Zeilen aufgedeckte Ab-
hängigkeitsverhältnis einen sicheren Terminus post quem, mit dem er der mutmaßlichen Entstehungsfrist des Schlachten-
bildes B. 2 auffallend nahe rückt. Eine Auswertung für das Itinerar des Künstlers ist dagegen nur mit der Einschränkung
statthaft, daß die Einschaltung einer fremdbürtigen Vorzeichnung im Bereiche der Möglichkeit bleibt. Dennoch spricht so
manches für die persönliche Anwesenheit des Stechers in Rom, wo bekanntlich der seit 1509 oder 1510 dort ansässige Marc-
anton eben daran war, den italienischen Kupferstich zu einer reproduzierenden Kunstübung umzugestalten: Wie die
Bemühungen des nach Wickhoff von Baldassare Peruzzi für seine Aufgabe geschulten Bahnbrechers zumal dank der
epochemachenden Verbindung mit Raffael in erster Linie auf die Erschließung und Vervielfältigung des plastischen
1 Zu diesem Bildwerk ist neben den gangbaren Handbüchern insbesondere P. Schünfeld, -Andrea Sansovino und seine Schule«. Stuttgart 1881,
S. 22 ff., und E. Mauceri, > A. S. e i suoi Scolari in Roma« (L'Arte III [ 1900], p. 248 f.). zu der interessanten Persönlichkeit des Stifters etwa G. v. Graevenitz.
Deutsche in Rom, Studien und Skizzen aus elf Jahrhunderten, Leipzig 1902, S. 148 ff., sowie Fr. Noack. Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang
des Mittelalters I, Berlin und Leipzig 1927. S. 29/30, zu vergleichen. Die St. Annen-Gruppe, die ursprünglich »in un pilaslro a mezza la chiesa«
(Vasari) unterhalb des von Raffael im selben Jahre für den gleichen Stifter vollendeten »Jesaias«-Freskos aufgestellt war, befindet sich heute in der
zweiten Kapelle des linken Seitenschiffs; die Kronen und Nimben, das Armband am linken Arme St. Annas, die Rosenkränze, Medaillenketten und
sonstigen Devotionalien sind natürlich spätere Zutaten. Wie ich nachträglich bemerke, zeigt neuestens P. B. Kleinschmidt (»Die hl. Anna. Ihre Verehrung in
Geschichte, Kunst und Volkstum«, Düsseldorf 1930, T. 4 nach S. 64 = Forschungen zur Volkskunde hgg. v. G. Schreiber, Heft 1—3) die Statuen in
einem von den gröbsten Entstellungen befreiten Zustande; übrigens hat auch K.. obwohl er den Stich des »Meisters mit der Mausefalle« — allerdings
erst auf S. 324 seines Buches — ebenfalls abbildet, den im obigen Texte behandelten Zusammenhang mit keinem Worte erwähnt!
2 »Impressum Romae apud Ludovicum Vicentinum et Lautitium Perusinum. Mense lulio MDXXIIII«: vgl. L. Geiger. »Der älteste römische
Musenalmanach« in Vierteljahrschrift für Kultur und Literatur der Renaissance I. Jg. (1886), S. 145—161, sowie J. Burckhardt. »Die Kultur der
Renaissance in Italien?«, Leipzig 1904,1. Bd., Exkurs LVII. Ein Exemplar des ungemein seltenen, »epigrammata. hymnietannales« enthaltenden Werkes
findet sich in der Wiener Nationalbibliothek; Vasari (ed. Milanesi t. IV. p. 515/6), der bei den Augustiner-Fratres ein Buch mit »Sonetten, eingesehen
haben will, scheint demnach auf eine sonst unbekannte Gedichtsammlung verwandten Inhaltes anzuspielen.
Andrea Sansovino. Marmorgruppe der hl. Anna selbdritt.
Rom, S. Agostino
— 28 —
wunderten Kunstwerke der Hochrenaissance zur unmittel-
baren Vorlage diente: denn er hat hier die thematisch gleich-
artige .Marmorgruppe Andrea Sansovinos in der Kirche
S. Agostino zu Rom (Abb. 2), die laut der Sockelinschrift
im Jahre 1512 für den papstlichen Supplikenreferendar und
Protonotar Johannes Coritz aus Luxemburg geschaffen
worden war,1 getreulichst im Gegensinne kopiert. Daß sich aber
dem in Italien beheimateten Urheber des fraglichen Stiches
Sansovinos die Höchstblüte des dortigen Annenkultes ver-
kündende Skulptur unwillkürlich ins Gesichtsfeld drängte,
wofern nicht gar der ausdrückliche Wunsch eines etwaigen
Bestellers deren Nachahmung bedingte, nimmt angesichts
der außerordentlichen Beliebtheit des Bildwerks nicht wunder.
Hatte doch die Gruppe in S. Agostino bei den Zeitgenossen
allsogleich eine solche Begeisterungsflut entfesselt, daß sie vor
dem hemmungslosen Zustrom der Andächtigen und mehr
noch der epigrammwütigen Literaten — auf profanem Gebiet
gewährt der Mißbrauch des »Pasquino« das nächstliegende
Gleichnis — alsbald durch ein Gitter geschützt werden mußte:
pflegte doch seit dem 26. Juli 1514, der die feierliche Ein-
weihung von Kapelle und Altar bezeichnet haben mag, die um
ihren »Corycius senex« gescharte Schriftstellergemeinde zur
Verherrlichung der heiligen Personen, der Künstlerschaft
Sansovinos wie des im Stifter verkörperten freigebigen Mäze-
natentums, gewiß nicht zuletzt aber zur Hebung des eigenen
Ansehens alljährlich am St. Annen-Tage poetische Wettkämpfe
zu veranstalten, deren heute wenig ergötzlich wirkende Früchte
anno 1524 durch Blossius Palladius (Biagio Pallai) als »Coryci-
ana« derDruckerpresse und hiemit derNachwelt überantwortet
wurden:2 von nicht weniger als einhundertzwanzig Autoren
stammende Erzeugnisse echt humanistischen Geistes, blutleere
und gefühlsarme Klügeleien, die noch dem Sperling in der Hand
des Jesukindes ein besonderes Preislied abzulisten wissen.
Der Stich des »Meisters mit der Mausefalle« gewinnt
durch das in den vorhergehenden Zeilen aufgedeckte Ab-
hängigkeitsverhältnis einen sicheren Terminus post quem, mit dem er der mutmaßlichen Entstehungsfrist des Schlachten-
bildes B. 2 auffallend nahe rückt. Eine Auswertung für das Itinerar des Künstlers ist dagegen nur mit der Einschränkung
statthaft, daß die Einschaltung einer fremdbürtigen Vorzeichnung im Bereiche der Möglichkeit bleibt. Dennoch spricht so
manches für die persönliche Anwesenheit des Stechers in Rom, wo bekanntlich der seit 1509 oder 1510 dort ansässige Marc-
anton eben daran war, den italienischen Kupferstich zu einer reproduzierenden Kunstübung umzugestalten: Wie die
Bemühungen des nach Wickhoff von Baldassare Peruzzi für seine Aufgabe geschulten Bahnbrechers zumal dank der
epochemachenden Verbindung mit Raffael in erster Linie auf die Erschließung und Vervielfältigung des plastischen
1 Zu diesem Bildwerk ist neben den gangbaren Handbüchern insbesondere P. Schünfeld, -Andrea Sansovino und seine Schule«. Stuttgart 1881,
S. 22 ff., und E. Mauceri, > A. S. e i suoi Scolari in Roma« (L'Arte III [ 1900], p. 248 f.). zu der interessanten Persönlichkeit des Stifters etwa G. v. Graevenitz.
Deutsche in Rom, Studien und Skizzen aus elf Jahrhunderten, Leipzig 1902, S. 148 ff., sowie Fr. Noack. Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang
des Mittelalters I, Berlin und Leipzig 1927. S. 29/30, zu vergleichen. Die St. Annen-Gruppe, die ursprünglich »in un pilaslro a mezza la chiesa«
(Vasari) unterhalb des von Raffael im selben Jahre für den gleichen Stifter vollendeten »Jesaias«-Freskos aufgestellt war, befindet sich heute in der
zweiten Kapelle des linken Seitenschiffs; die Kronen und Nimben, das Armband am linken Arme St. Annas, die Rosenkränze, Medaillenketten und
sonstigen Devotionalien sind natürlich spätere Zutaten. Wie ich nachträglich bemerke, zeigt neuestens P. B. Kleinschmidt (»Die hl. Anna. Ihre Verehrung in
Geschichte, Kunst und Volkstum«, Düsseldorf 1930, T. 4 nach S. 64 = Forschungen zur Volkskunde hgg. v. G. Schreiber, Heft 1—3) die Statuen in
einem von den gröbsten Entstellungen befreiten Zustande; übrigens hat auch K.. obwohl er den Stich des »Meisters mit der Mausefalle« — allerdings
erst auf S. 324 seines Buches — ebenfalls abbildet, den im obigen Texte behandelten Zusammenhang mit keinem Worte erwähnt!
2 »Impressum Romae apud Ludovicum Vicentinum et Lautitium Perusinum. Mense lulio MDXXIIII«: vgl. L. Geiger. »Der älteste römische
Musenalmanach« in Vierteljahrschrift für Kultur und Literatur der Renaissance I. Jg. (1886), S. 145—161, sowie J. Burckhardt. »Die Kultur der
Renaissance in Italien?«, Leipzig 1904,1. Bd., Exkurs LVII. Ein Exemplar des ungemein seltenen, »epigrammata. hymnietannales« enthaltenden Werkes
findet sich in der Wiener Nationalbibliothek; Vasari (ed. Milanesi t. IV. p. 515/6), der bei den Augustiner-Fratres ein Buch mit »Sonetten, eingesehen
haben will, scheint demnach auf eine sonst unbekannte Gedichtsammlung verwandten Inhaltes anzuspielen.
Andrea Sansovino. Marmorgruppe der hl. Anna selbdritt.
Rom, S. Agostino
— 28 —