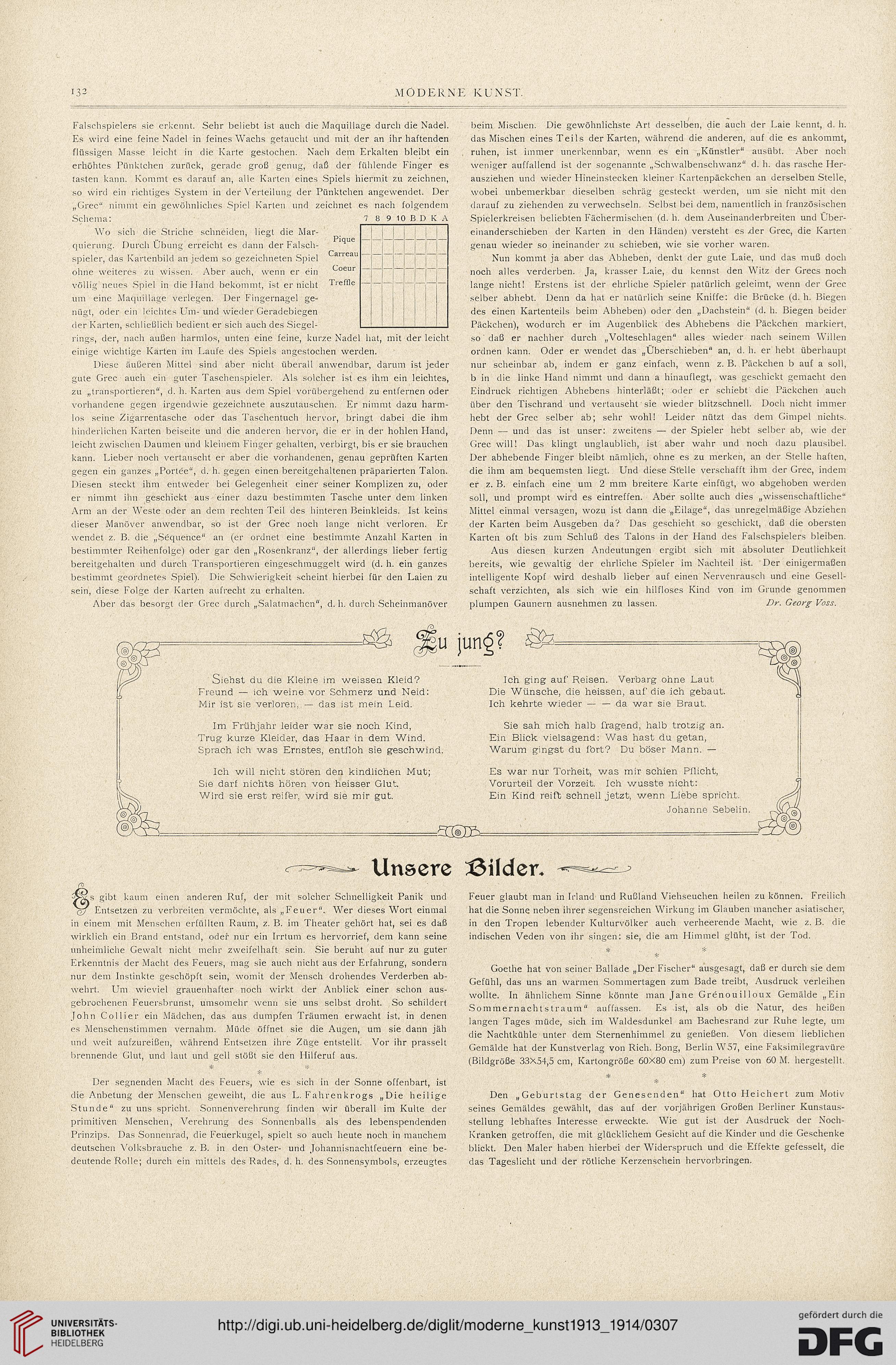132
MODERNE KUNST.
7 8 9 10 B D IC A
Falschspielers sie erkennt. Sehr beliebt ist auch die Maquillage durch die Nadel.
Es wird eine feine Nadel in feines Wachs getaucht und mit der an ihr haftenden
flüssigen Masse leicht in die Karte gestochen. Nach dem Erkalten bleibt ein
erhöhtes Pünktchen zurück, gerade groß genug, daß der fühlende Finger es
tasten kann. Kommt es darauf an, alle Karten eines Spiels hiermit zu zeichnen,
so wird ein richtiges System in der Verteilung der Pünktchen angewendet. Der
„Grec“ nimmt ein gewöhnliches Spiel Karten und zeichnet es nach folgendem
Schema:
Wo sich die Striche schneiden, liegt die Mar-
quierung. Durch Übung erreicht es dann der Falsch-
spieler/das Kartenbild an jedem so gezeichneten Spiel
ohne weiteres zu wissen. Aber auch, wenn er ein
völlig neues Spiel in die Hand bekommt, ist er nicht
um eine Maquillage verlegen. Der Fingernagel ge-
nügt, oder ein leichtes Um- und wieder Geradebiegen
der Karten, schließlich bedient er sich auch des Siegel-
Pique
Carreau
Coeur
Treffle
rings, der, nach außen harmlos, unten eine feine, kurze Nadel hat, mit der leicht
einige wichtige Karten im Laufe des Spiels angestochen werden.
Diese äußeren Mittel sind aber nicht überall anwendbar, darum ist jeder
gute Grec auch ein guter Taschenspieler. Als solcher ist es ihm ein leichtes,
zu „transportieren“, d. h. Karten aus dem Spiel vorübergehend zu entfernen oder
vorhandene gegen irgendwie gezeichnete auszutauschen. Er nimmt dazu harm-
los seine Zigarrentasche oder das Taschentuch hervor, bringt dabei die ihm
hinderlichen Karten beiseite und die anderen hervor, die er in der hohlen Iland,
leicht zwischen Daumen und kleinem Finger gehalten, verbirgt, bis er sie brauchen
kann. Lieber noch vertauscht er aber die vorhandenen, genau geprüften Karten
gegen ein ganzes „Portee“, d. h. gegen einen bereitgehaltenen präparierten Talon.
Diesen steckt ihm entweder bei Gelegenheit einer seiner Komplizen zu, oder
er nimmt ihn geschickt aus einer dazu bestimmten Tasche unter dem linken
Arm an der Weste oder an dem rechten Teil des hinteren Beinkleids. Ist keins
dieser Manöver anwendbar, so ist der Grec noch lange nicht verloren. Er
wendet z. B. die „Sequence“ an (er ordnet eine bestimmte Anzahl Karten in
bestimmter Reihenfolge) oder gar den „Rosenkranz“, der allerdings lieber fertig
bereitgehalten und durch Transportieren eingeschmuggelt wird (d. h. ein ganzes
bestimmt geordnetes Spiel). Die Schwierigkeit scheint hierbei für den Laien zu
sein, diese Folge der Karten aufrecht zu erhalten.
Aber das besorgt der Grec durch „Salatmachcn“, d. h. durch Scheinmanöver
beim Mischen. Die gewöhnlichste Art desselben, die auch der Laie kennt, d. h.
das Mischen eines Teils der Karten, während die anderen, auf die es ankommt,
ruhen, ist immer unerkennbar, wenn es ein „Künstler“ ausübt. Aber noch
weniger auffallend ist der sogenannte „Schwalbenschwanz“ d. h. das rasche Her-
ausziehen und wieder Hineinstecken kleiner Kartenpäckchen an derselben Stelle,
wobei unbemerkbar dieselben schräg gesteckt werden, um sie nicht mit den
darauf zu ziehenden zu verwechseln. Selbst bei dem, namentlich in französischen
Spielerkreisen beliebten Fächermischen (d. h. dem Auseinanderbreiten und Über-
einanderschieben der Karten in den Händen) versteht es der Grec, die Karten
genau wieder so ineinander zu schieben, wie sie vorher waren.
Nun kommt ja aber das Abheben, denkt der gute Laie, und das muß doch
noch alles verderben. Ja, krasser Laie, du kennst den Witz der Grecs noch
lange nicht! Erstens ist der ehrliche Spieler natürlich geleimt, wenn der Grec
selber abhebt. Denn da hat er natürlich seine Kniffe: die Brücke (d. h. Biegen
des einen Kartenteils beim Abheben) oder den „Dachstein“ (d. h. Biegen beider
Päckchen), wodurch er im Augenblick des Abhebens die Päckchen markiert,
so daß er nachher durch „Volteschlagen“ alles wieder nach seinem Willen
ordnen kann. Oder er wendet das „Überschieben“ an, d. h. er hebt überhaupt
nur scheinbar ab, indem er ganz einfach, wenn z. B. Päckchen b auf a soll,
b in die linke Hand nimmt und dann a hinauflegt, was geschickt gemacht den
Eindruck richtigen Abhebens hinterläßt; oder er schiebt die Päckchen auch
über den Tischrand und vertauscht sie wieder blitzschnell. Doch nicht immer
hebt der Grec selber ab; sehr wohl! Leider nützt das dem Gimpel nichts.
Denn — und das ist unser: zweitens — der Spieler hebt selber ab, wie der
Grec will! Das klingt unglaublich, ist aber wahr und noch dazu plausibel.
Der abhebende Finger bleibt nämlich, ohne es zu merken, an der Stelle haften,
die ihm am bequemsten liegt. Und diese Stelle verschafft ihm der Grec, indem
er z. B. einfach eine um 2 mm breitere Karte einfügt, wo abgehoben werden
soll, und prompt wird es eintreffen. Aber sollte auch dies „wissenschaftliche“
Mittel einmal versagen, wozu ist dann die „Eilage“, das unregelmäßige Abziehen
der Karten beim Ausgeben da? Das geschieht so geschickt, daß die obersten
Karten oft bis zum Schluß des Talons in der Hand des Falschspielers bleiben.
Aus diesen kurzen Andeutungen ergibt sich mit absoluter Deutlichkeit
bereits, wie gewaltig der ehrliche Spieler im Nachteil ist. Der einigermaßen
intelligente Kopf wird deshalb lieber auf einen Nervenrausch und eine Gesell-
schaft verzichten, als sich wie ein hilfloses Kind von im Grunde genommen
plumpen Gaunern ausnehmen zu lassen. Dr. Georg Voss.
$u jun<$? Ä7
Siehst du die Kleine im weissen Kleid?
Freund — ich weine vor Schmerz und Neid:
Mir ist sie verloren, — das ist mein Leid.
Im Frühjahr leider war sie noch Kind,
Trug kurze Kleider, das Flaar in dem Wind.
Sprach ich was Ernstes, entfloh sie geschwind.
Ich will nicht stören den kindlichen Mut;
Sie darf nichts hören von heisser Glut.
Wird sie erst reifer, wird sie mir gut.
Ich ging auf Reisen. Verbarg ohne Laut
Die Wünsche, die heissen, auf die ich gebaut.
Ich kehrte wieder — — da war sie Braut.
Sie sah mich halb fragend, halb trotzig an.
Ein Blick vielsagend: Was hast du getan,
Warum gingst du fort? Du böser Mann. —
Es war nur Torheit, was mir schien Pflicht,
Vorurteil der Vorzeit. Ich wusste nicht:
Ein Kind reift schnell jetzt, wenn Liebe spricht.
Johanne Sebelin.
:33ü&:
Unsere I3ildet\
gibt kaum einen anderen Ruf, der mit solcher Schnelligkeit Panik und
g7 Entsetzen zu verbreiten vermöchte, als „Feuer“. Wer dieses Wort einmal
in einem mit Menschen erfüllten Raum, z. B. im Theater gehört hat, sei es daß
wirklich ein Brand entstand, oder nur ein Irrtum es hervorrief, dem kann seine
unheimliche Gewalt nicht mehr zweifelhaft sein. Sie beruht auf nur zu guter
Erkenntnis der Macht des Feuers, mag sie auch nicht aus der Erfahrung, sondern
nur dem Instinkte geschöpft sein, womit der Mensch drohendes Verderben ab-
wehrt. Um wieviel grauenhafter noch wirkt der Anblick einer schon aus-
gebrochenen Feuersbrunst, umsomehr wenn sie uns selbst droht. So schildert
John Collier ein Mädchen, das aus dumpfen Träumen erwacht ist, in denen
es Menschenstimmen vernahm. Müde öffnet sie die Augen, um sie dann jäh
und weit aufzureißen, während Entsetzen ihre Züge entstellt. Vor ihr prasselt
brennende Glut, und laut und gell stößt sie den Hilferuf aus.
Der segnenden Macht des Feuers, wie es sich in der Sonne offenbart, ist
die Anbetung der Menschen geweiht, die aus L. Fahrenkrogs „Die heilige
Stunde“ zu uns spricht. Sonnenverehrung finden wir überall im Kulte der
primitiven Menschen, Verehrung des Sonnenballs als des lebenspendenden
Prinzips. Das Sonnenrad, die Feuerkugel, spielt so auch heute noch in manchem
deutschen Volksbrauche z. B. in den Oster- und Johannisnachtfeuern eine be-
deutende Rolle; durch ein mittels des Rades, d. h. des Sonnensymbols, erzeugtes
Feuer glaubt man in Irland und Rußland Viehseuchen heilen zu können. Freilich
hat die Sonne neben ihrer segensreichen Wirkung im Glauben mancher asiatischer,
in den Tropen lebender Kulturvölker auch verheerende Macht, wie z. B. die
indischen Veden von ihr singen: sie, die am Himmel glüht, ist der Tod.
Goethe hat von seiner Ballade „Der Fischer“ ausgesagt, daß er durch sie dem
Gefühl, das uns an warmen Sommertagen zum Bade treibt, Ausdruck verleihen
wollte. In ähnlichem Sinne könnte man Jane Grenouilloux Gemälde „Ein
Sommernachtstraum“ auffassen. Es ist, als ob die Natur, des heißen
langen Tages müde, sich im Waldesdunkel am Bachesrand zur Ruhe legte, um
die Nachtkühle unter dem Sternenhimmel zu genießen. Von diesem lieblichen
Gemälde hat der Kunstverlag von Rieh. Bong, Berlin W57, eine Faksimilegravüre
(Bildgröße 33X54,5 cm, Kartongröße 60X80 cm) zum Preise von 60 M. hergestellt.
# *
Den „Geburtstag der Genesenden“ hat Otto Heichert zum Motiv
seines Gemäldes gewählt, das auf der vorjährigen Großen Berliner Kunstaus-
stellung lebhaftes Interesse erweckte. Wie gut ist der Ausdruck der Noch-
Kranken getroffen, die mit glücklichem Gesicht auf die Kinder und die Geschenke
blickt. Den Maler haben hierbei der Widerspruch und die Effekte gefesselt, die
das Tageslicht und der rötliche Kerzenschein hervorbringen.
MODERNE KUNST.
7 8 9 10 B D IC A
Falschspielers sie erkennt. Sehr beliebt ist auch die Maquillage durch die Nadel.
Es wird eine feine Nadel in feines Wachs getaucht und mit der an ihr haftenden
flüssigen Masse leicht in die Karte gestochen. Nach dem Erkalten bleibt ein
erhöhtes Pünktchen zurück, gerade groß genug, daß der fühlende Finger es
tasten kann. Kommt es darauf an, alle Karten eines Spiels hiermit zu zeichnen,
so wird ein richtiges System in der Verteilung der Pünktchen angewendet. Der
„Grec“ nimmt ein gewöhnliches Spiel Karten und zeichnet es nach folgendem
Schema:
Wo sich die Striche schneiden, liegt die Mar-
quierung. Durch Übung erreicht es dann der Falsch-
spieler/das Kartenbild an jedem so gezeichneten Spiel
ohne weiteres zu wissen. Aber auch, wenn er ein
völlig neues Spiel in die Hand bekommt, ist er nicht
um eine Maquillage verlegen. Der Fingernagel ge-
nügt, oder ein leichtes Um- und wieder Geradebiegen
der Karten, schließlich bedient er sich auch des Siegel-
Pique
Carreau
Coeur
Treffle
rings, der, nach außen harmlos, unten eine feine, kurze Nadel hat, mit der leicht
einige wichtige Karten im Laufe des Spiels angestochen werden.
Diese äußeren Mittel sind aber nicht überall anwendbar, darum ist jeder
gute Grec auch ein guter Taschenspieler. Als solcher ist es ihm ein leichtes,
zu „transportieren“, d. h. Karten aus dem Spiel vorübergehend zu entfernen oder
vorhandene gegen irgendwie gezeichnete auszutauschen. Er nimmt dazu harm-
los seine Zigarrentasche oder das Taschentuch hervor, bringt dabei die ihm
hinderlichen Karten beiseite und die anderen hervor, die er in der hohlen Iland,
leicht zwischen Daumen und kleinem Finger gehalten, verbirgt, bis er sie brauchen
kann. Lieber noch vertauscht er aber die vorhandenen, genau geprüften Karten
gegen ein ganzes „Portee“, d. h. gegen einen bereitgehaltenen präparierten Talon.
Diesen steckt ihm entweder bei Gelegenheit einer seiner Komplizen zu, oder
er nimmt ihn geschickt aus einer dazu bestimmten Tasche unter dem linken
Arm an der Weste oder an dem rechten Teil des hinteren Beinkleids. Ist keins
dieser Manöver anwendbar, so ist der Grec noch lange nicht verloren. Er
wendet z. B. die „Sequence“ an (er ordnet eine bestimmte Anzahl Karten in
bestimmter Reihenfolge) oder gar den „Rosenkranz“, der allerdings lieber fertig
bereitgehalten und durch Transportieren eingeschmuggelt wird (d. h. ein ganzes
bestimmt geordnetes Spiel). Die Schwierigkeit scheint hierbei für den Laien zu
sein, diese Folge der Karten aufrecht zu erhalten.
Aber das besorgt der Grec durch „Salatmachcn“, d. h. durch Scheinmanöver
beim Mischen. Die gewöhnlichste Art desselben, die auch der Laie kennt, d. h.
das Mischen eines Teils der Karten, während die anderen, auf die es ankommt,
ruhen, ist immer unerkennbar, wenn es ein „Künstler“ ausübt. Aber noch
weniger auffallend ist der sogenannte „Schwalbenschwanz“ d. h. das rasche Her-
ausziehen und wieder Hineinstecken kleiner Kartenpäckchen an derselben Stelle,
wobei unbemerkbar dieselben schräg gesteckt werden, um sie nicht mit den
darauf zu ziehenden zu verwechseln. Selbst bei dem, namentlich in französischen
Spielerkreisen beliebten Fächermischen (d. h. dem Auseinanderbreiten und Über-
einanderschieben der Karten in den Händen) versteht es der Grec, die Karten
genau wieder so ineinander zu schieben, wie sie vorher waren.
Nun kommt ja aber das Abheben, denkt der gute Laie, und das muß doch
noch alles verderben. Ja, krasser Laie, du kennst den Witz der Grecs noch
lange nicht! Erstens ist der ehrliche Spieler natürlich geleimt, wenn der Grec
selber abhebt. Denn da hat er natürlich seine Kniffe: die Brücke (d. h. Biegen
des einen Kartenteils beim Abheben) oder den „Dachstein“ (d. h. Biegen beider
Päckchen), wodurch er im Augenblick des Abhebens die Päckchen markiert,
so daß er nachher durch „Volteschlagen“ alles wieder nach seinem Willen
ordnen kann. Oder er wendet das „Überschieben“ an, d. h. er hebt überhaupt
nur scheinbar ab, indem er ganz einfach, wenn z. B. Päckchen b auf a soll,
b in die linke Hand nimmt und dann a hinauflegt, was geschickt gemacht den
Eindruck richtigen Abhebens hinterläßt; oder er schiebt die Päckchen auch
über den Tischrand und vertauscht sie wieder blitzschnell. Doch nicht immer
hebt der Grec selber ab; sehr wohl! Leider nützt das dem Gimpel nichts.
Denn — und das ist unser: zweitens — der Spieler hebt selber ab, wie der
Grec will! Das klingt unglaublich, ist aber wahr und noch dazu plausibel.
Der abhebende Finger bleibt nämlich, ohne es zu merken, an der Stelle haften,
die ihm am bequemsten liegt. Und diese Stelle verschafft ihm der Grec, indem
er z. B. einfach eine um 2 mm breitere Karte einfügt, wo abgehoben werden
soll, und prompt wird es eintreffen. Aber sollte auch dies „wissenschaftliche“
Mittel einmal versagen, wozu ist dann die „Eilage“, das unregelmäßige Abziehen
der Karten beim Ausgeben da? Das geschieht so geschickt, daß die obersten
Karten oft bis zum Schluß des Talons in der Hand des Falschspielers bleiben.
Aus diesen kurzen Andeutungen ergibt sich mit absoluter Deutlichkeit
bereits, wie gewaltig der ehrliche Spieler im Nachteil ist. Der einigermaßen
intelligente Kopf wird deshalb lieber auf einen Nervenrausch und eine Gesell-
schaft verzichten, als sich wie ein hilfloses Kind von im Grunde genommen
plumpen Gaunern ausnehmen zu lassen. Dr. Georg Voss.
$u jun<$? Ä7
Siehst du die Kleine im weissen Kleid?
Freund — ich weine vor Schmerz und Neid:
Mir ist sie verloren, — das ist mein Leid.
Im Frühjahr leider war sie noch Kind,
Trug kurze Kleider, das Flaar in dem Wind.
Sprach ich was Ernstes, entfloh sie geschwind.
Ich will nicht stören den kindlichen Mut;
Sie darf nichts hören von heisser Glut.
Wird sie erst reifer, wird sie mir gut.
Ich ging auf Reisen. Verbarg ohne Laut
Die Wünsche, die heissen, auf die ich gebaut.
Ich kehrte wieder — — da war sie Braut.
Sie sah mich halb fragend, halb trotzig an.
Ein Blick vielsagend: Was hast du getan,
Warum gingst du fort? Du böser Mann. —
Es war nur Torheit, was mir schien Pflicht,
Vorurteil der Vorzeit. Ich wusste nicht:
Ein Kind reift schnell jetzt, wenn Liebe spricht.
Johanne Sebelin.
:33ü&:
Unsere I3ildet\
gibt kaum einen anderen Ruf, der mit solcher Schnelligkeit Panik und
g7 Entsetzen zu verbreiten vermöchte, als „Feuer“. Wer dieses Wort einmal
in einem mit Menschen erfüllten Raum, z. B. im Theater gehört hat, sei es daß
wirklich ein Brand entstand, oder nur ein Irrtum es hervorrief, dem kann seine
unheimliche Gewalt nicht mehr zweifelhaft sein. Sie beruht auf nur zu guter
Erkenntnis der Macht des Feuers, mag sie auch nicht aus der Erfahrung, sondern
nur dem Instinkte geschöpft sein, womit der Mensch drohendes Verderben ab-
wehrt. Um wieviel grauenhafter noch wirkt der Anblick einer schon aus-
gebrochenen Feuersbrunst, umsomehr wenn sie uns selbst droht. So schildert
John Collier ein Mädchen, das aus dumpfen Träumen erwacht ist, in denen
es Menschenstimmen vernahm. Müde öffnet sie die Augen, um sie dann jäh
und weit aufzureißen, während Entsetzen ihre Züge entstellt. Vor ihr prasselt
brennende Glut, und laut und gell stößt sie den Hilferuf aus.
Der segnenden Macht des Feuers, wie es sich in der Sonne offenbart, ist
die Anbetung der Menschen geweiht, die aus L. Fahrenkrogs „Die heilige
Stunde“ zu uns spricht. Sonnenverehrung finden wir überall im Kulte der
primitiven Menschen, Verehrung des Sonnenballs als des lebenspendenden
Prinzips. Das Sonnenrad, die Feuerkugel, spielt so auch heute noch in manchem
deutschen Volksbrauche z. B. in den Oster- und Johannisnachtfeuern eine be-
deutende Rolle; durch ein mittels des Rades, d. h. des Sonnensymbols, erzeugtes
Feuer glaubt man in Irland und Rußland Viehseuchen heilen zu können. Freilich
hat die Sonne neben ihrer segensreichen Wirkung im Glauben mancher asiatischer,
in den Tropen lebender Kulturvölker auch verheerende Macht, wie z. B. die
indischen Veden von ihr singen: sie, die am Himmel glüht, ist der Tod.
Goethe hat von seiner Ballade „Der Fischer“ ausgesagt, daß er durch sie dem
Gefühl, das uns an warmen Sommertagen zum Bade treibt, Ausdruck verleihen
wollte. In ähnlichem Sinne könnte man Jane Grenouilloux Gemälde „Ein
Sommernachtstraum“ auffassen. Es ist, als ob die Natur, des heißen
langen Tages müde, sich im Waldesdunkel am Bachesrand zur Ruhe legte, um
die Nachtkühle unter dem Sternenhimmel zu genießen. Von diesem lieblichen
Gemälde hat der Kunstverlag von Rieh. Bong, Berlin W57, eine Faksimilegravüre
(Bildgröße 33X54,5 cm, Kartongröße 60X80 cm) zum Preise von 60 M. hergestellt.
# *
Den „Geburtstag der Genesenden“ hat Otto Heichert zum Motiv
seines Gemäldes gewählt, das auf der vorjährigen Großen Berliner Kunstaus-
stellung lebhaftes Interesse erweckte. Wie gut ist der Ausdruck der Noch-
Kranken getroffen, die mit glücklichem Gesicht auf die Kinder und die Geschenke
blickt. Den Maler haben hierbei der Widerspruch und die Effekte gefesselt, die
das Tageslicht und der rötliche Kerzenschein hervorbringen.