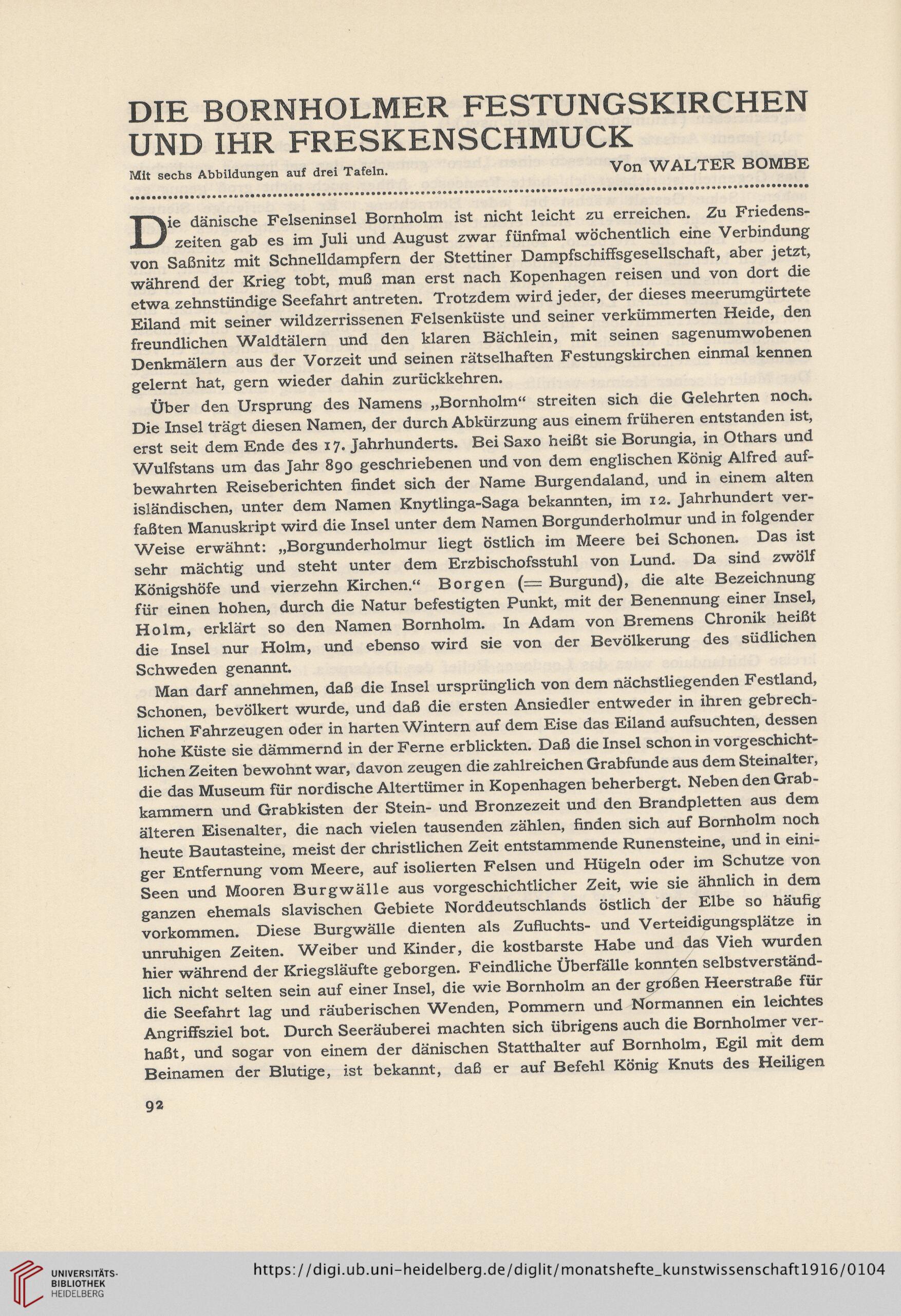DIE BORNHOLMER FESTUNGSKIRCHEN
UND IHR FRESKENSCHMUCK
Mit sechs Abbildungen auf drei Tafeln. Von WALTER BOMBE
Die dänische Felseninsel Bornholm ist nicht leicht zu erreichen. Zu Friedens-
zeiten gab es im Juli und August zwar fünfmal wöchentlich eine Verbindung
von Saßnitz mit Schnelldampfern der Stettiner Dampfschiffsgesellschaft, aber jetzt,
während der Krieg tobt, muß man erst nach Kopenhagen reisen und von dort die
etwa zehnstündige Seefahrt antreten. Trotzdem wird jeder, der dieses meerumgürtete
Eiland mit seiner wildzerrissenen Felsenküste und seiner verkümmerten Heide, den
freundlichen Waldtälern und den klaren Bächlein, mit seinen sagenumwobenen
Denkmälern aus der Vorzeit und seinen rätselhaften Festungskirchen einmal kennen
gelernt hat, gern wieder dahin zurückkehren.
Über den Ursprung des Namens „Bornholm“ streiten sich die Gelehrten noch.
Die Insel trägt diesen Namen, der durch Abkürzung aus einem früheren entstanden ist,
erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Bei Saxo heißt sie Borungia, in Othars und
Wulfstans um das Jahr 890 geschriebenen und von dem englischen König Alfred auf-
bewahrten Reiseberichten findet sich der Name Burgendaland, und in einem alten
isländischen, unter dem Namen Knytlinga-Saga bekannten, im 12. Jahrhundert ver-
faßten Manuskript wird die Insel unter dem Namen Borgunderholmur und in folgender
Weise erwähnt: „Borgunderholmur liegt östlich im Meere bei Schonen. Das ist
sehr mächtig und steht unter dem Erzbischofsstuhl von Lund. Da sind zwölf
Königshöfe und vierzehn Kirchen.“ Borgen (= Burgund), die alte Bezeichnung
für einen hohen, durch die Natur befestigten Punkt, mit der Benennung einer Insel,
Holm, erklärt so den Namen Bornholm. In Adam von Bremens Chronik heißt
die Insel nur Holm, und ebenso wird sie von der Bevölkerung des südlichen
Schweden genannt.
Man darf annehmen, daß die Insel ursprünglich von dem nächstliegenden Festland,
Schonen, bevölkert wurde, und daß die ersten Ansiedler entweder in ihren gebrech-
lichen Fahrzeugen oder in harten Wintern auf dem Eise das Eiland aufsuchten, dessen
hohe Küste sie dämmernd in der Ferne erblickten. Daß die Insel schon in vorgeschicht-
lichen Zeiten bewohnt war, davon zeugen die zahlreichen Grabfunde aus dem Steinalter,
die das Museum für nordische Altertümer in Kopenhagen beherbergt. Neben den Grab-
kammern und Grabkisten der Stein- und Bronzezeit und den Brandpletten aus dem
älteren Eisenalter, die nach vielen tausenden zählen, finden sich auf Bornholm noch
heute Bautasteine, meist der christlichen Zeit entstammende Runensteine, und in eini-
ger Entfernung vom Meere, auf isolierten Felsen und Hügeln oder im Schutze von
Seen und Mooren Burgwälle aus vorgeschichtlicher Zeit, wie sie ähnlich in dem
ganzen ehemals slavischen Gebiete Norddeutschlands östlich der Elbe so häufig
vorkommen. Diese Burgwälle dienten als Zufluchts- und Verteidigungsplätze in
unruhigen Zeiten. Weiber und Kinder, die kostbarste Habe und das Vieh wurden
hier während der Kriegsläufte geborgen. Feindliche Überfälle konnten selbstverständ-
lich nicht selten sein auf einer Insel, die wie Bornholm an der großen Heerstraße für
die Seefahrt lag und räuberischen Wenden, Pommern und Normannen ein leichtes
Angriffsziel bot. Durch Seeräuberei machten sich übrigens auch die Bornholmer ver-
haßt, und sogar von einem der dänischen Statthalter auf Bornholm, Egil mit dem
Beinamen der Blutige, ist bekannt, daß er auf Befehl König Knuts des Heiligen
92
UND IHR FRESKENSCHMUCK
Mit sechs Abbildungen auf drei Tafeln. Von WALTER BOMBE
Die dänische Felseninsel Bornholm ist nicht leicht zu erreichen. Zu Friedens-
zeiten gab es im Juli und August zwar fünfmal wöchentlich eine Verbindung
von Saßnitz mit Schnelldampfern der Stettiner Dampfschiffsgesellschaft, aber jetzt,
während der Krieg tobt, muß man erst nach Kopenhagen reisen und von dort die
etwa zehnstündige Seefahrt antreten. Trotzdem wird jeder, der dieses meerumgürtete
Eiland mit seiner wildzerrissenen Felsenküste und seiner verkümmerten Heide, den
freundlichen Waldtälern und den klaren Bächlein, mit seinen sagenumwobenen
Denkmälern aus der Vorzeit und seinen rätselhaften Festungskirchen einmal kennen
gelernt hat, gern wieder dahin zurückkehren.
Über den Ursprung des Namens „Bornholm“ streiten sich die Gelehrten noch.
Die Insel trägt diesen Namen, der durch Abkürzung aus einem früheren entstanden ist,
erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Bei Saxo heißt sie Borungia, in Othars und
Wulfstans um das Jahr 890 geschriebenen und von dem englischen König Alfred auf-
bewahrten Reiseberichten findet sich der Name Burgendaland, und in einem alten
isländischen, unter dem Namen Knytlinga-Saga bekannten, im 12. Jahrhundert ver-
faßten Manuskript wird die Insel unter dem Namen Borgunderholmur und in folgender
Weise erwähnt: „Borgunderholmur liegt östlich im Meere bei Schonen. Das ist
sehr mächtig und steht unter dem Erzbischofsstuhl von Lund. Da sind zwölf
Königshöfe und vierzehn Kirchen.“ Borgen (= Burgund), die alte Bezeichnung
für einen hohen, durch die Natur befestigten Punkt, mit der Benennung einer Insel,
Holm, erklärt so den Namen Bornholm. In Adam von Bremens Chronik heißt
die Insel nur Holm, und ebenso wird sie von der Bevölkerung des südlichen
Schweden genannt.
Man darf annehmen, daß die Insel ursprünglich von dem nächstliegenden Festland,
Schonen, bevölkert wurde, und daß die ersten Ansiedler entweder in ihren gebrech-
lichen Fahrzeugen oder in harten Wintern auf dem Eise das Eiland aufsuchten, dessen
hohe Küste sie dämmernd in der Ferne erblickten. Daß die Insel schon in vorgeschicht-
lichen Zeiten bewohnt war, davon zeugen die zahlreichen Grabfunde aus dem Steinalter,
die das Museum für nordische Altertümer in Kopenhagen beherbergt. Neben den Grab-
kammern und Grabkisten der Stein- und Bronzezeit und den Brandpletten aus dem
älteren Eisenalter, die nach vielen tausenden zählen, finden sich auf Bornholm noch
heute Bautasteine, meist der christlichen Zeit entstammende Runensteine, und in eini-
ger Entfernung vom Meere, auf isolierten Felsen und Hügeln oder im Schutze von
Seen und Mooren Burgwälle aus vorgeschichtlicher Zeit, wie sie ähnlich in dem
ganzen ehemals slavischen Gebiete Norddeutschlands östlich der Elbe so häufig
vorkommen. Diese Burgwälle dienten als Zufluchts- und Verteidigungsplätze in
unruhigen Zeiten. Weiber und Kinder, die kostbarste Habe und das Vieh wurden
hier während der Kriegsläufte geborgen. Feindliche Überfälle konnten selbstverständ-
lich nicht selten sein auf einer Insel, die wie Bornholm an der großen Heerstraße für
die Seefahrt lag und räuberischen Wenden, Pommern und Normannen ein leichtes
Angriffsziel bot. Durch Seeräuberei machten sich übrigens auch die Bornholmer ver-
haßt, und sogar von einem der dänischen Statthalter auf Bornholm, Egil mit dem
Beinamen der Blutige, ist bekannt, daß er auf Befehl König Knuts des Heiligen
92