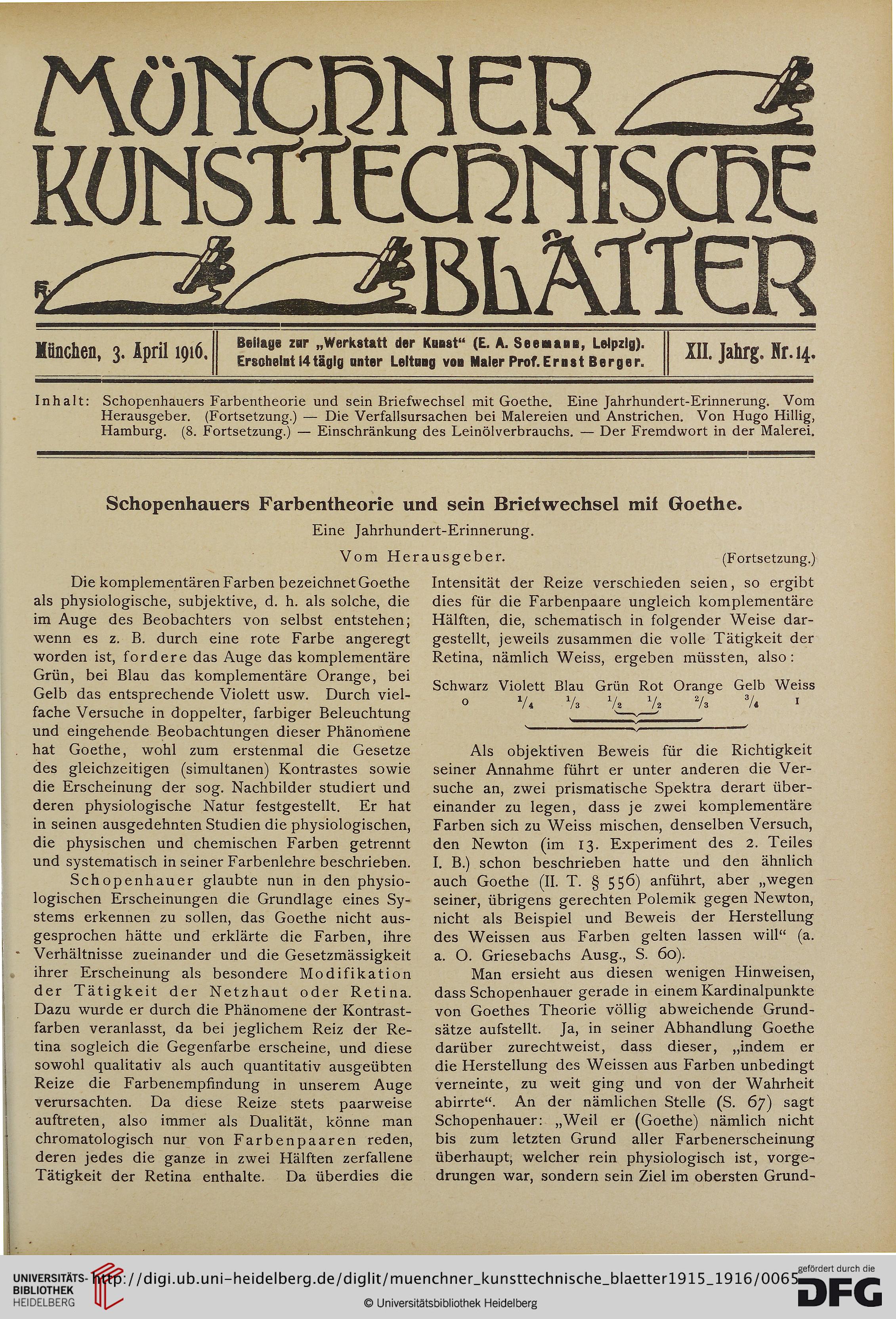Mönchen, 3. ipril 1916.
Beiltga zar „Werkstatt der Kaast" (E. A. Seeataac, Leipzig).
Erscheint 14 tägig anter Leltnng von Mater Prof. Ernst Berger.
HI. Jahrg. Nr. 14.
Inhalt: Schopenhauers Farbentheorie und sein Briefwechsel mit Goethe. Eine Jahrhundert-Erinnerung. Vom
Herausgeber. (Fortsetzung.) — Die VerfaHsursachen bei Malereien und Anstrichen. Von Hugo Hillig,
Hamburg. (8. Fortsetzung.) — Einschränkung des Leinölverbrauchs. — Der Fremdwort in der Malerei.
Schopenhauers Farbentheorie und sein Briefwechsel mit Goethe.
Eine Jahrhundert-Erinnerung.
Vom Herausgeber.
Die komplementären Farben bezeichnetGoethe
als physiologische, subjektive, d. h. als solche, die
im Auge des Beobachters von selbst entstehen;
wenn es z. B. durch eine rote Farbe angeregt
worden ist, fordere das Auge das komplementäre
Grün, bei Blau das komplementäre Orange, bei
Gelb das entsprechende Violett usw. Durch viel-
fache Versuche in doppelter, farbiger Beleuchtung
und eingehende Beobachtungen dieser Phänomene
hat Goethe, wohl zum erstenmal die Gesetze
des gleichzeitigen (simultanen) Kontrastes sowie
die Erscheinung der sog. Nachbilder studiert und
deren physiologische Natur festgestellt. Er hat
in seinen ausgedehnten Studien die physiologischen,
die physischen und chemischen Farben getrennt
und systematisch in seiner Farbenlehre beschrieben.
Schopenhauer glaubte nun in den physio-
logischen Erscheinungen die Grundlage eines Sy-
stems erkennen zu sollen, das Goethe nicht aus-
gesprochen hätte und erklärte die Farben, ihre
Verhältnisse zueinander und die Gesetzmässigkeit
ihrer Erscheinung als besondere Modifikation
der Tätigkeit der Netzhaut oder Retina.
Dazu wurde er durch die Phänomene der Kontrast-
farben veranlasst, da bei jeglichem Reiz der Re-
tina sogleich die Gegenfarbe erscheine, und diese
sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgeübten
Reize die Farbenempfindung in unserem Auge
verursachten. Da diese Reize stets paarweise
auftreten, also immer als Dualität, könne man
chromatologisch nur von Farbenpaaren reden,
deren jedes die ganze in zwei Hälften zerfallene
Tätigkeit der Retina enthalte. Da überdies die
(Fortsetzung.)
Intensität der Reize verschieden seien, so ergibt
dies für die Farbenpaare ungleich komplementäre
Hälften, die, schematisch in folgender Weise dar-
gestellt, jeweils zusammen die volle Tätigkeit der
Retina, nämlich Weiss, ergeben müssten, also :
Schwarz Violett Blau Grün Rot Orange Gelb Weiss
o V, Vs Vs Vs V. V< I
Als objektiven Beweis für die Richtigkeit
seiner Annahme führt er unter anderen die Ver-
suche an, zwei prismatische Spektra derart über-
einander zu legen, dass je zwei komplementäre
Farben sich zu Weiss mischen, denselben Versuch,
den Newton (im Iß. Experiment des 2. Teiles
I. B.) schon beschrieben hatte und den ähnlich
auch Goethe (II. T. § 556) anführt, aber „wegen
seiner, übrigens gerechten Polemik gegen Newton,
nicht als Beispiel und Beweis der Herstellung
des Weissen aus Farben gelten lassen will" (a.
a. O. Griesebachs Ausg., S. 60).
Man ersieht aus diesen wenigen Hinweisen,
dass Schopenhauer gerade in einem Kardinalpunkte
von Goethes Theorie völlig abweichende Grund-
sätze aufstellt. Ja, in seiner Abhandlung Goethe
darüber zurechtweist, dass dieser, „indem er
die Herstellung des Weissen aus Farben unbedingt
verneinte, zu weit ging und von der Wahrheit
abirrte". An der nämlichen Stelle (S. 67) sagt
Schopenhauer: „Weil er (Goethe) nämlich nicht
bis zum letzten Grund aller Farbenerscheinung
überhaupt, welcher rein physiologisch ist, vorge-
drungen war, sondern sein Ziel im obersten Grund-