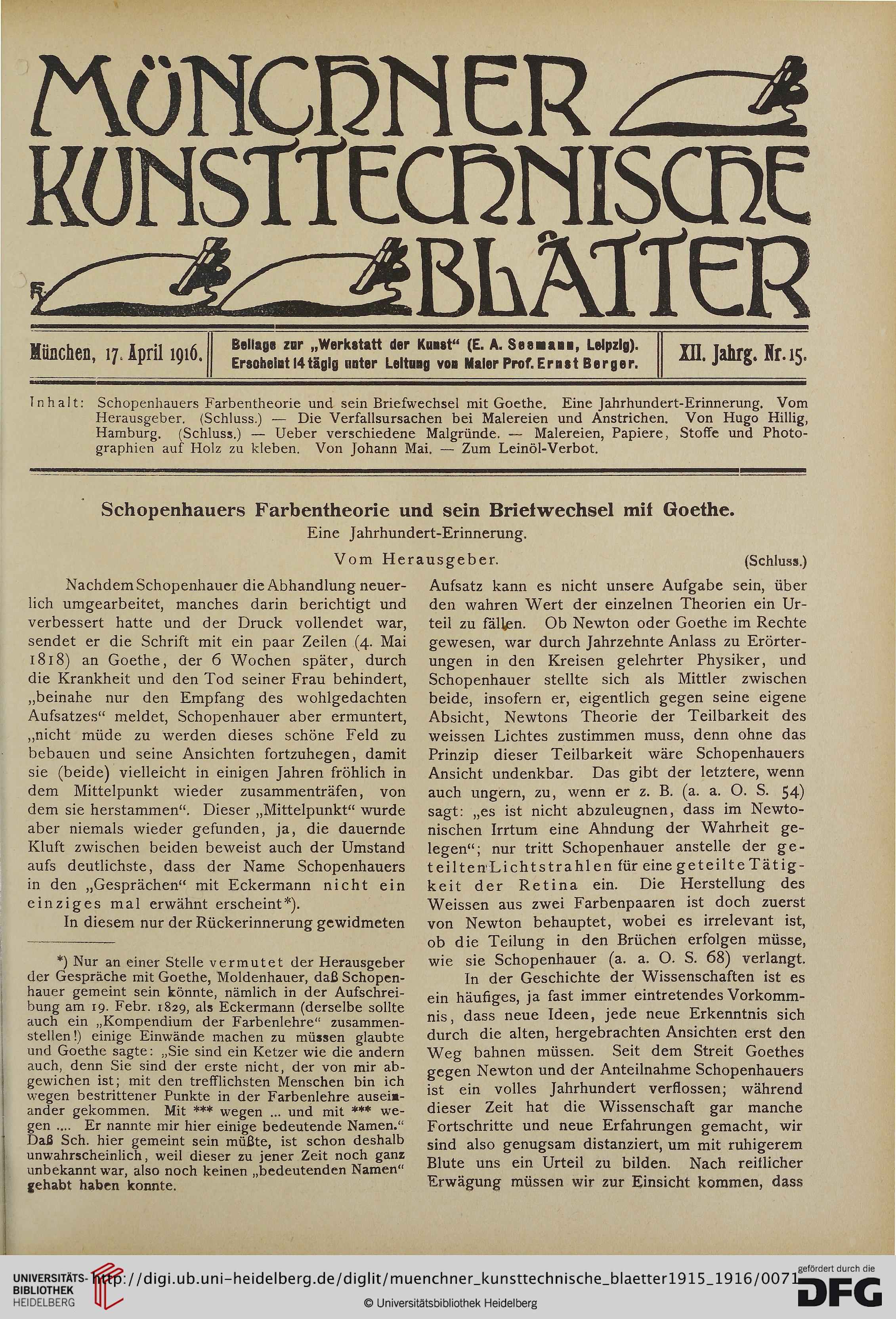München, 17, April 1916.
Beilage zur „Werkstatt der Knast" (E. A. Seeataaa, Le!pz!g).
Ersoheiat!4tägig unter Leitnag voa Mater Prof. Ernst Berger.
IM. Jahrg. Nf.iS.
Inhalt: Schopenhauers Farbentheorie und sein Briefwechsel mit Goethe. Eine Jahrhundert-Erinnerung. Vom
Herausgeber. (Schluss.) — Die VerfaHsursachen bei Malereien und Anstrichen. Von Hugo Hiliig,
Hamburg. (Schluss.) — Ueber verschiedene Maigründe. — Maiereien, Papiere, Stoffe und Photo-
graphien auf Holz zu hieben. Von Johann Mai. — Zum Leinöi-Verbot.
Schopenhauers Farbentheorie und sein Briefwechsel mit Goethe.
Eine Jahrhundert-Erinnerung.
Vom Her
Nachdem Schopenhauer die Abhandlung neuer-
lich umgearbeitet, manches darin berichtigt und
verbessert hatte und der Druck vollendet war,
sendet er die Schrift mit ein paar Zeiien (4. Mai
1818) an Goethe, der 6 Wochen später, durch
die Krankheit und den Tod seiner Frau behindert,
„beinahe nur den Empfang des wohlgedachten
Aufsatzes" meldet, Schopenhauer aber ermuntert,
„nicht müde zu werden dieses schöne Feld zu
bebauen und seine Ansichten fortzuhegen, damit
sie (beide) vielleicht in einigen Jahren fröhlich in
dem Mittelpunkt wieder zusammenträfen, von
dem sie herstammen". Dieser „Mittelpunkt" wurde
aber niemals wieder gefunden, ja, die dauernde
Kluft zwischen beiden beweist auch der Umstand
aufs deutlichste, dass der Name Schopenhauers
in den „Gesprächen" mit Eckermann nicht ein
einziges mal erwähnt erscheint* *).
In diesem nur der Rückerinnerung gewidmeten
*) Nur an einer Stelle vermutet der Herausgeber
der Gespräche mit Goethe, Moldenhauer, daß Schopen-
hauer gemeint sein könnte, nämlich in der Aufschrei-
bung am 19. Febr. :829, als Eckermann (derselbe sollte
auch ein „Kompendium der Farbenlehre" zusammen-
stellen!) einige Einwände machen zu müssen glaubte
und Goethe sagte: „Sie sind ein Ketzer wie die andern
auch, denn Sie sind der erste nicht, der von mir ab-
gewichen ist; mit den trefflichsten Menschen bin ich
wegen bestrittener Punkte in der Farbenlehre ausein-
ander gekommen. Mit *** wegen ... und mit *** we-
gen .... Er nannte mir hier einige bedeutende Namen."
Daß Sch. hier gemeint sein müßte, ist schon deshalb
unwahrscheinlich, weil dieser zu jener Zeit noch ganz
unbekannt war, also noch keinen „bedeutenden Namen"
gehabt haben konnte.
ausgebe r. (Schluss.)
Aufsatz kann es nicht unsere Aufgabe sein, über
den wahren Wert der einzelnen Theorien ein Ur-
teil zu fällen. Ob Newton oder Goethe im Rechte
gewesen, war durch Jahrzehnte Anlass zu Erörter-
ungen in den Kreisen gelehrter Physiker, und
Schopenhauer stellte sich als Mittler zwischen
beide, insofern er, eigentlich gegen seine eigene
Absicht, Newtons Theorie der Teilbarkeit des
weissen Lichtes zustimmen muss, denn ohne das
Prinzip dieser Teilbarkeit wäre Schopenhauers
Ansicht undenkbar. Das gibt der letztere, wenn
auch ungern, zu, wenn er z. B. (a. a. O. S. 54)
sagt: „es ist nicht abzuleugnen, dass im Newto-
nischen Irrtum eine Ahndung der Wahrheit ge-
legen"; nur tritt Schopenhauer anstelle der ge-
teilte ^Lichtstrahlen für eine geteilteTätig-
keit der Retina ein. Die Herstellung des
Weissen aus zwei Farbenpaaren ist doch zuerst
von Newton behauptet, wobei es irrelevant ist,
ob die Teilung in den Brüchen erfolgen müsse,
wie sie Schopenhauer (a. a. O. S. 68) verlangt.
In der Geschichte der Wissenschaften ist es
ein häufiges, ja fast immer eintretendes Vorkomm-
nis, dass neue Ideen, jede neue Erkenntnis sich
durch die alten, hergebrachten Ansichten erst den
Weg bahnen müssen. Seit dem Streit Goethes
gegen Newton und der Anteilnahme Schopenhauers
ist ein volles Jahrhundert verflossen; während
dieser Zeit hat die Wissenschaft gar manche
Fortschritte und neue Erfahrungen gemacht, wir
sind also genugsam distanziert, um mit ruhigerem
Blute uns ein Urteil zu bilden. Nach reiflicher
Erwägung müssen wir zur Einsicht kommen, dass