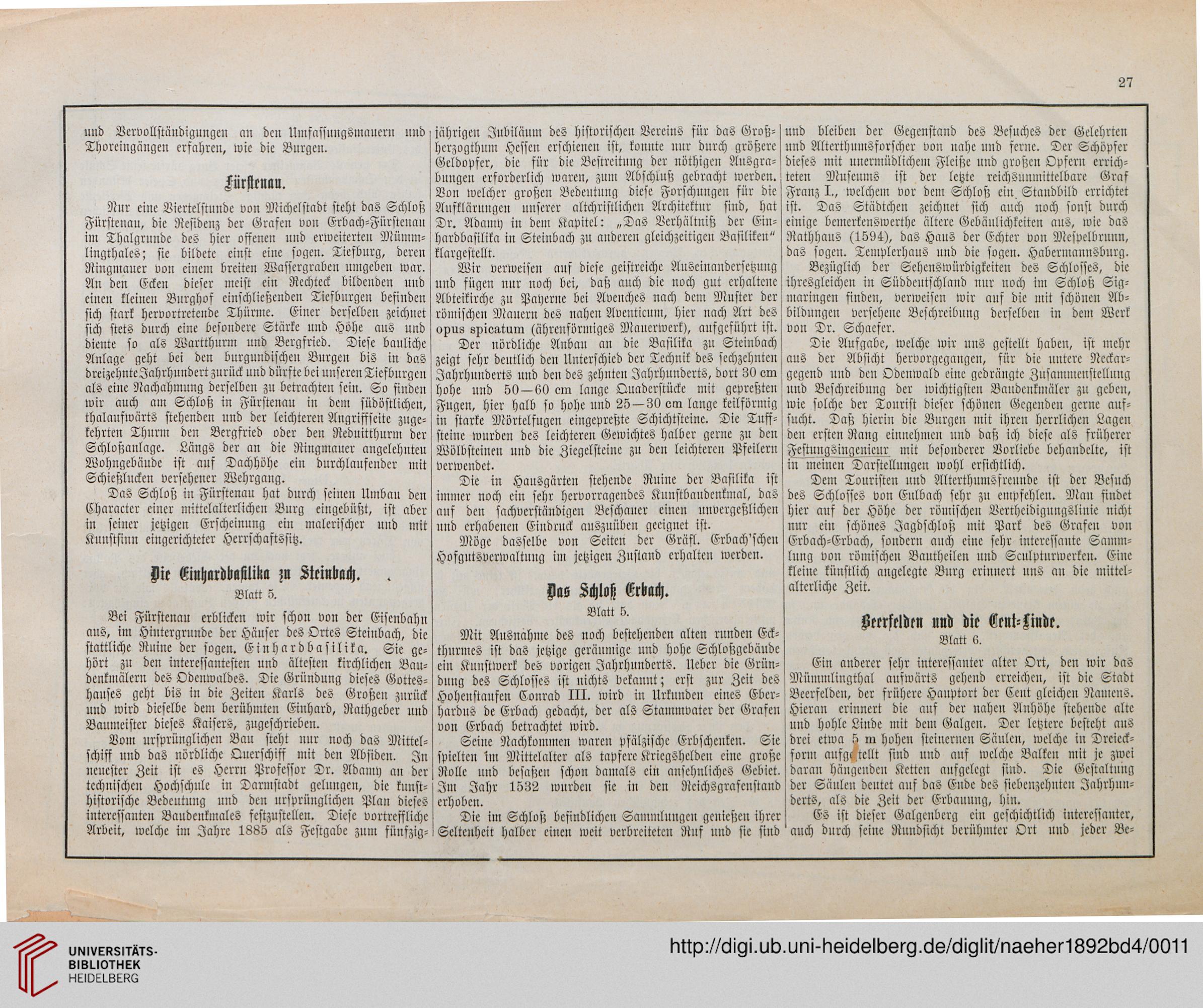27
und Vervollständigungen an den Umfassungsinauern nnd
Thorcingängen erfahren, lvie dic Burgcn.
Fiirstklmu.
Nnr eine Viertelstunde von Michclstadt steht das Schloß
Fürstcnan, die Nesidenz der Grafen von Erbach-Fnrstenau
iin Thalgrnndc des hier offencn und erweiterten Müinm-
lingthalcs; sie bildete einst eine sogen. Tiefburg, deren
Ringmauer von eincm breiten Wassergraben umgebcn lvar.
An dcn Ecken dieser meist ein Rechteck bildenden und
eincn klcincn Burghof cinschließenden Tiefbnrgen befinden
sich stark hcrvortrctende Thürme. Einer derselben zeichnet
sich stets dnrch cine besondere Stärke und Höhe aus und
dicntc so als Wartthnrin und Bergfried. Diese banliche
Anlage geht bei den burgundischen Bnrgen bis in das
dreizehnteJahrhundert zurück und dürfte bci unserenTiefburgen
als cinc Nachahmung derselben zu betrachten scin. So finden
wir auch am Schloß in Fürstenan in dcin südöstlichen,
thalanfwärts stehenden und der leichteren Angriffseite zugc-
kehrten Thnrm den Bergfried oder den Reduitthurm der
Schloßanlage. Längs der an die Ringmauer angelehnteu
Wohngebäudc ist auf Dachhöhe ein durchlaufcndcr mit
Schießlucken versehcner Wehrgang.
Das Schloß in Fürstenau hat durch scincn Umban den
Character ciner mittelalterlichcn Bnrg eingebüßt, ist aber
in scincr jctzigcn Erscheinung ein malcrischcr und mit
Kiinstsinn cingerichtetcr Herrschaftssitz.
Die Einhardtillstlika M Stkinbach.
Blatt 8.
Bci Fürstcnau erblickcn wir schon von der Eisenbahii
aus, im Hintergrunde dcr Häuser dcs Ortcs Stcinbach, die
stattliche Ruine der sogen. Einhnrdbasilika. Sie ge-
hört zn dcn interessantesten und ältestcn kirchlichen Bau-
denkmälcrn des Odenwaldes. Die Gründung diescs Gottcs-
hauses geht bis in dic Zeiten Karls des Großen znrück
und wird dieselbe dem berühmten Einhard, Rathgeber und
Baumeister dieses Kaisers, zngeschrieben.
Vom ursprünglichen Bau steht nur noch das Mittel-
schiff nnd das nördliche Querschiff mit dcn Absiden. Jn
ncucstcr Zcit ist eS Herrn Profcssor Dr. Adamh an dcr
tcchnischcn Hochschule in Darmstadt gclungcn, dic knnst-
historische Bedcntnng und den nrsprünglichen Plan dieses
intcressanten Baudenkmales festzustellen. Diese vortreffliche
Arbeit, wclche im Jahre 1885 als Festgabe zum fünfzig-
jährigcn Jnbiläum des historischcn Vcreins für das Groß-
hcrzogthum Hcsscn crschiencn ist, konntc nur dnrch größere
Geldopfer, dic für dic Bcstrcitung der nöthigen Ansgra-
bnngcn crfordcrlich warc», znm Abschluß gebracht werdcn.
Von welchcr großen Bedentnng dicse Forschnngen für die
Aufkläruiigen unscrer altchristlichcn Architcktur sind, hat
Dr. Adamy in dcm Äapitcl: „Das Verhältniß dcr Ein-
hardbasilika in Steinbach zu andcren gleichzeitigen Basiliken"
klargestellt.
Wir verweisen auf diese geistreiche Auseinandcrsetzung
und fügen nnr noch bei, daß auch die noch gut crhaltcne
Abteikirche zu Payerne bei Avenchcs nach dcm Muster der
römischen Mancrn des nahcn Avcnticum, hier nach Art dcs
opns sxioatnm lährcnförmiges Bianerwerk), anfgcführt ist.
Der nördliche Anbau an dic Basilika zn Steinbach
zeigt schr dentlich den Unterschied dcr Tcchnik dcs scchzehnten
Jahrhunderts und den des zehntcn Jahrhundcrts, dort 30 om
hohe und 50—60 oin lange Quaderstücke mit gepreßten
Fugen, hier halb so hohe und 25—30 om langc keilförmig
in starke Mörtelfugcn eingepreßte Schichtstcine. Die Tuff-
steine wurden des leichteren Gewichtes halber gerne zu den
Wölbstcinen und dic Ziegelsteine zu dcn leichtcrcn Pfeilern
verwendet.
Die in Hausgärten stehcnde Ruine der Basilika ist
immer noch cin schr hervorragcndes Kunstbandcnkmal, das
anf dcn sachverständigen Beschaucr eincn nnvcrgeßlichcn
nnd erhabencn Eindruck auszuübcn gecignet ist.
Mögc dassclbe von Scitcn dcr Gräfl. Erbach'schcn
Hofgntsvcrwaltnng im jetzigcn Znstand crhaltcn werdcn.
Aas Schlost Crbach.
Blatt 5.
Mit Ansnahme des noch bestehcnden altcn riindcn Eck-
thurmcs ist das jctzigc geränmigc und hohe Schloßgcbüude
ein Knnstwerk des vorigen Jahrhundcrts. Ucber die Grün-
dung des Schlosses ist nichts bckannt; crst zur Zcit des
Hohenstaufen Conrad III. wird in Urkunden eines Eber-
hardns de Erbach gedacht, der alS Staminvater der Grafen
von Erbach betrachtet wird.
Scine Nachkommcn warcn pfälzischc Erbschcnken. Sie
spiclten nil AUttclalter als tapfcrc Kricgshcldcn einc große
Rolle und besaßen schon damals ein ansehnliches Gcbiet.
Jm Jahr 1532 wnrden sie in den Rcichsgrafcnstand
erhoben.
Die im Schloß bcsindlichcn Saiittiilungen genicßen ihrer
Seltcnheit halbcr cincn weit vcrbreiteten Nnf und sie sind
und bleiben der Gegenstand des Besuches der Gelehrten
und Altcrthnmsforscher von nahe und ferne. Der Schöpfer
dieses mit unermüdlichem Fleiße und großen Opfern errich-
tcten Museums ist der letzte reichsunmittelbare Graf
Franz I., welchem vor dcm Schloß cin. Standbild errichtet
ist. Das Städtchen zeichnet sich auch noch sonst durch
einige bemerkenswerthe ältere Gebänlichkeiten aus, wie das
Rathhaus (1594), das Haus der Echter von Mespelbrunn,
das sogen. Templerhaus und die sogen. Habermamisburg.
Bezüglich der Sehenswürdigkeiten des Schlosses, die
ihresgleichen in Süddcutschland nur noch im Schloß Sig-
maringen finden, verweiscn wir auf dic mit schöncn Ab-
bildungen versehene Beschrcibung derselben in dcm Wcrk
von Dr. Schaefcr.
Die Aufgabe, welchc wir nns gcstellt haben, ist mchr
aus der Absicht hervorgegangen, für die unterc Neckar-
gcgend iind dcn Odenwald cinc gedrängte Zusammciistellung
und Beschreibung der wichtigstcn Bandcnkmälcr zn gcbcn,
wie solchc dcr Tonrist diescr schöncn Gcgendcn gcrne auf-
sucht. Daß hierin die Burgen mit ihren hcrrlichen Lagcn
den crstcn Rang einnehmen und daß ich diesc als früherer
Festilngsingcnicur mit besondcrer Vorliebc bchandcltc, ist
in meinen Darstcllnngen wohl ersichtlich.
Dem Touristen und Alterthumsfrenndc ist dcr Bcsuch
des Schlosses von Enlbach sehr zn empfehlcn. Man findct
hicr auf der Höhe dcr römischen Vcrtheidiguiigslinic nicht
nur cin schönes Jagdschloß mit Park des Grafcn von
Erbach-Erbach, sondcrn auch einc schr intcrcssantc Saiimi-
lung von römischcn Bauthcilen und Sculptnrivcrkcn. Einc
kleine künstlich angclegtc Bnrg erinnert nns an dic mittcl-
alterliche Zeit.
Krerfrldkn nnd dir Crnt-Findk.
Blatt 6.
Ein anderer sehr intercssanter altcr Ort, den wir das
Mümmlingthal aufwärts gchcnd crreichcn, ist dic Stndt
Beerfeldcn, der frühere Hauptort dcr Cent glcichcn Namcns.
Hieran crinnert die auf der nahen Anhöhc stehcndc altc
nnd hohlc Linde mit dcm Galgcn. Dcr letztcrc bcstcht aus
drci etwa 5 m hohen stcincrnen Sänlen, welchc in Drcicck-
form aufgi tellt sind nnd anf wclche Balkcn mit jc zwci
daran hängciidcn Kcttcn anfgelcgt sind. Die Gestaltnng
dcr Sänlcn dcutct auf das Ende dcs siebcnzchiitcn Jahrhun-
derts, als dic Zeit der Erbauung, hin.
Es ist dicscr Galgenberg ein geschichtlich intcrcssantcr,
auch durch seine Rundsicht berühmtcr Ort und jedcr Bc-
und Vervollständigungen an den Umfassungsinauern nnd
Thorcingängen erfahren, lvie dic Burgcn.
Fiirstklmu.
Nnr eine Viertelstunde von Michclstadt steht das Schloß
Fürstcnan, die Nesidenz der Grafen von Erbach-Fnrstenau
iin Thalgrnndc des hier offencn und erweiterten Müinm-
lingthalcs; sie bildete einst eine sogen. Tiefburg, deren
Ringmauer von eincm breiten Wassergraben umgebcn lvar.
An dcn Ecken dieser meist ein Rechteck bildenden und
eincn klcincn Burghof cinschließenden Tiefbnrgen befinden
sich stark hcrvortrctende Thürme. Einer derselben zeichnet
sich stets dnrch cine besondere Stärke und Höhe aus und
dicntc so als Wartthnrin und Bergfried. Diese banliche
Anlage geht bei den burgundischen Bnrgen bis in das
dreizehnteJahrhundert zurück und dürfte bci unserenTiefburgen
als cinc Nachahmung derselben zu betrachten scin. So finden
wir auch am Schloß in Fürstenan in dcin südöstlichen,
thalanfwärts stehenden und der leichteren Angriffseite zugc-
kehrten Thnrm den Bergfried oder den Reduitthurm der
Schloßanlage. Längs der an die Ringmauer angelehnteu
Wohngebäudc ist auf Dachhöhe ein durchlaufcndcr mit
Schießlucken versehcner Wehrgang.
Das Schloß in Fürstenau hat durch scincn Umban den
Character ciner mittelalterlichcn Bnrg eingebüßt, ist aber
in scincr jctzigcn Erscheinung ein malcrischcr und mit
Kiinstsinn cingerichtetcr Herrschaftssitz.
Die Einhardtillstlika M Stkinbach.
Blatt 8.
Bci Fürstcnau erblickcn wir schon von der Eisenbahii
aus, im Hintergrunde dcr Häuser dcs Ortcs Stcinbach, die
stattliche Ruine der sogen. Einhnrdbasilika. Sie ge-
hört zn dcn interessantesten und ältestcn kirchlichen Bau-
denkmälcrn des Odenwaldes. Die Gründung diescs Gottcs-
hauses geht bis in dic Zeiten Karls des Großen znrück
und wird dieselbe dem berühmten Einhard, Rathgeber und
Baumeister dieses Kaisers, zngeschrieben.
Vom ursprünglichen Bau steht nur noch das Mittel-
schiff nnd das nördliche Querschiff mit dcn Absiden. Jn
ncucstcr Zcit ist eS Herrn Profcssor Dr. Adamh an dcr
tcchnischcn Hochschule in Darmstadt gclungcn, dic knnst-
historische Bedcntnng und den nrsprünglichen Plan dieses
intcressanten Baudenkmales festzustellen. Diese vortreffliche
Arbeit, wclche im Jahre 1885 als Festgabe zum fünfzig-
jährigcn Jnbiläum des historischcn Vcreins für das Groß-
hcrzogthum Hcsscn crschiencn ist, konntc nur dnrch größere
Geldopfer, dic für dic Bcstrcitung der nöthigen Ansgra-
bnngcn crfordcrlich warc», znm Abschluß gebracht werdcn.
Von welchcr großen Bedentnng dicse Forschnngen für die
Aufkläruiigen unscrer altchristlichcn Architcktur sind, hat
Dr. Adamy in dcm Äapitcl: „Das Verhältniß dcr Ein-
hardbasilika in Steinbach zu andcren gleichzeitigen Basiliken"
klargestellt.
Wir verweisen auf diese geistreiche Auseinandcrsetzung
und fügen nnr noch bei, daß auch die noch gut crhaltcne
Abteikirche zu Payerne bei Avenchcs nach dcm Muster der
römischen Mancrn des nahcn Avcnticum, hier nach Art dcs
opns sxioatnm lährcnförmiges Bianerwerk), anfgcführt ist.
Der nördliche Anbau an dic Basilika zn Steinbach
zeigt schr dentlich den Unterschied dcr Tcchnik dcs scchzehnten
Jahrhunderts und den des zehntcn Jahrhundcrts, dort 30 om
hohe und 50—60 oin lange Quaderstücke mit gepreßten
Fugen, hier halb so hohe und 25—30 om langc keilförmig
in starke Mörtelfugcn eingepreßte Schichtstcine. Die Tuff-
steine wurden des leichteren Gewichtes halber gerne zu den
Wölbstcinen und dic Ziegelsteine zu dcn leichtcrcn Pfeilern
verwendet.
Die in Hausgärten stehcnde Ruine der Basilika ist
immer noch cin schr hervorragcndes Kunstbandcnkmal, das
anf dcn sachverständigen Beschaucr eincn nnvcrgeßlichcn
nnd erhabencn Eindruck auszuübcn gecignet ist.
Mögc dassclbe von Scitcn dcr Gräfl. Erbach'schcn
Hofgntsvcrwaltnng im jetzigcn Znstand crhaltcn werdcn.
Aas Schlost Crbach.
Blatt 5.
Mit Ansnahme des noch bestehcnden altcn riindcn Eck-
thurmcs ist das jctzigc geränmigc und hohe Schloßgcbüude
ein Knnstwerk des vorigen Jahrhundcrts. Ucber die Grün-
dung des Schlosses ist nichts bckannt; crst zur Zcit des
Hohenstaufen Conrad III. wird in Urkunden eines Eber-
hardns de Erbach gedacht, der alS Staminvater der Grafen
von Erbach betrachtet wird.
Scine Nachkommcn warcn pfälzischc Erbschcnken. Sie
spiclten nil AUttclalter als tapfcrc Kricgshcldcn einc große
Rolle und besaßen schon damals ein ansehnliches Gcbiet.
Jm Jahr 1532 wnrden sie in den Rcichsgrafcnstand
erhoben.
Die im Schloß bcsindlichcn Saiittiilungen genicßen ihrer
Seltcnheit halbcr cincn weit vcrbreiteten Nnf und sie sind
und bleiben der Gegenstand des Besuches der Gelehrten
und Altcrthnmsforscher von nahe und ferne. Der Schöpfer
dieses mit unermüdlichem Fleiße und großen Opfern errich-
tcten Museums ist der letzte reichsunmittelbare Graf
Franz I., welchem vor dcm Schloß cin. Standbild errichtet
ist. Das Städtchen zeichnet sich auch noch sonst durch
einige bemerkenswerthe ältere Gebänlichkeiten aus, wie das
Rathhaus (1594), das Haus der Echter von Mespelbrunn,
das sogen. Templerhaus und die sogen. Habermamisburg.
Bezüglich der Sehenswürdigkeiten des Schlosses, die
ihresgleichen in Süddcutschland nur noch im Schloß Sig-
maringen finden, verweiscn wir auf dic mit schöncn Ab-
bildungen versehene Beschrcibung derselben in dcm Wcrk
von Dr. Schaefcr.
Die Aufgabe, welchc wir nns gcstellt haben, ist mchr
aus der Absicht hervorgegangen, für die unterc Neckar-
gcgend iind dcn Odenwald cinc gedrängte Zusammciistellung
und Beschreibung der wichtigstcn Bandcnkmälcr zn gcbcn,
wie solchc dcr Tonrist diescr schöncn Gcgendcn gcrne auf-
sucht. Daß hierin die Burgen mit ihren hcrrlichen Lagcn
den crstcn Rang einnehmen und daß ich diesc als früherer
Festilngsingcnicur mit besondcrer Vorliebc bchandcltc, ist
in meinen Darstcllnngen wohl ersichtlich.
Dem Touristen und Alterthumsfrenndc ist dcr Bcsuch
des Schlosses von Enlbach sehr zn empfehlcn. Man findct
hicr auf der Höhe dcr römischen Vcrtheidiguiigslinic nicht
nur cin schönes Jagdschloß mit Park des Grafcn von
Erbach-Erbach, sondcrn auch einc schr intcrcssantc Saiimi-
lung von römischcn Bauthcilen und Sculptnrivcrkcn. Einc
kleine künstlich angclegtc Bnrg erinnert nns an dic mittcl-
alterliche Zeit.
Krerfrldkn nnd dir Crnt-Findk.
Blatt 6.
Ein anderer sehr intercssanter altcr Ort, den wir das
Mümmlingthal aufwärts gchcnd crreichcn, ist dic Stndt
Beerfeldcn, der frühere Hauptort dcr Cent glcichcn Namcns.
Hieran crinnert die auf der nahen Anhöhc stehcndc altc
nnd hohlc Linde mit dcm Galgcn. Dcr letztcrc bcstcht aus
drci etwa 5 m hohen stcincrnen Sänlen, welchc in Drcicck-
form aufgi tellt sind nnd anf wclche Balkcn mit jc zwci
daran hängciidcn Kcttcn anfgelcgt sind. Die Gestaltnng
dcr Sänlcn dcutct auf das Ende dcs siebcnzchiitcn Jahrhun-
derts, als dic Zeit der Erbauung, hin.
Es ist dicscr Galgenberg ein geschichtlich intcrcssantcr,
auch durch seine Rundsicht berühmtcr Ort und jedcr Bc-