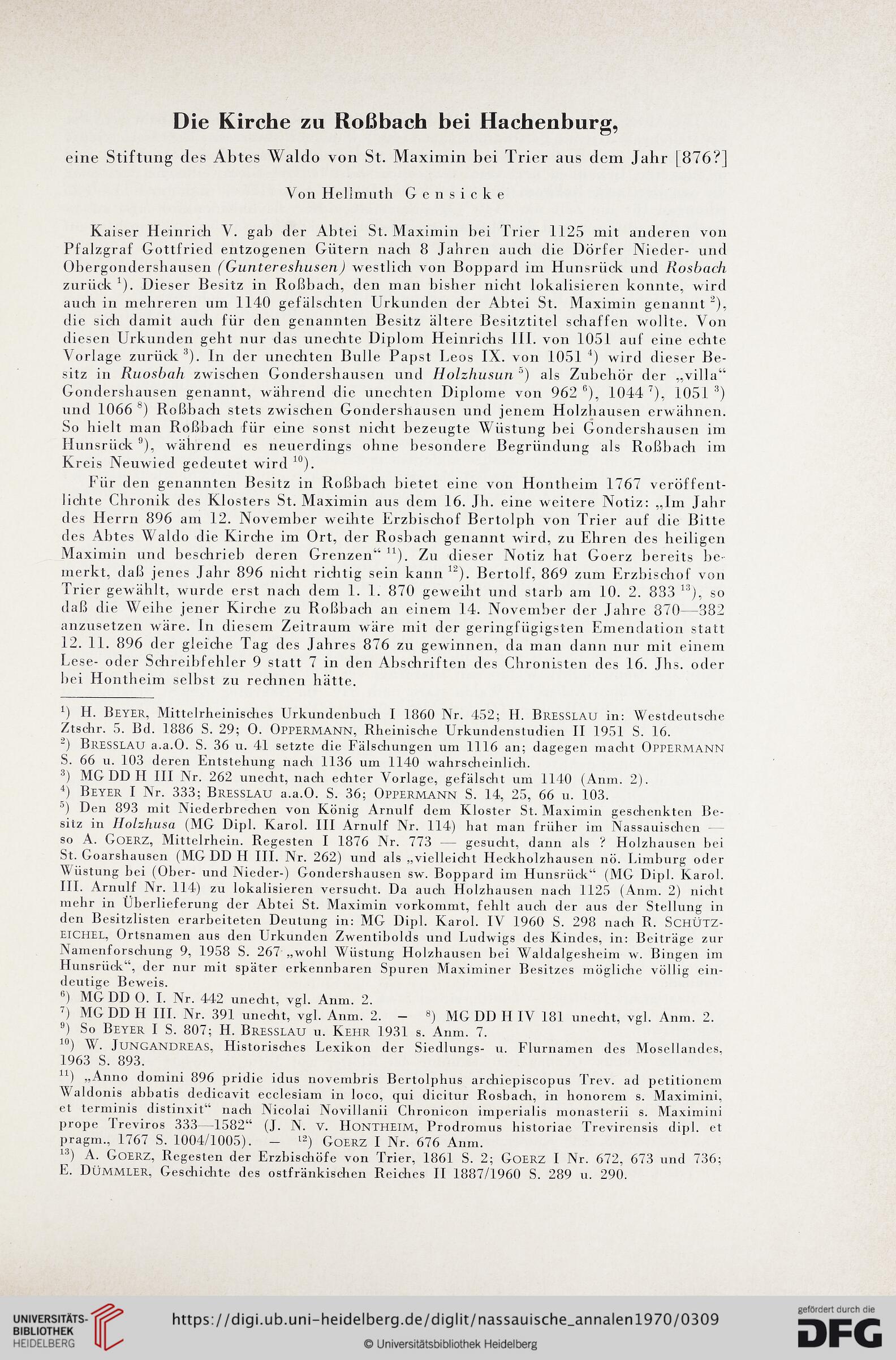Die Kirche zu Roßbach bei Hachenburg,
eine Stiftung des Abtes Waldo von St. Maximin bei Trier aus dem Jahr [876?]
Von Hellmuth Gensicke
Kaiser Heinrich V. gab der Abtei St. Maximin bei Trier 1125 mit anderen von
Pfalzgraf Gottfried entzogenen Gütern nach 8 Jahren auch die Dörfer Nieder- und
Obergondershausen (Guntereshusen) westlich von Boppard im Hunsrück und Rosbach
zurück '). Dieser Besitz in Roßbach, den man bisher nicht lokalisieren konnte, wird
auch in mehreren um 1140 gefälschten Urkunden der Abtei St. Maximin genannt2),
die sich damit auch für den genannten Besitz ältere Besitztitel schaffen wollte. Von
diesen Urkunden geht nur das unechte Diplom Heinrichs III. von 1051 auf eine echte
Vorlage zurück 3). In der unechten Bulle Papst Leos IX. von 1051 4) wird dieser Be-
sitz in Ruosbah zwischen Gondershausen und Holzhusun5) als Zubehör der „villa"
Gondershausen genannt, während die unechten Diplome von 962 6), 1044 '), 1051 3)
und 1066 8) Roßbach stets zwischen Gondershausen und jenem Holzhausen erwähnen.
So hielt man Roßbach für eine sonst nicht bezeugte Wüstung bei Gondershausen im
Hunsrück 9), während es neuerdings ohne besondere Begründung als Roßbach im
Kreis Neuwied gedeutet wird '°).
Für den genannten Besitz in Roßbach bietet eine von Hontheim 1767 veröffent-
lichte Chronik des Klosters St. Maximin aus dem 16. Jh. eine weitere Notiz: „Im Jahr
des Herrn 896 am 12. November weihte Erzbischof Bertolph von Trier auf die Bitte
des Abtes Waldo die Kirche im Ort, der Rosbach genannt wird, zu Ehren des heiligen
Maximin und beschrieb deren Grenzen" "). Zu dieser Notiz hat Goerz bereits be-
merkt, daß jenes Jahr 896 nicht richtig sein kann 12). Bertolf, 869 zum Erzbischof von
Trier gewählt, wurde erst nach dem 1. 1. 870 geweiht und starb am 10. 2. 833 13), so
daß die Weihe jener Kirche zu Roßbach an einem 14. November der Jahre 870—382
anzusetzen wäre. In diesem Zeitraum wäre mit der geringfügigsten Emendation statt
12. 11. 896 der gleiche Tag des Jahres 876 zu gewinnen, da man dann nur mit einem
Lese- oder Schreibfehler 9 statt 7 in den Abschriften des Chronisten des 16. Jhs. oder
bei Hontheim selbst zu rechnen hätte.
') H. Beyer, Mittelrheinisches Urkundenbuch I 1860 Nr. 452; H. Bresslau in: Westdeutsche
Ztschr. 5. Bd. 1886 S. 29; 0. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien II 1951 S. 16.
2) Bresslau a.a.O. S. 36 u. 41 setzte die Fälschungen um 1116 an; dagegen macht Oppermann
S. 66 u. 103 deren Entstehung nach 1136 um 1140 wahrscheinlich.
3) MG DD H III Nr. 262 unecht, nach echter Vorlage, gefälscht um 1140 (Anm. 2).
4) Beyer I Nr. 333; Bresslau a.a.O. S. 36; Oppermann S. 14, 25, 66 u. 103.
5) Den 893 mit Niederbrechen von König Arnulf dem Kloster St. Maximin geschenkten Be-
sitz in Holzhusa (MG Dipl. Karol. III Arnulf Nr. 114) hat man früher im Nassauischen
so A. Goerz, Mittelrhein. Regesten I 1876 Nr. 773 — gesucht, dann als ? Holzhausen hei
St. Goarshausen (MG DD H III. Nr. 262) und als „vielleicht Heckholzhausen nö. Limburg oder
Wüstung bei (Ober- und Nieder-) Gondershausen sw. Boppard im Hunsrück" (MG Dipl. Karol.
III. Arnulf Nr. 114) zu lokalisieren versucht. Da auch Holzhausen nach 1125 (Anm. 2) nicht
mehr in Überlieferung der Abtei St. Maximin vorkommt, fehlt auch der aus der Stellung in
den Besitzlisten erarbeiteten Deutung in: MG Dipl. Karol. IV 1960 S. 298 nach R. SCHÜTZ-
EICHEL, Ortsnamen aus den Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes, in: Beiträge zur
Namenforschung 9, 1958 S. 267 „wohl Wüstung Holzhausen bei Waldalgesheim w. Bingen im
Hunsrück", der nur mit später erkennbaren Spuren Maximiner Besitzes mögliche völlig ein-
deutige Beweis.
6) MG DD 0. I. Nr. 442 unecht, vgl. Anm. 2.
7) MG DD H III. Nr. 391 unecht, vgl. Anm. 2. — 8) MG DD H IV 181 unecht, vgl. Anm. 2.
9) So Beyer I S. 807; H. Bresslau u. Kehr 1931 s. Anm. 7.
10) W. Jungandreas, Historisches Lexikon der Siedlungs- u. Flurnamen des Mosellandes,
1963 S. 893.
„Anno domini 896 pridie idus novembris Bertolphus archiepiscopus Trev. ad petitionem
Waldonis abbatis dedicavit ecclesiam in loco, qui dicitur Rosbach, in honorem s. Maximini,
et terminis distinxit" nach Nicolai Novillanii Chronicon imperialis monasterii s. Maximini
prope Treviros 333—1582" (J. N. V. HONTHEIM, Prodromus historiae Trevirensis dipl. et
pragm., 1767 S. 1004/1005). — l2) Goerz I Nr. 676 Anm.
13) A. Goerz, Regesten der Erzbischöfe von Trier, 1861 S. 2; Goerz I Nr. 672, 673 und 736;
E. DÜMMLER, Geschichte des ostfränkischen Reiches II 1887/1960 S. 289 u. 290.
eine Stiftung des Abtes Waldo von St. Maximin bei Trier aus dem Jahr [876?]
Von Hellmuth Gensicke
Kaiser Heinrich V. gab der Abtei St. Maximin bei Trier 1125 mit anderen von
Pfalzgraf Gottfried entzogenen Gütern nach 8 Jahren auch die Dörfer Nieder- und
Obergondershausen (Guntereshusen) westlich von Boppard im Hunsrück und Rosbach
zurück '). Dieser Besitz in Roßbach, den man bisher nicht lokalisieren konnte, wird
auch in mehreren um 1140 gefälschten Urkunden der Abtei St. Maximin genannt2),
die sich damit auch für den genannten Besitz ältere Besitztitel schaffen wollte. Von
diesen Urkunden geht nur das unechte Diplom Heinrichs III. von 1051 auf eine echte
Vorlage zurück 3). In der unechten Bulle Papst Leos IX. von 1051 4) wird dieser Be-
sitz in Ruosbah zwischen Gondershausen und Holzhusun5) als Zubehör der „villa"
Gondershausen genannt, während die unechten Diplome von 962 6), 1044 '), 1051 3)
und 1066 8) Roßbach stets zwischen Gondershausen und jenem Holzhausen erwähnen.
So hielt man Roßbach für eine sonst nicht bezeugte Wüstung bei Gondershausen im
Hunsrück 9), während es neuerdings ohne besondere Begründung als Roßbach im
Kreis Neuwied gedeutet wird '°).
Für den genannten Besitz in Roßbach bietet eine von Hontheim 1767 veröffent-
lichte Chronik des Klosters St. Maximin aus dem 16. Jh. eine weitere Notiz: „Im Jahr
des Herrn 896 am 12. November weihte Erzbischof Bertolph von Trier auf die Bitte
des Abtes Waldo die Kirche im Ort, der Rosbach genannt wird, zu Ehren des heiligen
Maximin und beschrieb deren Grenzen" "). Zu dieser Notiz hat Goerz bereits be-
merkt, daß jenes Jahr 896 nicht richtig sein kann 12). Bertolf, 869 zum Erzbischof von
Trier gewählt, wurde erst nach dem 1. 1. 870 geweiht und starb am 10. 2. 833 13), so
daß die Weihe jener Kirche zu Roßbach an einem 14. November der Jahre 870—382
anzusetzen wäre. In diesem Zeitraum wäre mit der geringfügigsten Emendation statt
12. 11. 896 der gleiche Tag des Jahres 876 zu gewinnen, da man dann nur mit einem
Lese- oder Schreibfehler 9 statt 7 in den Abschriften des Chronisten des 16. Jhs. oder
bei Hontheim selbst zu rechnen hätte.
') H. Beyer, Mittelrheinisches Urkundenbuch I 1860 Nr. 452; H. Bresslau in: Westdeutsche
Ztschr. 5. Bd. 1886 S. 29; 0. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien II 1951 S. 16.
2) Bresslau a.a.O. S. 36 u. 41 setzte die Fälschungen um 1116 an; dagegen macht Oppermann
S. 66 u. 103 deren Entstehung nach 1136 um 1140 wahrscheinlich.
3) MG DD H III Nr. 262 unecht, nach echter Vorlage, gefälscht um 1140 (Anm. 2).
4) Beyer I Nr. 333; Bresslau a.a.O. S. 36; Oppermann S. 14, 25, 66 u. 103.
5) Den 893 mit Niederbrechen von König Arnulf dem Kloster St. Maximin geschenkten Be-
sitz in Holzhusa (MG Dipl. Karol. III Arnulf Nr. 114) hat man früher im Nassauischen
so A. Goerz, Mittelrhein. Regesten I 1876 Nr. 773 — gesucht, dann als ? Holzhausen hei
St. Goarshausen (MG DD H III. Nr. 262) und als „vielleicht Heckholzhausen nö. Limburg oder
Wüstung bei (Ober- und Nieder-) Gondershausen sw. Boppard im Hunsrück" (MG Dipl. Karol.
III. Arnulf Nr. 114) zu lokalisieren versucht. Da auch Holzhausen nach 1125 (Anm. 2) nicht
mehr in Überlieferung der Abtei St. Maximin vorkommt, fehlt auch der aus der Stellung in
den Besitzlisten erarbeiteten Deutung in: MG Dipl. Karol. IV 1960 S. 298 nach R. SCHÜTZ-
EICHEL, Ortsnamen aus den Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes, in: Beiträge zur
Namenforschung 9, 1958 S. 267 „wohl Wüstung Holzhausen bei Waldalgesheim w. Bingen im
Hunsrück", der nur mit später erkennbaren Spuren Maximiner Besitzes mögliche völlig ein-
deutige Beweis.
6) MG DD 0. I. Nr. 442 unecht, vgl. Anm. 2.
7) MG DD H III. Nr. 391 unecht, vgl. Anm. 2. — 8) MG DD H IV 181 unecht, vgl. Anm. 2.
9) So Beyer I S. 807; H. Bresslau u. Kehr 1931 s. Anm. 7.
10) W. Jungandreas, Historisches Lexikon der Siedlungs- u. Flurnamen des Mosellandes,
1963 S. 893.
„Anno domini 896 pridie idus novembris Bertolphus archiepiscopus Trev. ad petitionem
Waldonis abbatis dedicavit ecclesiam in loco, qui dicitur Rosbach, in honorem s. Maximini,
et terminis distinxit" nach Nicolai Novillanii Chronicon imperialis monasterii s. Maximini
prope Treviros 333—1582" (J. N. V. HONTHEIM, Prodromus historiae Trevirensis dipl. et
pragm., 1767 S. 1004/1005). — l2) Goerz I Nr. 676 Anm.
13) A. Goerz, Regesten der Erzbischöfe von Trier, 1861 S. 2; Goerz I Nr. 672, 673 und 736;
E. DÜMMLER, Geschichte des ostfränkischen Reiches II 1887/1960 S. 289 u. 290.