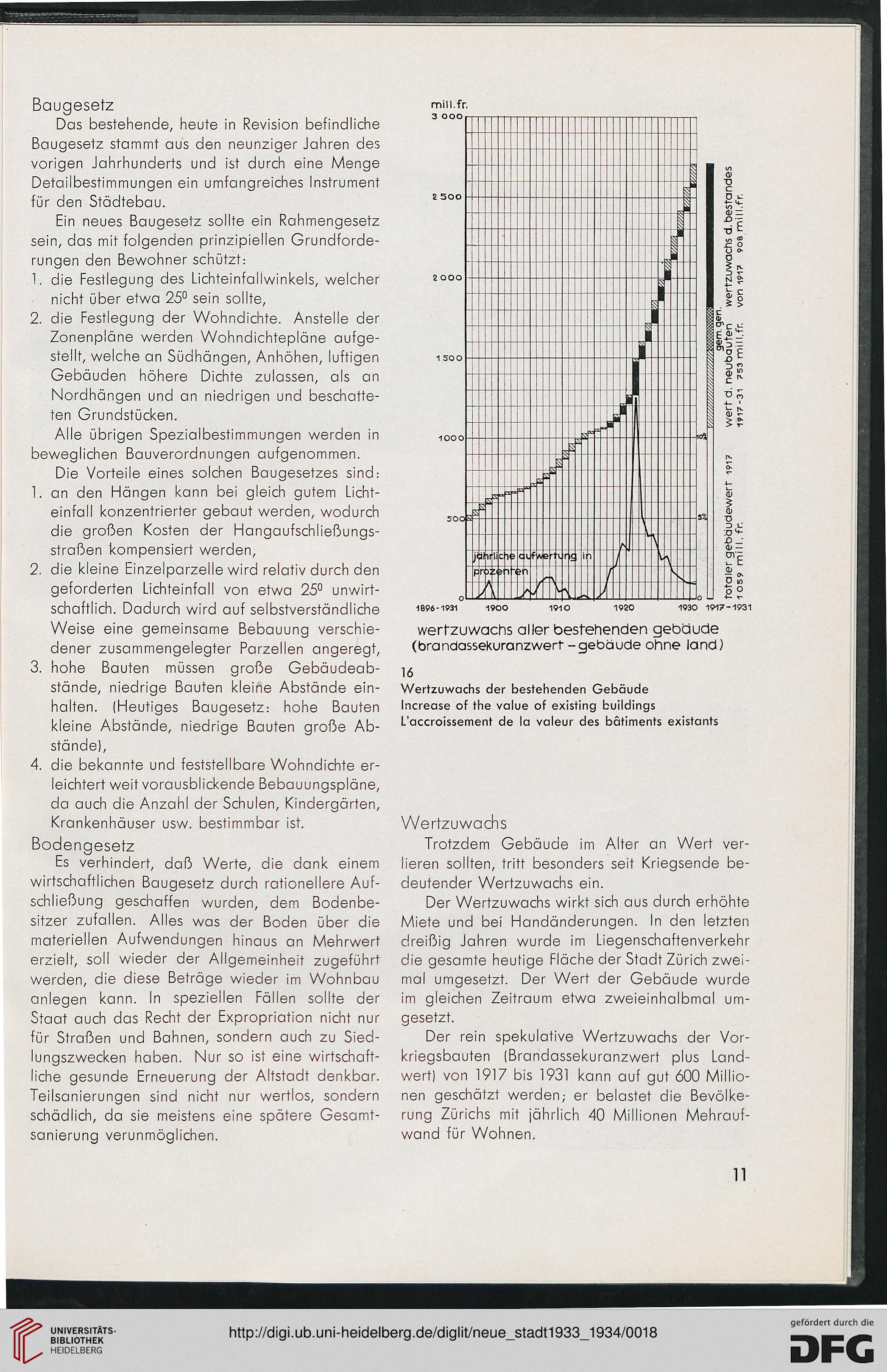Baugesetz
Das bestehende, heute in Revision befindliche
Baugesetz stammt aus den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts und ist durch eine Menge
Detailbestimmungen ein umfangreiches Instrument
für den Städtebau.
Ein neues Baugesetz sollte ein Rahmengesetz
sein, das mit folgenden prinzipiellen Grundforde-
rungen den Bewohner schützt:
1. die Festlegung des Lichteinfallwinkels, welcher
nicht über etwa 25° sein sollte,
2. die Festlegung der Wohndichte. Anstelle der
Zonenpläne werden Wohndichtepläne aufge-
stellt, welche an Südhängen, Anhöhen, luftigen
Gebäuden höhere Dichte zulassen, als an
Nordhängen und an niedrigen und beschatte-
ten Grundstücken.
Alle übrigen Spezialbestimmungen werden in
beweglichen Bauverordnungen aufgenommen.
Die Vorteile eines solchen Baugesetzes sind:
1. an den Hängen kann bei gleich gutem Licht-
einfall konzentrierter gebaut werden, wodurch
die großen Kosten der Hangaufschließungs-
straßen kompensiert werden,
2. die kleine Einzelparzelle wird relativ durch den
geforderten Lichteinfall von etwa 25° unwirt-
schaftlich. Dadurch wird auf selbstverständliche
Weise eine gemeinsame Bebauung verschie-
dener zusammengelegter Parzellen angeregt,
3. hohe Bauten müssen große Gebäudeab-
stände, niedrige Bauten kleine Abstände ein-
halten. (Heutiges Baugesetz: hohe Bauten
kleine Abstände, niedrige Bauten große Ab-
stände),
4. die bekannte und feststellbare Wohndichte er-
leichtert weit vorausblickende Bebauungspläne,
da auch die Anzahl der Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser usw. bestimmbar ist.
Bodengesetz
Es verhindert, daß Werte, die dank einem
wirtschaftlichen Baugesetz durch rationellere Auf-
schließung geschaffen v/urden, dem Bodenbe-
sitzer zufallen. Alles was der Boden über die
materiellen Aufwendungen hinaus an Mehrwert
erzielt, soll wieder der Allgemeinheit zugeführt
werden, die diese Beträge wieder im Wohnbau
anlegen kann. In spezieilen Fällen sollte der
Staat auch das Recht der Expropriation nicht nur
für Straßen und Bahnen, sondern auch zu Sied-
lungszwecken haben. Nur so ist eine wirtschaft-
liche gesunde Erneuerung der Altstadt denkbar.
Teilsanierungen sind nicht nur wertlos, sondern
schädlich, da sie meistens eine spätere Gesamt-
sanierung verunmöglichen.
miii.fr.
3 OOOr
1896-1931 1900 1910 1920 1930 1917-1931
Wertzuwachs aller bestehenden gebäude
(brandassekuranzwert -gebäude ohne land)
16
Wertzuwachs der bestehenden Gebäude
Increase of the value of existing buildings
L'accroissement de la valeur des bätiments existants
Wertzuwachs
Trotzdem Gebäude im Alter an Wert ver-
lieren sollten, tritt besonders seit Kriegsende be-
deutender Wertzuwachs ein.
Der Wertzuwachs wirkt sich aus durch erhöhte
Miete und bei Handänderungen. In den letzten
dreißig Jahren wurde im Liegenschaftenverkehr
die gesamte heutige Fläche der Stadt Zürich zwei-
mal umgesetzt. Der Wert der Gebäude wurde
im gleichen Zeitraum etwa zweieinhalbmal um-
gesetzt.
Der rein spekulative Wertzuwachs der Vor-
kriegsbauten (Brandassekuranzwert plus Land-
wert] von 1917 bis 1931 kann auf gut 600 Millio-
nen geschätzt werden; er belastet die Bevölke-
rung Zürichs mit jährlich 40 Millionen Mehrauf-
wand für Wohnen.
11
Das bestehende, heute in Revision befindliche
Baugesetz stammt aus den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts und ist durch eine Menge
Detailbestimmungen ein umfangreiches Instrument
für den Städtebau.
Ein neues Baugesetz sollte ein Rahmengesetz
sein, das mit folgenden prinzipiellen Grundforde-
rungen den Bewohner schützt:
1. die Festlegung des Lichteinfallwinkels, welcher
nicht über etwa 25° sein sollte,
2. die Festlegung der Wohndichte. Anstelle der
Zonenpläne werden Wohndichtepläne aufge-
stellt, welche an Südhängen, Anhöhen, luftigen
Gebäuden höhere Dichte zulassen, als an
Nordhängen und an niedrigen und beschatte-
ten Grundstücken.
Alle übrigen Spezialbestimmungen werden in
beweglichen Bauverordnungen aufgenommen.
Die Vorteile eines solchen Baugesetzes sind:
1. an den Hängen kann bei gleich gutem Licht-
einfall konzentrierter gebaut werden, wodurch
die großen Kosten der Hangaufschließungs-
straßen kompensiert werden,
2. die kleine Einzelparzelle wird relativ durch den
geforderten Lichteinfall von etwa 25° unwirt-
schaftlich. Dadurch wird auf selbstverständliche
Weise eine gemeinsame Bebauung verschie-
dener zusammengelegter Parzellen angeregt,
3. hohe Bauten müssen große Gebäudeab-
stände, niedrige Bauten kleine Abstände ein-
halten. (Heutiges Baugesetz: hohe Bauten
kleine Abstände, niedrige Bauten große Ab-
stände),
4. die bekannte und feststellbare Wohndichte er-
leichtert weit vorausblickende Bebauungspläne,
da auch die Anzahl der Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser usw. bestimmbar ist.
Bodengesetz
Es verhindert, daß Werte, die dank einem
wirtschaftlichen Baugesetz durch rationellere Auf-
schließung geschaffen v/urden, dem Bodenbe-
sitzer zufallen. Alles was der Boden über die
materiellen Aufwendungen hinaus an Mehrwert
erzielt, soll wieder der Allgemeinheit zugeführt
werden, die diese Beträge wieder im Wohnbau
anlegen kann. In spezieilen Fällen sollte der
Staat auch das Recht der Expropriation nicht nur
für Straßen und Bahnen, sondern auch zu Sied-
lungszwecken haben. Nur so ist eine wirtschaft-
liche gesunde Erneuerung der Altstadt denkbar.
Teilsanierungen sind nicht nur wertlos, sondern
schädlich, da sie meistens eine spätere Gesamt-
sanierung verunmöglichen.
miii.fr.
3 OOOr
1896-1931 1900 1910 1920 1930 1917-1931
Wertzuwachs aller bestehenden gebäude
(brandassekuranzwert -gebäude ohne land)
16
Wertzuwachs der bestehenden Gebäude
Increase of the value of existing buildings
L'accroissement de la valeur des bätiments existants
Wertzuwachs
Trotzdem Gebäude im Alter an Wert ver-
lieren sollten, tritt besonders seit Kriegsende be-
deutender Wertzuwachs ein.
Der Wertzuwachs wirkt sich aus durch erhöhte
Miete und bei Handänderungen. In den letzten
dreißig Jahren wurde im Liegenschaftenverkehr
die gesamte heutige Fläche der Stadt Zürich zwei-
mal umgesetzt. Der Wert der Gebäude wurde
im gleichen Zeitraum etwa zweieinhalbmal um-
gesetzt.
Der rein spekulative Wertzuwachs der Vor-
kriegsbauten (Brandassekuranzwert plus Land-
wert] von 1917 bis 1931 kann auf gut 600 Millio-
nen geschätzt werden; er belastet die Bevölke-
rung Zürichs mit jährlich 40 Millionen Mehrauf-
wand für Wohnen.
11