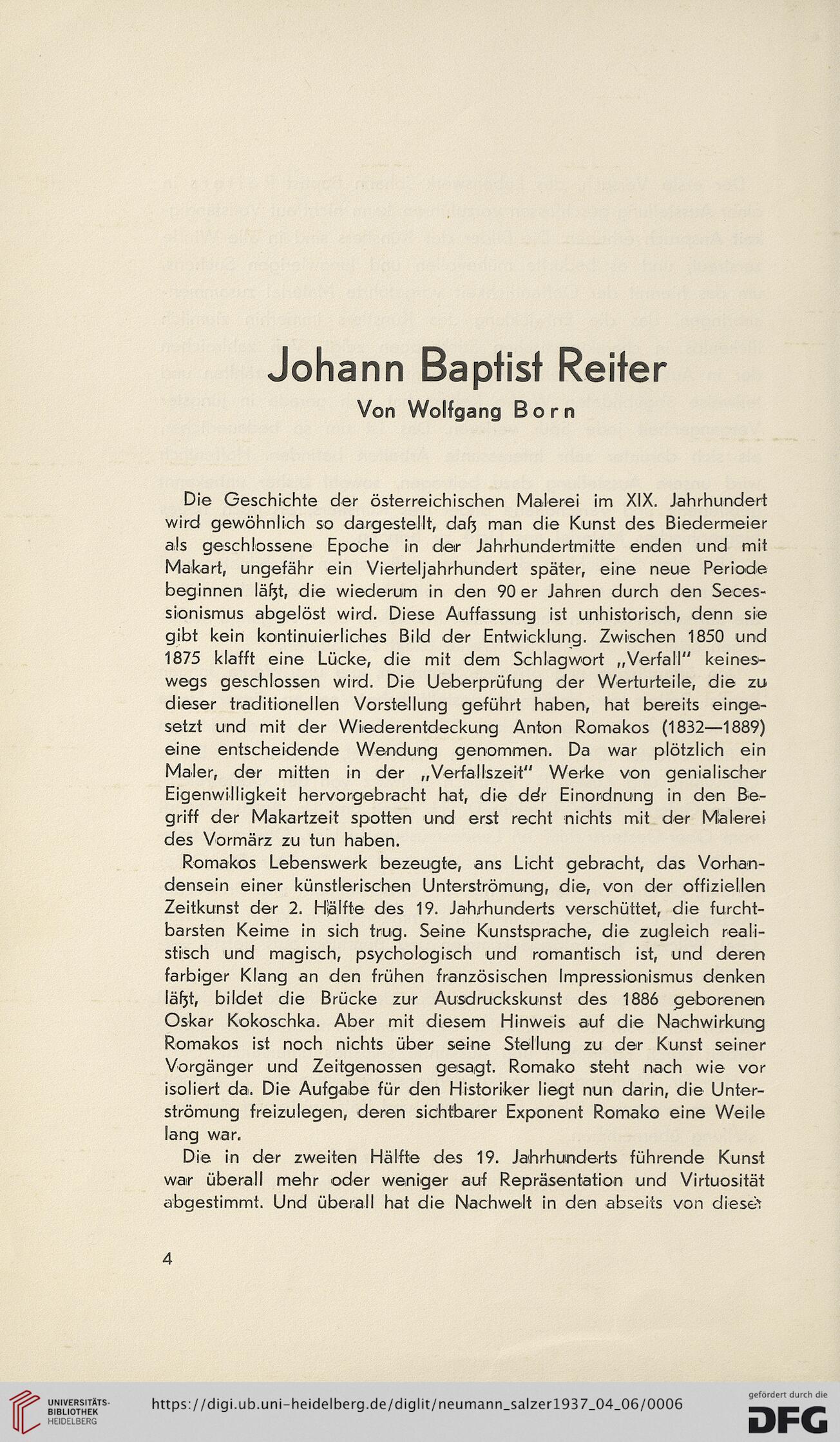Johann Baptist Reiter
Von Wolfgang Born
Die Geschichte der österreichischen Malerei im XIX. Jahrhundert
wird gewöhnlich so dargestellt, dafj man die Kunst des Biedermeier
als geschlossene Epoche in der Jahrhundertmitte enden und mit
Makart, ungefähr ein Vierteljahrhundert später, eine neue Periode
beginnen läfjt, die wiederum in den 90 er Jahren durch den Seces-
sionismus abgelöst wird. Diese Auffassung ist unhistorisch, denn sie
gibt kein kontinuierliches Bild der Entwicklung. Zwischen 1850 und
1875 klafft eine Lücke, die mit dem Schlagwort „Verfall" keines-
wegs geschlossen wird. Die Ueberprüfung der Werturteile, die zu
dieser traditionellen Vorstellung geführt haben, hat bereits einge-
setzt und mit der Wiederentdeckung Anton Romakos (1832—1889)
eine entscheidende Wendung genommen. Da war plötzlich ein
Maler, der mitten in der „Verfallszeit" Werke von genialischer
Eigenwilligkeit hervorgebracht hat, die ddr Einordnung in den Be-
griff der Makartzeit spotten und erst recht nichts mit der Malerei
des Vormärz zu tun haben.
Romakos Lebenswerk bezeugte, ans Licht gebracht, das Vorhan-
densein einer künstlerischen Unterströmung, die, von der offiziellen
Zeitkunst der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts verschüttet, die furcht-
barsten Keime in sich trug. Seine Kunstsprache, die zugleich reali-
stisch und magisch, psychologisch und romantisch ist, und deren
farbiger Klang an den frühen französischen Impressionismus denken
läfjt, bildet die Brücke zur Ausdruckskunst des 1886 geborenen
Oskar Kokoschka. Aber mit diesem Hinweis auf die Nachwirkung
Romakos ist noch nichts über seine Stellung zu der Kunst seiner
Vorgänger und Zeitgenossen gesagt. Romako steht nach wie vor
isoliert da. Die Aufgabe für den Historiker liegt nun darin, die Unter-
strömung freizulegen, deren sichtbarer Exponent Romako eine Weile
lang war.
Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führende Kunst
war überall mehr oder weniger auf Repräsentation und Virtuosität
abgestimmt. Und überall hat die Nachwelt in den abseits von dieser
4
Von Wolfgang Born
Die Geschichte der österreichischen Malerei im XIX. Jahrhundert
wird gewöhnlich so dargestellt, dafj man die Kunst des Biedermeier
als geschlossene Epoche in der Jahrhundertmitte enden und mit
Makart, ungefähr ein Vierteljahrhundert später, eine neue Periode
beginnen läfjt, die wiederum in den 90 er Jahren durch den Seces-
sionismus abgelöst wird. Diese Auffassung ist unhistorisch, denn sie
gibt kein kontinuierliches Bild der Entwicklung. Zwischen 1850 und
1875 klafft eine Lücke, die mit dem Schlagwort „Verfall" keines-
wegs geschlossen wird. Die Ueberprüfung der Werturteile, die zu
dieser traditionellen Vorstellung geführt haben, hat bereits einge-
setzt und mit der Wiederentdeckung Anton Romakos (1832—1889)
eine entscheidende Wendung genommen. Da war plötzlich ein
Maler, der mitten in der „Verfallszeit" Werke von genialischer
Eigenwilligkeit hervorgebracht hat, die ddr Einordnung in den Be-
griff der Makartzeit spotten und erst recht nichts mit der Malerei
des Vormärz zu tun haben.
Romakos Lebenswerk bezeugte, ans Licht gebracht, das Vorhan-
densein einer künstlerischen Unterströmung, die, von der offiziellen
Zeitkunst der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts verschüttet, die furcht-
barsten Keime in sich trug. Seine Kunstsprache, die zugleich reali-
stisch und magisch, psychologisch und romantisch ist, und deren
farbiger Klang an den frühen französischen Impressionismus denken
läfjt, bildet die Brücke zur Ausdruckskunst des 1886 geborenen
Oskar Kokoschka. Aber mit diesem Hinweis auf die Nachwirkung
Romakos ist noch nichts über seine Stellung zu der Kunst seiner
Vorgänger und Zeitgenossen gesagt. Romako steht nach wie vor
isoliert da. Die Aufgabe für den Historiker liegt nun darin, die Unter-
strömung freizulegen, deren sichtbarer Exponent Romako eine Weile
lang war.
Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führende Kunst
war überall mehr oder weniger auf Repräsentation und Virtuosität
abgestimmt. Und überall hat die Nachwelt in den abseits von dieser
4