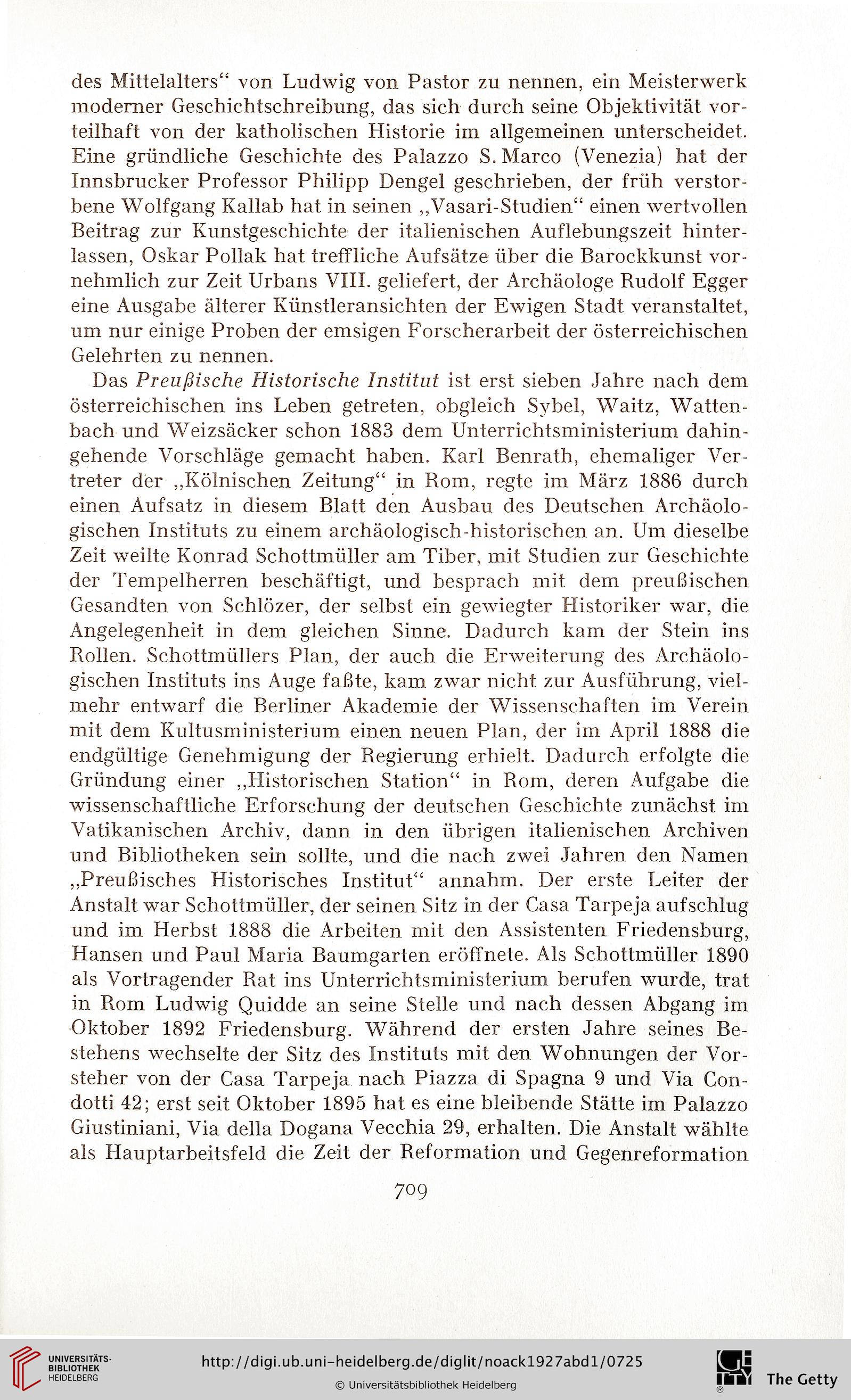des Mittelalters" von Ludwig von Pastor zu nennen, ein Meisterwerk
moderner Geschichtschreibung, das sich durch seine Objektivität vor-
teilhaft von der katholischen Historie im allgemeinen unterscheidet.
Eine gründliche Geschichte des Palazzo S. Marco (Venezia) hat der
Innsbrucker Professor Philipp Dengel geschrieben, der früh verstor-
bene Wolfgang Kallab hat in seinen ,,Vasari-Studien" einen wertvollen
Beitrag zur Kunstgeschichte der italienischen Auflebungszeit hinter-
lassen, Oskar Pollak hat treffliche Aufsätze über die Barockkunst vor-
nehmlich zur Zeit Urbans VIII. geliefert, der Archäologe Rudolf Egger
eine Ausgabe älterer Künstleransichten der Ewigen Stadt veranstaltet,
um nur einige Proben der emsigen Forscherarbeit der österreichischen
Gelehrten zu nennen.
Das Preußische Historische Institut ist erst sieben Jahre nach dem
österreichischen ins Leben getreten, obgleich Sybel, Waitz, Watten-
bach und Weizsäcker schon 1883 dem Unterrichtsministerium dahin-
gehende Vorschläge gemacht haben. Karl Benrath, ehemaliger Ver-
treter der ,,Kölnischen Zeitung" in Rom, regte im März 1886 durch
einen Aufsatz in diesem Blatt den Ausbau des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts zu einem archäologisch-historischen an. Um dieselbe
Zeit weilte Konrad Schottmüller am Tiber, mit Studien zur Geschichte
der Tempelherren beschäftigt, und besprach mit dem preußischen
Gesandten von Schlözer, der selbst ein gewiegter Historiker war, die
Angelegenheit in dem gleichen Sinne. Dadurch kam der Stein ins
Rollen. Schottmüllers Plan, der auch die Erweiterung des Archäolo-
gischen Instituts ins Auge faßte, kam zwar nicht zur Ausführung, viel-
mehr entwarf die Berliner Akademie der Wissenschaften im Verein
mit dem Kultusministerium einen neuen Plan, der im April 1888 die
endgültige Genehmigung der Regierung erhielt. Dadurch erfolgte die
Gründung einer ,.Historischen Station" in Rom, deren Aufgabe die
wissenschaftliche Erforschung der deutschen Geschichte zunächst im
Vatikanischen Archiv, dann in den übrigen italienischen Archiven
und Bibliotheken sein sollte, und die nach zwei Jahren den Namen
,,Preußisches Historisches Institut" annahm. Der erste Leiter der
Anstalt war Schottmüller, der seinen Sitz in der Gasa Tarpeja aufschlug
und im Herbst 1888 die Arbeiten mit den Assistenten Friedensburg,
Hansen und Paul Maria Baumgarten eröffnete. Als Schottmüller 1890
als Vortragender Rat ins Unterrichtsministerium berufen wurde, trat
in Rom Ludwig Quidde an seine Stelle und nach dessen Abgang im
Oktober 1892 Friedensburg. Während der ersten Jahre seines Be-
stehens wechselte der Sitz des Instituts mit den Wohnungen der Vor-
steher von der Gasa Tarpeja nach Piazza di Spagna 9 und Via Con-
dotti 42; erst seit Oktober 1895 hat es eine bleibende Stätte im Palazzo
Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29, erhalten. Die Anstalt wählte
als Hauptarbeitsfeld die Zeit der Reformation und Gegenreformation
709
moderner Geschichtschreibung, das sich durch seine Objektivität vor-
teilhaft von der katholischen Historie im allgemeinen unterscheidet.
Eine gründliche Geschichte des Palazzo S. Marco (Venezia) hat der
Innsbrucker Professor Philipp Dengel geschrieben, der früh verstor-
bene Wolfgang Kallab hat in seinen ,,Vasari-Studien" einen wertvollen
Beitrag zur Kunstgeschichte der italienischen Auflebungszeit hinter-
lassen, Oskar Pollak hat treffliche Aufsätze über die Barockkunst vor-
nehmlich zur Zeit Urbans VIII. geliefert, der Archäologe Rudolf Egger
eine Ausgabe älterer Künstleransichten der Ewigen Stadt veranstaltet,
um nur einige Proben der emsigen Forscherarbeit der österreichischen
Gelehrten zu nennen.
Das Preußische Historische Institut ist erst sieben Jahre nach dem
österreichischen ins Leben getreten, obgleich Sybel, Waitz, Watten-
bach und Weizsäcker schon 1883 dem Unterrichtsministerium dahin-
gehende Vorschläge gemacht haben. Karl Benrath, ehemaliger Ver-
treter der ,,Kölnischen Zeitung" in Rom, regte im März 1886 durch
einen Aufsatz in diesem Blatt den Ausbau des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts zu einem archäologisch-historischen an. Um dieselbe
Zeit weilte Konrad Schottmüller am Tiber, mit Studien zur Geschichte
der Tempelherren beschäftigt, und besprach mit dem preußischen
Gesandten von Schlözer, der selbst ein gewiegter Historiker war, die
Angelegenheit in dem gleichen Sinne. Dadurch kam der Stein ins
Rollen. Schottmüllers Plan, der auch die Erweiterung des Archäolo-
gischen Instituts ins Auge faßte, kam zwar nicht zur Ausführung, viel-
mehr entwarf die Berliner Akademie der Wissenschaften im Verein
mit dem Kultusministerium einen neuen Plan, der im April 1888 die
endgültige Genehmigung der Regierung erhielt. Dadurch erfolgte die
Gründung einer ,.Historischen Station" in Rom, deren Aufgabe die
wissenschaftliche Erforschung der deutschen Geschichte zunächst im
Vatikanischen Archiv, dann in den übrigen italienischen Archiven
und Bibliotheken sein sollte, und die nach zwei Jahren den Namen
,,Preußisches Historisches Institut" annahm. Der erste Leiter der
Anstalt war Schottmüller, der seinen Sitz in der Gasa Tarpeja aufschlug
und im Herbst 1888 die Arbeiten mit den Assistenten Friedensburg,
Hansen und Paul Maria Baumgarten eröffnete. Als Schottmüller 1890
als Vortragender Rat ins Unterrichtsministerium berufen wurde, trat
in Rom Ludwig Quidde an seine Stelle und nach dessen Abgang im
Oktober 1892 Friedensburg. Während der ersten Jahre seines Be-
stehens wechselte der Sitz des Instituts mit den Wohnungen der Vor-
steher von der Gasa Tarpeja nach Piazza di Spagna 9 und Via Con-
dotti 42; erst seit Oktober 1895 hat es eine bleibende Stätte im Palazzo
Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29, erhalten. Die Anstalt wählte
als Hauptarbeitsfeld die Zeit der Reformation und Gegenreformation
709