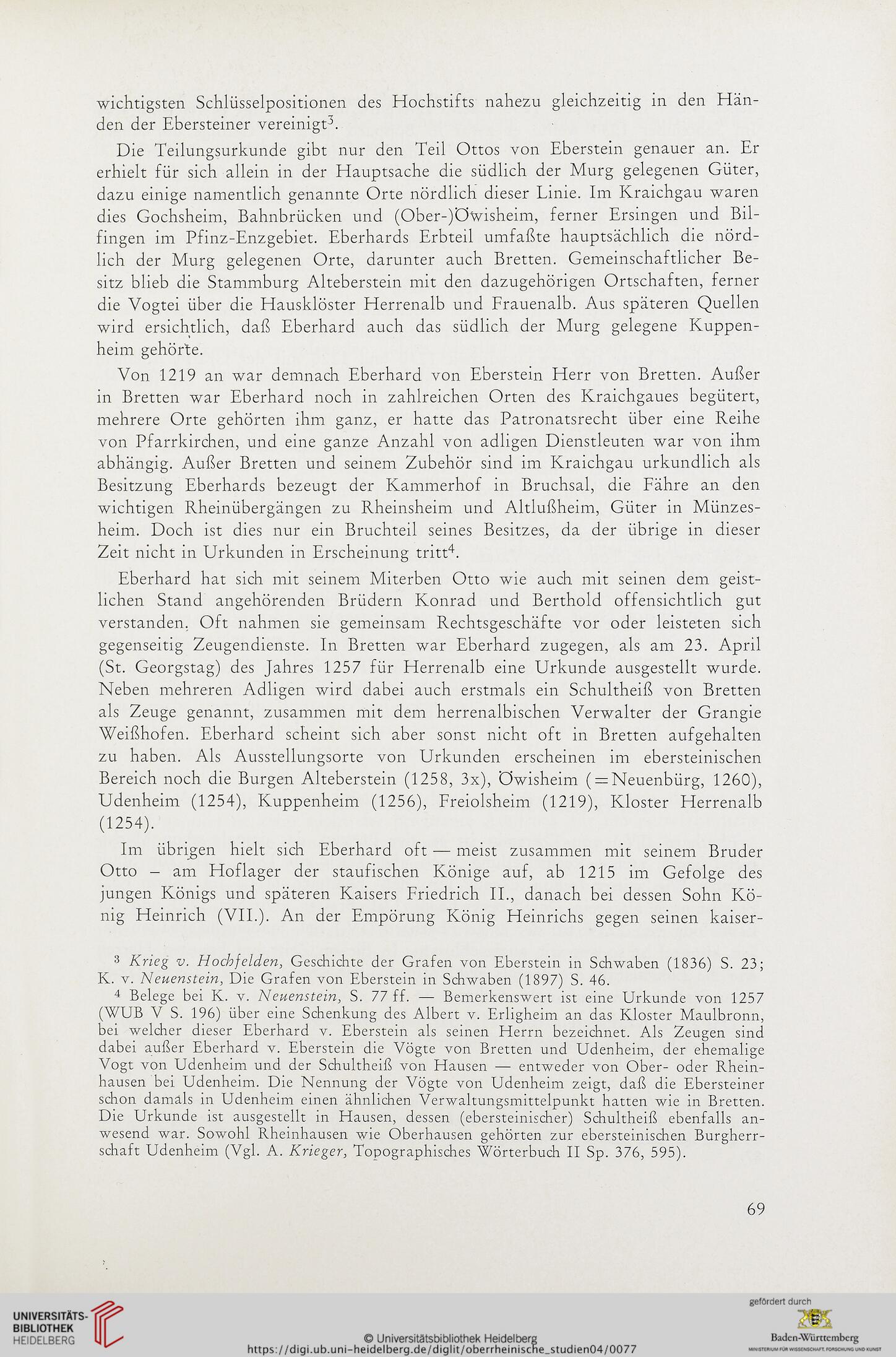wichtigsten Schlüsselpositionen des Hochstifts nahezu gleichzeitig in den Hän-
den der Ebersteiner vereinigt3.
Die Teilungsurkunde gibt nur den Teil Ottos von Eberstein genauer an. Er
erhielt für sich allein in der Hauptsache die südlich der Murg gelegenen Güter,
dazu einige namentlich genannte Orte nördlich dieser Linie. Im Kraichgau waren
dies Gochsheim, Bahnbrücken und (Ober-)öwisheim, ferner Ersingen und Bil-
fingen im Pfinz-Enzgebiet. Eberhards Erbteil umfaßte hauptsächlich die nörd-
lich der Murg gelegenen Orte, darunter auch Bretten. Gemeinschaftlicher Be-
sitz blieb die Stammburg Alteberstein mit den dazugehörigen Ortschaften, ferner
die Vogtei über die Hausklöster Herrenalb und Frauenalb. Aus späteren Quellen
wird ersichtlich, daß Eberhard auch das südlich der Murg gelegene Kuppen-
heim gehörte.
Von 1219 an war demnach Eberhard von Eberstein Herr von Bretten. Außer
in Bretten war Eberhard noch in zahlreichen Orten des Kraichgaues begütert,
mehrere Orte gehörten ihm ganz, er hatte das Patronatsrecht über eine Reihe
von Pfarrkirchen, und eine ganze Anzahl von adligen Dienstleuten war von ihm
abhängig. Außer Bretten und seinem Zubehör sind im Kraichgau urkundlich als
Besitzung Eberhards bezeugt der Kammerhof in Bruchsal, die Fähre an den
wichtigen Rheinübergängen zu Rheinsheim und Altlußheim, Güter in Münzes-
heim. Doch ist dies nur ein Bruchteil seines Besitzes, da der übrige in dieser
Zeit nicht in Urkunden in Erscheinung tritt4.
Eberhard hat sich mit seinem Miterben Otto wie auch mit seinen dem geist-
lichen Stand angehörenden Brüdern Konrad und Berthold offensichtlich gut
verstanden, Oft nahmen sie gemeinsam Rechtsgeschäfte vor oder leisteten sich
gegenseitig Zeugendienste. In Bretten war Eberhard zugegen, als am 23. April
(St. Georgstag) des Jahres 1257 für Herrenalb eine Urkunde ausgestellt wurde.
Neben mehreren Adligen wird dabei auch erstmals ein Schultheiß von Bretten
als Zeuge genannt, zusammen mit dem herrenalbischen Verwalter der Grangie
Weißhofen. Eberhard scheint sich aber sonst nicht oft in Bretten aufgehalten
zu haben. Als Ausstellungsorte von Urkunden erscheinen im ebersteinischen
Bereich noch die Burgen Alteberstein (1258, 3x), öwisheim ( — Neuenbürg, 1260),
Udenheim (1254), Kuppenheim (1256), Freiolsheim (1219), Kloster Herrenalb
(1254).
Im übrigen hielt sich Eberhard oft — meist zusammen mit seinem Bruder
Otto - am Hoflager der staufischen Könige auf, ab 1215 im Gefolge des
jungen Königs und späteren Kaisers Friedrich II., danach bei dessen Sohn Kö-
nig Heinrich (VII.). An der Empörung König Heinrichs gegen seinen kaiser-
3 Krieg v. Hochfelden, Geschichte der Grafen von Eberstein in Schwaben (1836) S. 23;
K. v. Neuenstein, Die Grafen von Eberstein in Schwaben (1897) S. 46.
4 Belege bei K. v. Neuenstein, S. 77 ff. — Bemerkenswert ist eine Urkunde von 1257
(WUB V S. 196) über eine Schenkung des Albert v. Erligheim an das Kloster Maulbronn,
bei welcher dieser Eberhard v. Eberstein als seinen Herrn bezeichnet. Als Zeugen sind
dabei außer Eberhard v. Eberstein die Vögte von Bretten und Udenheim, der ehemalige
Vogt von Udenheim und der Schultheiß von Hausen — entweder von Ober- oder Rhein-
hausen bei Udenheim. Die Nennung der Vögte von Udenheim zeigt, daß die Ebersteiner
schon damals in Udenheim einen ähnlichen Verwaltungsmittelpunkt hatten wie in Bretten.
Die Urkunde ist ausgestellt in Hausen, dessen (ebersteinischer) Schultheiß ebenfalls an-
wesend war. Sowohl Rheinhausen wie Oberhausen gehörten zur ebersteinischen Burgherr-
schaft Udenheim (Vgl. A. Krieger, Topographisches Wörterbuch II Sp. 376, 595).
69
den der Ebersteiner vereinigt3.
Die Teilungsurkunde gibt nur den Teil Ottos von Eberstein genauer an. Er
erhielt für sich allein in der Hauptsache die südlich der Murg gelegenen Güter,
dazu einige namentlich genannte Orte nördlich dieser Linie. Im Kraichgau waren
dies Gochsheim, Bahnbrücken und (Ober-)öwisheim, ferner Ersingen und Bil-
fingen im Pfinz-Enzgebiet. Eberhards Erbteil umfaßte hauptsächlich die nörd-
lich der Murg gelegenen Orte, darunter auch Bretten. Gemeinschaftlicher Be-
sitz blieb die Stammburg Alteberstein mit den dazugehörigen Ortschaften, ferner
die Vogtei über die Hausklöster Herrenalb und Frauenalb. Aus späteren Quellen
wird ersichtlich, daß Eberhard auch das südlich der Murg gelegene Kuppen-
heim gehörte.
Von 1219 an war demnach Eberhard von Eberstein Herr von Bretten. Außer
in Bretten war Eberhard noch in zahlreichen Orten des Kraichgaues begütert,
mehrere Orte gehörten ihm ganz, er hatte das Patronatsrecht über eine Reihe
von Pfarrkirchen, und eine ganze Anzahl von adligen Dienstleuten war von ihm
abhängig. Außer Bretten und seinem Zubehör sind im Kraichgau urkundlich als
Besitzung Eberhards bezeugt der Kammerhof in Bruchsal, die Fähre an den
wichtigen Rheinübergängen zu Rheinsheim und Altlußheim, Güter in Münzes-
heim. Doch ist dies nur ein Bruchteil seines Besitzes, da der übrige in dieser
Zeit nicht in Urkunden in Erscheinung tritt4.
Eberhard hat sich mit seinem Miterben Otto wie auch mit seinen dem geist-
lichen Stand angehörenden Brüdern Konrad und Berthold offensichtlich gut
verstanden, Oft nahmen sie gemeinsam Rechtsgeschäfte vor oder leisteten sich
gegenseitig Zeugendienste. In Bretten war Eberhard zugegen, als am 23. April
(St. Georgstag) des Jahres 1257 für Herrenalb eine Urkunde ausgestellt wurde.
Neben mehreren Adligen wird dabei auch erstmals ein Schultheiß von Bretten
als Zeuge genannt, zusammen mit dem herrenalbischen Verwalter der Grangie
Weißhofen. Eberhard scheint sich aber sonst nicht oft in Bretten aufgehalten
zu haben. Als Ausstellungsorte von Urkunden erscheinen im ebersteinischen
Bereich noch die Burgen Alteberstein (1258, 3x), öwisheim ( — Neuenbürg, 1260),
Udenheim (1254), Kuppenheim (1256), Freiolsheim (1219), Kloster Herrenalb
(1254).
Im übrigen hielt sich Eberhard oft — meist zusammen mit seinem Bruder
Otto - am Hoflager der staufischen Könige auf, ab 1215 im Gefolge des
jungen Königs und späteren Kaisers Friedrich II., danach bei dessen Sohn Kö-
nig Heinrich (VII.). An der Empörung König Heinrichs gegen seinen kaiser-
3 Krieg v. Hochfelden, Geschichte der Grafen von Eberstein in Schwaben (1836) S. 23;
K. v. Neuenstein, Die Grafen von Eberstein in Schwaben (1897) S. 46.
4 Belege bei K. v. Neuenstein, S. 77 ff. — Bemerkenswert ist eine Urkunde von 1257
(WUB V S. 196) über eine Schenkung des Albert v. Erligheim an das Kloster Maulbronn,
bei welcher dieser Eberhard v. Eberstein als seinen Herrn bezeichnet. Als Zeugen sind
dabei außer Eberhard v. Eberstein die Vögte von Bretten und Udenheim, der ehemalige
Vogt von Udenheim und der Schultheiß von Hausen — entweder von Ober- oder Rhein-
hausen bei Udenheim. Die Nennung der Vögte von Udenheim zeigt, daß die Ebersteiner
schon damals in Udenheim einen ähnlichen Verwaltungsmittelpunkt hatten wie in Bretten.
Die Urkunde ist ausgestellt in Hausen, dessen (ebersteinischer) Schultheiß ebenfalls an-
wesend war. Sowohl Rheinhausen wie Oberhausen gehörten zur ebersteinischen Burgherr-
schaft Udenheim (Vgl. A. Krieger, Topographisches Wörterbuch II Sp. 376, 595).
69