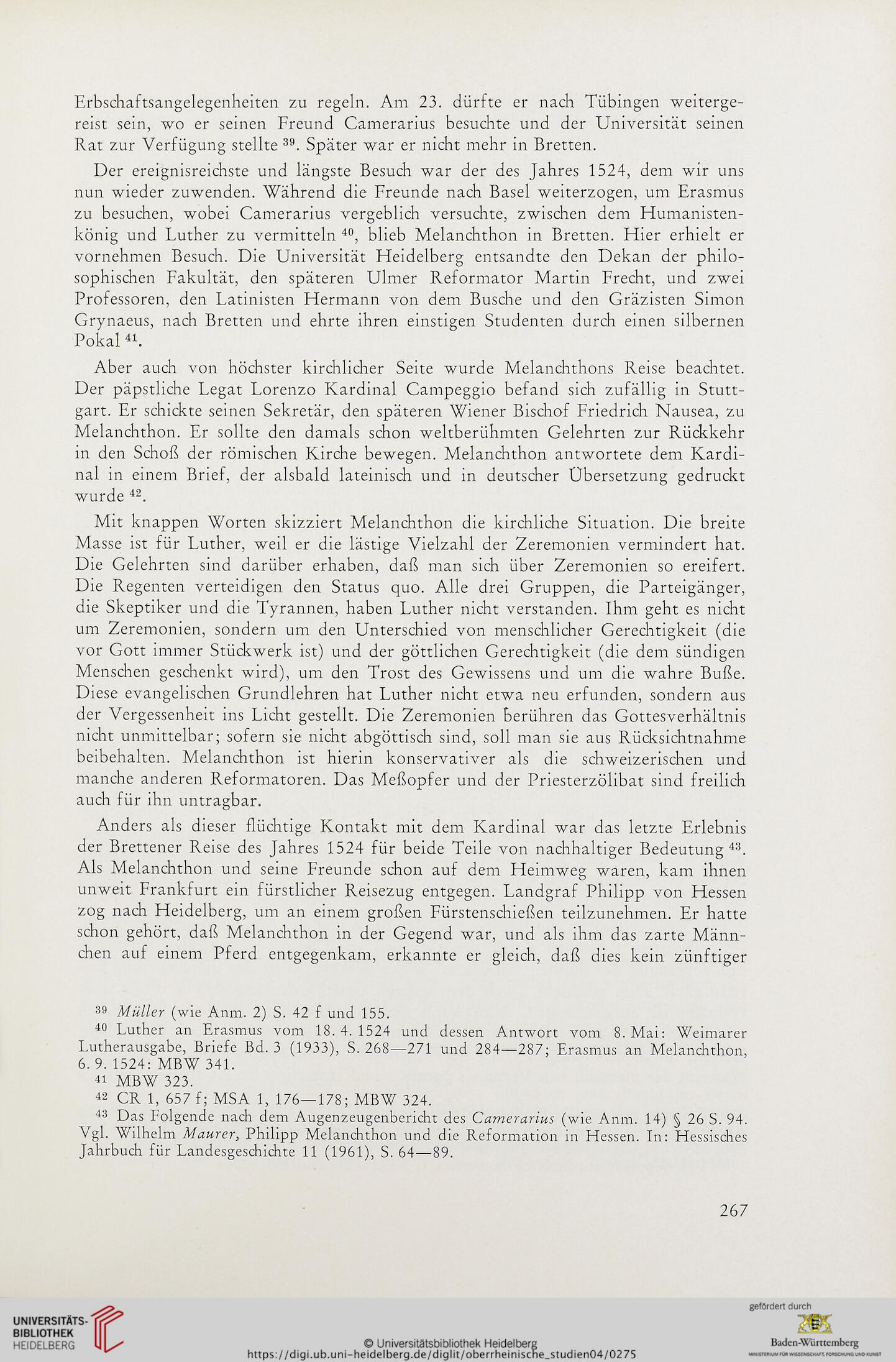Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Arn 23. dürfte er nach Tübingen weiterge-
reist sein, wo er seinen Freund Camerarius besuchte und der Universität seinen
Rat zur Verfügung stellte 39. Später war er nicht mehr in Bretten.
Der ereignisreichste und längste Besuch war der des Jahres 1524, dem wir uns
nun wieder zuwenden. Während die Freunde nach Basel weiterzogen, um Erasmus
zu besuchen, wobei Camerarius vergeblich versuchte, zwischen dem Humanisten-
könig und Luther zu vermitteln 40, blieb Melanchthon in Bretten. Hier erhielt er
vornehmen Besuch. Die Universität Heidelberg entsandte den Dekan der philo-
sophischen Fakultät, den späteren Ulmer Reformator Martin Frecht, und zwei
Professoren, den Latinisten Hermann von dem Busche und den Gräzisten Simon
Grynaeus, nach Bretten und ehrte ihren einstigen Studenten durch einen silbernen
Pokal 41.
Aber auch von höchster kirchlicher Seite wurde Melanchthons Reise beachtet.
Der päpstliche Legat Lorenzo Kardinal Campeggio befand sich zufällig in Stutt-
gart. Er schickte seinen Sekretär, den späteren Wiener Bischof Friedrich Nausea, zu
Melanchthon. Er sollte den damals schon weltberühmten Gelehrten zur Rückkehr
in den Schoß der römischen Kirche bewegen. Melanchthon antwortete dem Kardi-
nal in einem Brief, der alsbald lateinisch und in deutscher Übersetzung gedruckt
wurde 42.
Mit knappen Worten skizziert Melanchthon die kirchliche Situation. Die breite
Masse ist für Luther, weil er die lästige Vielzahl der Zeremonien vermindert hat.
Die Gelehrten sind darüber erhaben, daß man sich über Zeremonien so ereifert.
Die Regenten verteidigen den Status quo. Alle drei Gruppen, die Parteigänger,
die Skeptiker und die Tyrannen, haben Luther nicht verstanden. Ihm geht es nicht
um Zeremonien, sondern um den Unterschied von menschlicher Gerechtigkeit (die
vor Gott immer Stückwerk ist) und der göttlichen Gerechtigkeit (die dem sündigen
Menschen geschenkt wird), um den Trost des Gewissens und um die wahre Buße.
Diese evangelischen Grundlehren hat Luther nicht etwa neu erfunden, sondern aus
der Vergessenheit ins Licht gestellt. Die Zeremonien berühren das Gottesverhältnis
nicht unmittelbar; sofern sie nicht abgöttisch sind, soll man sie aus Rücksichtnahme
beibehalten. Melanchthon ist hierin konservativer als die schweizerischen und
manche anderen Reformatoren. Das Meßopfer und der Priesterzölibat sind freilich
auch für ihn untragbar.
Anders als dieser flüchtige Kontakt mit dem Kardinal war das letzte Erlebnis
der Brettener Reise des Jahres 1524 für beide Teile von nachhaltiger Bedeutung43.
Als Melanchthon und seine Freunde schon auf dem Heimweg waren, kam ihnen
unweit Frankfurt em fürstlicher Reisezug entgegen. Landgraf Philipp von Hessen
zog nach Heidelberg, um an einem großen Fürstenschießen teilzunehmen. Er hatte
schon gehört, daß Melanchthon in der Gegend war, und als ihm das zarte Männ-
chen auf einem Pferd entgegenkam, erkannte er gleich, daß dies kein zünftiger
39 Müller (wie Anm. 2) S. 42 f und 155.
40 Luther an Erasmus vom 18.4.1524 und dessen Antwort vom 8. Mai: Weimarer
Lutherausgabe, Briefe Bd. 3 (1933), S. 268—271 und 284—287; Erasmus an Melanchthon,
6. 9. 1524: MBW 341.
41 MBW 323.
42 CR 1, 657 f; MSA 1, 176—178; MBW 324.
43 Das Folgende nach dem Augenzeugenbericht des Camerarius (wie Anm. 14) § 26 S. 94.
Vgl. Wilhelm Maurer, Philipp Melanchthon und die Reformation in Hessen. In: Hessisches
Jahrbuch für Landesgeschichte 11 (1961), S. 64—89.
267
reist sein, wo er seinen Freund Camerarius besuchte und der Universität seinen
Rat zur Verfügung stellte 39. Später war er nicht mehr in Bretten.
Der ereignisreichste und längste Besuch war der des Jahres 1524, dem wir uns
nun wieder zuwenden. Während die Freunde nach Basel weiterzogen, um Erasmus
zu besuchen, wobei Camerarius vergeblich versuchte, zwischen dem Humanisten-
könig und Luther zu vermitteln 40, blieb Melanchthon in Bretten. Hier erhielt er
vornehmen Besuch. Die Universität Heidelberg entsandte den Dekan der philo-
sophischen Fakultät, den späteren Ulmer Reformator Martin Frecht, und zwei
Professoren, den Latinisten Hermann von dem Busche und den Gräzisten Simon
Grynaeus, nach Bretten und ehrte ihren einstigen Studenten durch einen silbernen
Pokal 41.
Aber auch von höchster kirchlicher Seite wurde Melanchthons Reise beachtet.
Der päpstliche Legat Lorenzo Kardinal Campeggio befand sich zufällig in Stutt-
gart. Er schickte seinen Sekretär, den späteren Wiener Bischof Friedrich Nausea, zu
Melanchthon. Er sollte den damals schon weltberühmten Gelehrten zur Rückkehr
in den Schoß der römischen Kirche bewegen. Melanchthon antwortete dem Kardi-
nal in einem Brief, der alsbald lateinisch und in deutscher Übersetzung gedruckt
wurde 42.
Mit knappen Worten skizziert Melanchthon die kirchliche Situation. Die breite
Masse ist für Luther, weil er die lästige Vielzahl der Zeremonien vermindert hat.
Die Gelehrten sind darüber erhaben, daß man sich über Zeremonien so ereifert.
Die Regenten verteidigen den Status quo. Alle drei Gruppen, die Parteigänger,
die Skeptiker und die Tyrannen, haben Luther nicht verstanden. Ihm geht es nicht
um Zeremonien, sondern um den Unterschied von menschlicher Gerechtigkeit (die
vor Gott immer Stückwerk ist) und der göttlichen Gerechtigkeit (die dem sündigen
Menschen geschenkt wird), um den Trost des Gewissens und um die wahre Buße.
Diese evangelischen Grundlehren hat Luther nicht etwa neu erfunden, sondern aus
der Vergessenheit ins Licht gestellt. Die Zeremonien berühren das Gottesverhältnis
nicht unmittelbar; sofern sie nicht abgöttisch sind, soll man sie aus Rücksichtnahme
beibehalten. Melanchthon ist hierin konservativer als die schweizerischen und
manche anderen Reformatoren. Das Meßopfer und der Priesterzölibat sind freilich
auch für ihn untragbar.
Anders als dieser flüchtige Kontakt mit dem Kardinal war das letzte Erlebnis
der Brettener Reise des Jahres 1524 für beide Teile von nachhaltiger Bedeutung43.
Als Melanchthon und seine Freunde schon auf dem Heimweg waren, kam ihnen
unweit Frankfurt em fürstlicher Reisezug entgegen. Landgraf Philipp von Hessen
zog nach Heidelberg, um an einem großen Fürstenschießen teilzunehmen. Er hatte
schon gehört, daß Melanchthon in der Gegend war, und als ihm das zarte Männ-
chen auf einem Pferd entgegenkam, erkannte er gleich, daß dies kein zünftiger
39 Müller (wie Anm. 2) S. 42 f und 155.
40 Luther an Erasmus vom 18.4.1524 und dessen Antwort vom 8. Mai: Weimarer
Lutherausgabe, Briefe Bd. 3 (1933), S. 268—271 und 284—287; Erasmus an Melanchthon,
6. 9. 1524: MBW 341.
41 MBW 323.
42 CR 1, 657 f; MSA 1, 176—178; MBW 324.
43 Das Folgende nach dem Augenzeugenbericht des Camerarius (wie Anm. 14) § 26 S. 94.
Vgl. Wilhelm Maurer, Philipp Melanchthon und die Reformation in Hessen. In: Hessisches
Jahrbuch für Landesgeschichte 11 (1961), S. 64—89.
267