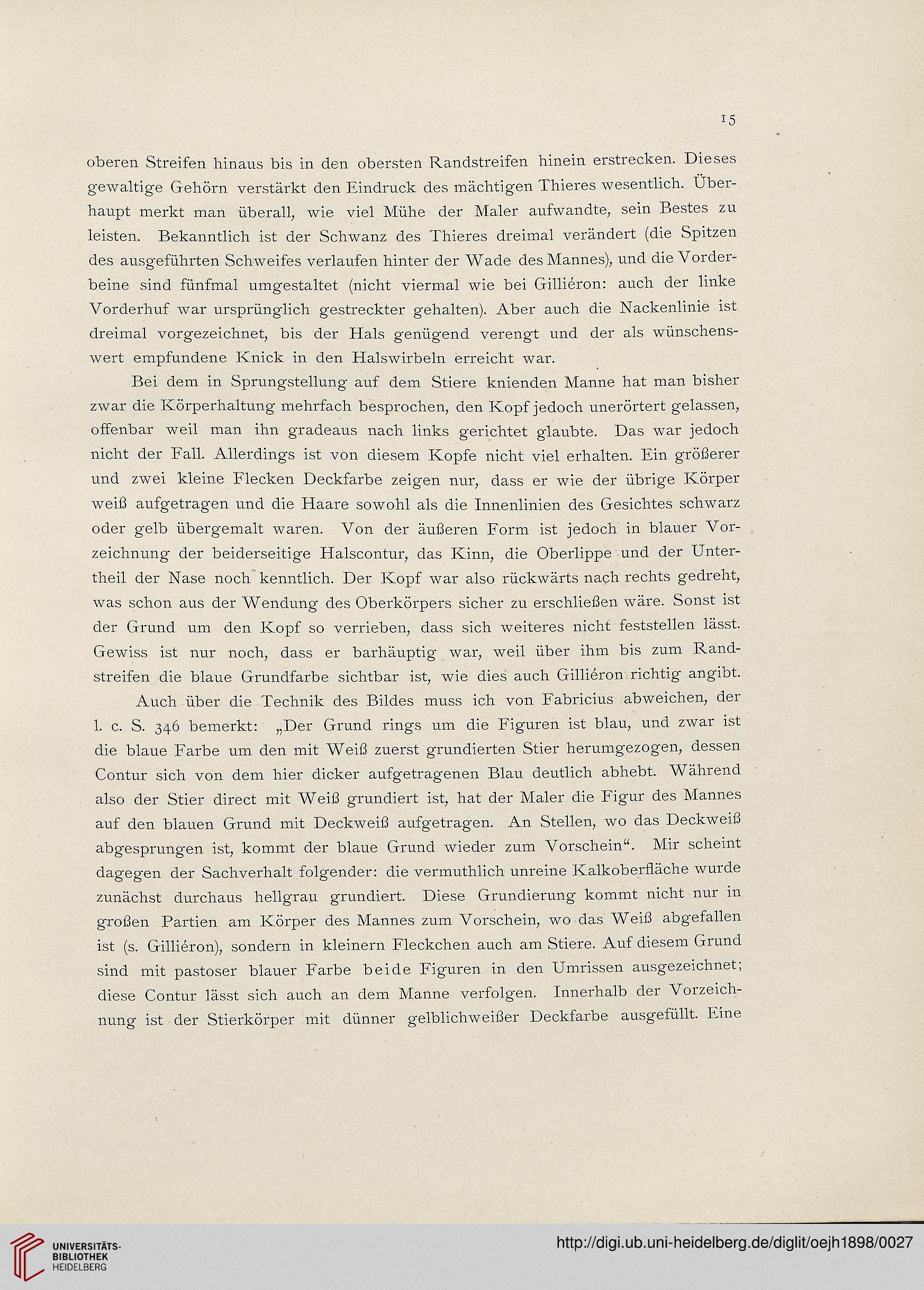Österreichisches Archäologisches Institut [Hrsg.]
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien
— 1.1898
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.19227#0027
DOI Artikel:
Reichel, Wolfgang: Zum Stierfänger von Tiryns
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.19227#0027
Übersicht des Inhalts
Bildnis einer jungen Griechin
2
typischen Erinnerungsbildern, welche die Griechen der altern Zeit auf die Ruhe-
…
Freundin ausbricht: HäovMVOc, eaa" 'Aioa, drängt sich auf die Lippen.
…
jetzt belebend wirkende Reste der einstigen Bemalung, welche direct auf-
…
handlung mitverschuldete Überbreite des Körpers, ein ungleiches Maß der
…
Zeitansätze umzuwerten, da der Geschmack der Kunstcentren voreilt, die Praxis
3
versucht ist, das ideale Schema der Gesichtsformen einem individuellen kindlichen
…
liegender Gürtel verläuft, auch nach der flachen Bildung der Augen mit ihren
…
vor der Mitte des vierten Jahrhunderts entstanden sind. Dies deutet auf die an-
…
Die annähernd ovale Standfläche der Sculptur zeigt keine Verdübelung,
…
und die Verletzungen der untern Faltenränder scheinen darauf hinzuweisen, dass
…
die wie immer beschaffene Gestalt des Grabmals in der Hauptsache vom Bekannten
…
seit alters Büsten hergestellt, welche unten über der Brust horizontal endigen,
4
der Griechen dagegen gehören reine Halbfiguren zu den Seltenheiten. Der Kunst
…
Material, auch wohl der Granatapfel, den ich als sepulcrales Beiwerk nur aus
…
beinahe einen Meter hoch, gekommen, von der
…
Halbfiguren neben ganzen Statuen als Auf-
…
3) Die Literatur bei Hübner, Bildnis einer nachweist, gab eine Abbildung Cigalla in der athe-
5
der Vertiefungen, die ihre Oberfläche zeige, bestimmt, einen ähnlichen Schmuck
…
aus hellenistischer Zeit, und der gleichen Epoche gehört
…
Älter ist eine an der spanischen Ostküste in Elche (Ilici) gefundene, in ihrem-
6
lichte. Unter der Natur, aber in der Gattung der Terracotten von auffallender
…
mitgetheilt, möglicherweise ebenfalls hiehergehörig, obwohl der Verlauf des
…
Augenblick zu bieten weiß: schade, dass P. von Biehkowski in seiner auf reichen
…
Uber die Topographie und die Alterthümer der Kerkyraeisehen Colonie
…
bemerkt ist: ,dafür, dass der unterste Theil des
…
fuhr, um die Schwierigkeiten der Herstellung zu
…
figur der Isis (?) aus Villa Borghese erwähnt wird.
7
Epidamnus, später Dyrrhachium, woraus sich der heutige Name Durazzo ent-
…
IS 11 P! H Ii U Ii zahl der von Heuzey abgebildeten Sculp-
…
der die Wiener Halbfigur angehört, dort
…
des Todten umgaben, von der der Stich
…
die ganze Breite der hohen Basis ein-
…
freilich als eine Möglichkeit der architektonischen Verwendung soll damit nicht
8
Kyrene und Thera, auf einem bloßen Postamente stand. Die noch unbekannten
…
glaubt Heuzey die Verwendung von Halbfiguren auf Gräbern zusammenhängend
…
scheidend. Stellt sich der besprochene Brauch in fortgesetzter Beobachtung wirklich
…
hervorgehobenen Gegensatze, der auf innerlich verschiedene Bedürfnisse zurück-
…
losen lieblichen Madonnen und markigen Portraits der Renaissanceplastik würden
Wanderung archaischer Zierformen
9
ist ein vogelleibförmiges Thongefäß der frühesten Eisenzeit aus Parasolia, mit
…
S- 493, vgl. 367, A. 1) „möglicherweise auf Kypros aus dem concentrischen Kreis-
…
mykenischen Spiralmusters, auf das, wie ich glaube, auch die zwischen auf- und
10
zeigt das eben erwähnte Schleifenornament in der Ziertechnik der älteren, vor-
…
schon auf Cypern in ein planloses Gemenge kreisrunder und viereckiger Figuren
…
siebensaitigen Leier (?) gehörig". Schliemann theilt es der
…
Fig. 8 (nach Hampel, Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn, Taf. XXXI 1 b)
11
reicher, oft auch regelloser Anwendung das Grundelement der specifisch-
…
vorkommen als in der Poebene. Sie stammen aus der
…
Thiergemenge auf der Fibel herzustammen.
12
eines gravierten Bronzegürtels von der Paradiesfestung bei Kalakent (nach
…
Virchow, der eine genetische Anknüpfung
…
Gürtelblechen, deren a. a. O. 18 Stücke mitgetheilt werden, weist auf mykeni-
…
Die Bronzefibel Fig. 12 (nach Montelius 1. c. Taf. 51, Fig. 4, hier auf Grund
…
der Reiter eingezapft sind. In den Pferden sieht er „cavalli marini", obwohl das
13
von dem man in der Abbildung nur den Schwanz sieht. Die Figuren auf den
…
Loch in jedem ist der freie Raum zwischen dem eingezogenen Unterleibe und
…
sein, um die erste Publication,1) von der alle folgenden abhängig blieben, in nicht
…
unter Fig. 14 von der oberen Hälfte des Bildes eine neue Zeichnung, die ich nach
…
dass bei letzterer vor allem der Kopf des Stieres Einbuße litt. Das schematisch
…
von dem man in der Abbildung nur den Schwanz sieht. Die Figuren auf den
…
Loch in jedem ist der freie Raum zwischen dem eingezogenen Unterleibe und
…
sein, um die erste Publication,1) von der alle folgenden abhängig blieben, in nicht
…
unter Fig. 14 von der oberen Hälfte des Bildes eine neue Zeichnung, die ich nach
…
dass bei letzterer vor allem der Kopf des Stieres Einbuße litt. Das schematisch
Zum Stierfänger von Tiryns
14
abgerundete Stutzköpfchen lässt von der lebensvollen Durchbildung, die der Maler
…
tragen, sich noch andeutet, und wird überwölbt vom Brauenbogen, der wie die
15
haupt merkt man überall, wie viel Mühe der Maler aufwandte, sein Bestes zu
…
Auch über die Technik des Bildes muss ich von Fabricius abweichen, der
…
also der Stier direct mit Weiß grundiert ist, hat der Maler die Figur des Mannes
…
ist (s. Gillieron), sondern in kleinern Fleckchen auch am Stiere. Auf diesem Grund
16
des Stierschweifes und der Vorderbeine, und darauf wurde der ganze Bildgrund
…
wo Theile des Gemäldes einander überschneiden. Direct auf die blaue Schichte
…
kleinen ausgesprungenen Stelle der schön erhaltene blaue Grund zutage.
…
die gelbe Bemalung des Bildrahmens in einem längeren Streifen deutlich auf die
…
Der Vergleich mit dem weit kleineren Tafelbildchen aus Mykenai (Darstellung
17
aber schon der unebenen Rückseite wegen — die nur an einem circa 0-3'"
…
anscheinend pentelischem Marmor, welche im October 1879 auf dem Kreuzungs-
…
sprach sich in einem kurzen Berichte über den Fund auf gleiche Weise aus.
…
die Förderungen, welche die k. Akademie der Wissenschaften zu Krakau meinen
…
waren, kennen lernte, konnte ich mich der Anerkenntnis nicht entziehen, dass
…
aber schon der unebenen Rückseite wegen — die nur an einem circa 0-3'"
…
anscheinend pentelischem Marmor, welche im October 1879 auf dem Kreuzungs-
…
sprach sich in einem kurzen Berichte über den Fund auf gleiche Weise aus.
…
die Förderungen, welche die k. Akademie der Wissenschaften zu Krakau meinen
…
waren, kennen lernte, konnte ich mich der Anerkenntnis nicht entziehen, dass
Tarentiner Relieffragmente
18
holt sich voller auf einem bekannten Venezianischen Relief und erhielt sich in
…
stellt. Ich zähle zunächst diese Wiederholungen auf:
…
Kopf und Hand eines lanzenschleudernden Kriegers, der auf
…
1895 zu Venedig: Mittheilungen der Centralcommission 1897 S. 80, Fig. 1. Hoch
…
die Stelle der in älteren Darstellungen vorkommen- Relief einen weiteren Bestandtheil zu erkennen
19
herabführt. Von der Brücke ist linkshin ein beschildeter Grieche kopfüber in
…
sich die Kämpfergruppe auf dem Landungsbrett, dessen obere Fläche wie auf I
…
^pm^. linken Eckpilasters auf beiden Seiten ver-
20
ein Maiandersystem. Vor dem Pilaster der Oberkörper einer Karyatide mit
…
der anpassenden
…
bis auf eine feine
…
der sich mit dem Zipfel einer
…
nämlichen Ornament wie auf A
…
D hoch o-42m, breit 0-42'" gröi3te Relief höhe 0-09m, größte Dicke der
…
wände mit Flachreliefs verziert: auf dem jenseitigen ein Delphin und eine nackte
21
einander entgegengewandt zwei Tritone, die auf einer Muscheltrompete blasen,
…
Fig. 21 Relieffragment D zu Tarent. Helmte Köpfe, der jugend-
…
figur, kopfüber gestürzt auf den Rundschild, der
…
auf der linken Seite, den rechten Unterarm nach
…
neion) der zweiten Figur. Die dritte schritt im gegürteten Chiton nach rechts.
23
der ersten Figur von F wiederholend, und die gleiche Richtung hält im Hinter-
…
sprechenden Karyatide in Ärmelchiton und einem Obergewande, das sie mit der
…
verschwindet nach rechts der
…
arm, dessen Hand sich an der
…
lichen Gewandfigur, die sich mit dem linken Ellenbogen auf einen Polster aufstützt;
24
Eine Prüfung dieser Fragmente lehrt zunächst, dass sie nicht alle auf einer
…
Stück B einer Nebenseite, die Karyatide H der geringeren Reliefhöhe und der
…
HH der nämlichen Langseite
…
und III muss der Kopfüber-
…
IHjJjbezeugte Kämpfergruppe auf dem unteren Ende der Schiffsbrücke ange-
…
gearbeitet sind und gleiche Reliefhöhe haben, bin ich geneigt, sie auf der
25
muthlichen Kampfe um einen Todten oder Gefallenen annähernd die Mitte der
…
gezogen. Doch stieß sie bald auf einen überlegenen Feind und verwickelte sich
…
einstürmenden Barbaren, Leichen, Sterbende und Verwundete, so ein von der
…
Landungsschlacht erinnert keiner der in Dichtung und Kunst charakteristischen
…
Telephosfrieses, die sich nach Robert auf diesen Gegenstand beziehen (Jahrbuch III
…
mvovtag. Sehr wohl könnte die Figur auf H, welcher der sonderbar zurück-
26
Reliefs täuschten, ist angesichts der blendenden Ausführung des Figürlichen
…
Stil der sogenannten zweiten attischen Schule erinnert; ihre nächsten Verwandten
…
nische Relief findet in seiner Technik, namentlich im Typus der Köpfe, die
27
aufzunehmen und auch die in der Erde zurückgelassenen unbedeutenderen Frag-
…
schrift neu zu verwerten,1) griff in der nachchristlichen Zeit immer weiter um sich
…
Kopf des Tiberius aufgesetzt zu haben,2) scheint nur hinsichtlich der Kürze des Inter-
…
achtfach verkleinert veröffentliche. Den Abdruck von n. 4 danke ich der Güte
…
aufzunehmen und auch die in der Erde zurückgelassenen unbedeutenderen Frag-
…
schrift neu zu verwerten,1) griff in der nachchristlichen Zeit immer weiter um sich
…
Kopf des Tiberius aufgesetzt zu haben,2) scheint nur hinsichtlich der Kürze des Inter-
…
achtfach verkleinert veröffentliche. Den Abdruck von n. 4 danke ich der Güte
Metagraphe attischer Kaiserinschriften
28
von v.ou. im Anfange, auch weist die Art und namentlich die größere Höhe der
…
Doch noch ein drittesmal wurde der Stein benutzt, und zwar für Hadrian.
29
üwxrjpt kann nur auf der Statuenplinthe angebracht gewesen sein, da die
…
dass noch Reste der Schriftzeichen zu sehen sind, welche sie ursprünglich ein-
…
wegen die ergänzte Inschrift auf Titus zu beziehen, ist deshalb nicht wahr-
…
Zeile auf dem Steine, von der nur noch Reste über Oberfläche getrennt, eine zweite Rasur, in der
30
Der Stein ist also mindestens viermal für Kaiserinschriften verwendet
…
dass noch in zwei anderen Fällen offenbare Unregelmäßigkeiten der Fassung
…
wozu der Herausgeber sich folgendermaßen äußert:
…
sionem aliquam habet'. Der Anstoß wäre behoben, sobald man liest:
…
öffentlichen Geschmacks in Athen während der ersten Kaiserzeit.
Mittheilungen aus Constantinopel
31
palais in Bujukdere, wohin es nach der wohlbegründeten Ansicht seines Ent-
…
Güte, mich von seinem Funde zu verständigen und bei der Lesung der stark
…
TXauxou ergänzt von A. Wilhelm; Z. 6 äi nach Vorschlag A. Wilhelms, der als
…
Unter dem Obercommandanten A. Terentius A. f. Varro, dem der Nauarch
…
Verwaltungsbeamten, gestützt auf [Dem.] npbc, üoXuxXea 25 M yap ixetvou rcevnj-
32
Schiffscommissär; und, was besonders interessant ist und vielleicht mit der
…
Der Schlan-
…
Kos dar; auf
…
der Periode
…
wertes Zusammentreffen mit unserem Zeitansatz der Inschrift, und kehrt auch nach
…
außer der koischen Tetrere noch viele andere Schiffe standen, für deren jedes
33
jeder der an der Flotille betheiligten Städte alle diese Verzeichnisse nebeneinander
…
cAX]i[oo]wp_[ou. xußepvccxajs Ka[pxi[iev7j]g Apiaxjw- der Zweck, zu dem das
…
10 'Api]oxox[paxrjs Sig, 7i;£v]x7)x[6vxap]x[o]s 'Ayrjaa| v- wurde. Der Obercom-
…
meiste Anrecht hierauf hat wohl der A. Terentius A. f. Varro der bilinguen Inschrift
34
noch in Betracht kommen der Zeuge im Process des Caecina (6g) A. Terehtius
…
belanglos ist, ob der xeXsuax3c[e 'Api]cn;ox[pcex7]s Sit;] mit dem ApiaxoxpaxTj? ß' Paton
…
Sprachlich ist das w in xsxprjpewj merkwürdig. Eine Abweichung von der
…
aber in der rechten Hälfte ganz verrieben, weil der Stein lange Zeit als Schwelle
35
stammt, kaum auffällig. Schwierig aber ist es, den Ursprungsort der Inschrift
…
auf thrakischem Boden gewesen zu sein und kann ganz wohl zur tribus Arnensis
36
gestellt; da aber Tavium wahrscheinlich nach dem Datum der Besitzergreifung
…
den man bei der Copie vorauszusetzen geneigt ist. Da in BI CO CANI sicher ein T,
…
deren einziges halbwegs gelungenes Beispiel der Hexameter o-i^af/ ccvSp: xXuxqi
…
der Stelle das Richtige trifft, erklären.
37
Das Verwandtschaftsverhältnis dürfte wohl so sein, dass der Gatte der
…
Kalksteihpfeiler, der inmitten der Trümmer der lykischen Bergstadt Isinda,1) etwa
…
sie ist 0-041" tief und 0-53'" X 0-37'" groß. Die Inschrift ist an der westlichen
…
•Spuren der lykischen Zeichen zu erkennen vermochte. Als der zu mehr als zwei
…
volle Tage und verzeichnete, was ich an Schrift zu erkennen glaubte, in der
…
Das Verwandtschaftsverhältnis dürfte wohl so sein, dass der Gatte der
…
Kalksteihpfeiler, der inmitten der Trümmer der lykischen Bergstadt Isinda,1) etwa
…
sie ist 0-041" tief und 0-53'" X 0-37'" groß. Die Inschrift ist an der westlichen
…
•Spuren der lykischen Zeichen zu erkennen vermochte. Als der zu mehr als zwei
…
volle Tage und verzeichnete, was ich an Schrift zu erkennen glaubte, in der
Eine zweisprachige Inschrift aus Lykien
38
ben hinterließen auf
…
lesene auf dem Ab- \ M AI A E N E : t A TA P E
…
der Originalabschrift ante-'* icA**'
39
W^I"! ° ^^Ti^WTWIntii ; kannten Gottes, bei der
…
steckt vielleicht der Rest
…
anträge seitens der Bürger-
…
über die Thätigkeit der
40
Gewicht wird darauf gelegt, dass der Ersatz noch in demselben Jahre statthabe, ev'-xcöi
…
zu fördern, sicherlich aber wird man auf Herstellung eines zusammenhängenden
…
Haben wir aber in der That eine Bilinguis vor uns? Die äußere Gestalt
…
Der lykische Text füllt 2^.1/2 Zeilen zu etwa 32 Buchstaben, der griechische
…
seits findet sich im Lykischen viermal (Z. 13, 15, 17, 20) der Eigenname Qeziqa,
…
in zwei Sprachen abgefassten Documente, sondern mit zwei gesonderten, auf den-
41
cius der Stele von Xanthos bekannt, deren Errichtef sich Sohn eines Harpagos
…
gehört.3) Wohl aber ist zu bedenken, dass von dem Namen der von Harpagos'
…
und die einzelnen Glieder der Familie als Dynasten, sei es neben, sei es unter
…
gewagt, anzunehmen, dass Qeziqa und der Demos von Isinda'sich zur Feier einer
…
griechischen Theile vorauszusetzen, wo er, abgesehen von der einleitenden Formel,
42
Ich verkenne nicht, auf wie schwankem Grunde alle diese Combinationen
…
wäre, eine Epoche, in der wir auch aus epigraphischen Gründen unser Monument
…
vollbesetzten athenischen Stadion zu beobachten, als der Grieche Luis im mara-
…
In der Natur der Sache ist es begründet und geht auch aus Thuk. V 50
…
gewöhnlich wohl gleich nach der Verkündigung, bricht nun der Enthusiasmus
…
') Suidas, dessen Nachricht in letzter Linie auf
…
des glücklichen Kämpfers ist angedeutet auf einem Vasen-
…
Ich verkenne nicht, auf wie schwankem Grunde alle diese Combinationen
…
wäre, eine Epoche, in der wir auch aus epigraphischen Gründen unser Monument
…
vollbesetzten athenischen Stadion zu beobachten, als der Grieche Luis im mara-
…
In der Natur der Sache ist es begründet und geht auch aus Thuk. V 50
…
gewöhnlich wohl gleich nach der Verkündigung, bricht nun der Enthusiasmus
…
') Suidas, dessen Nachricht in letzter Linie auf
…
des glücklichen Kämpfers ist angedeutet auf einem Vasen-
Siegerkranz und Siegerbinde
43
durch das Stadion, einen wahren Triumphzug, auf dem er von der versammelten
…
Dies war die Phyllobolie. Später kam sogar die Sitte auf, den Athleten zu
…
\ Kranz um seinen Körper, auf den vor-
…
\ fk/ \ / 3. Innenbild der Berliner Schale 4221
44
Binde umwunden, einen Stock unter der linken
…
das Haupt zu legen. Der letztere hat den
…
IV 274 der Vorgang geschildert, wie der als
…
die Rennbahn dahineilt. Auf der Münchener
45
Umstand führt uns auf die von Bötticher aufgeworfene Frage, welche Bedeutung
…
that, als er seinen Wagenlenker nach der Siegesverkündung mit einer Tänie
…
Spielen ausgeschlossen waren, unter dem Namen der Thebaner ein Zweigespann
…
die Ehre und der Kranz eines Wagensieges bekanntlich dem Besitzer des
…
Können somit diese Erzählung'en für die Anwendung der Tänie als ofhcielles
46
tegrierenden Bestandtheil der officiellen Siegesgabe bildete.
…
Fällen zweifelhaft sein. Die auf
…
der der Jüngling auf Fig. 28 wäh-
…
Stephani a. a. O. 162 unrichtig erklärt), wo der bekränzte und mit Bändern ge-
…
all dies stimmt nicht gut zum Ernst der Festspiele, sondern deutet eben
47
auf Probekämpfe in der Ringschule oder im Gymnasion hin, bei denen etwa
…
Männer. Der Sieger ist offenbar nach dem Ausrufen im Stadion von den Zuschauern
…
qxocvxes olq ÄvaSoöai Aaxe8ai(Ji6vioi zobq vtXTjcpopoug. Ausdrücklich auf die Isthmien bezieht
48
Boeckh III 225), da sich der A^ergleich nur auf die flatternden Enden einer Binde
…
auch die Zeichnung der Londoner Preisamphora spricht. Den Kranz sammt der
…
Erwägungen dürften der Grund sein, weshalb an Siegerbildern in älterer Zeit
…
wohl ein Rest der ursprünglich neben dem Kranze verliehenen Siegerbinde.
Der Georgos des Menandros
49
Der Georgos des Menandros.
…
maßen zu erschließen vermögen. Zudem war der Georgos ein hervorragendes
…
Freilich ist auch hier der Kritik und Erklärung noch ein weites Feld ge-
…
Das Blatt enthält auf der Vorderseite zuerst den letzten Theil eines Mono-
…
Abend5)) stattfinden. Kleinias ist der Sohn des Gorgias aus dessen erster Ehe;
…
seite die Verse 62—108. Der Schluss des Blattes, Nähere Angaben darüber, von wem die Ergän-
50
gift ins Haus gebracht, und der haushälterische Gorgias will das Geld zusammen-
…
oder die Schwester, der er herzlich zugethan ist, durch sein Zurücktreten be-
…
rührenden Klagen der Myrrhine mit deren Worten angeführt haben.
…
Blatt das sechste des Codex gewesen sein. Es treten nun zwei Frauen auf,
51
Entscheidung kommt es nicht, da der Sclave des Gorgias, Daos, auftritt und
…
des Hauses schickt. Von dem Gute aus soll mit Einbruch der Nacht, die Braut
…
Aus der Antwort des Daos <5 y_<xipe izoXkx, Muppi'vrj ersehen wir, dass er sie gut
…
Durch die Zerstörung des Schlusses des Blattes ist für uns der Zusammenhang
…
über die Ankunft ihres Mannes und die Heimführung der Braut zu erkunden.
52
„Gute Botschaft" behandelt hat. Auf die Frage, wie es draußen stehe, antwortet
…
Hacken im Weinberg den Fuß verletzt habe. Nachdem er der Frau mit seiner
…
Geschichte der Frau seines Herrn nur erzählt, um ihr es zu erklären, wenn Gorgias
…
meint nur, es wäre an der Zeit, dass der alte Herr die Plackereien ließe. Mit
…
besteht darin, an Stelle der bestimmten Braut die Tochter der Myrrhine auf einem
…
Der Vater werde hindernd in den Weg treten; immer sei sie vom Unglück ver-
…
Myrrhine erwidert: x£ yap, [<D£]Xtvv'; omopoü\LGa vöv xt TOifja[at] \ie Set. Mit der
…
alter Diener des Hauses, der sich etwas heraus- n) v. 100 f. ^pl[v Inexat] 10 Sua-ux^v | [äTE]ve?.
53
Antwort der Philinna: [Xe£a]t xt'vog 7] tvxZc, kau1 xoöxo xoOSevc [ÄXX(p TipoaYjm]12) schließt
…
lassen, an ihn Ansprüche zu stellen. Der Sohn des Gorgias, wenn auch ein un-
…
richtet ist, kann nicht zweifelhaft sein. Der Plan, den er entworfen hat, sein
…
Stelle der bestimmten Braut tritt, nicht geändert, da Kleinias ja, wie es aus-
54
schlichter Landmann, mit den Dingen in der Stadt ganz und gar nicht bekannt, aber
…
nennen. Auf seine Frage, warum sie nicht versucht habe, ihr Recht geltend zu
…
Gorgias der Vater ihrer Tochter ist. So vollzieht sich schrittweise die Lösung.
…
heiratung der Tochter des Gorgias aus zweiter Ehe entsprechend gesorgt war
Athene Hephaistia
55
Fig. 32 Kopf der Statue aus Kreta im Louvre (Fig. 35).
…
dass die Inschriften CIA I 318 und 319 auf die von Alkamenes gearbeitete Tempel-
…
nachgehen zu können, so mag es an der Zeit sein, die vor Jahren angekündigte
56
Statuen übertragen worden war. Auf der Vorderseite des Steines waren die
…
erhalten, während für das Jahr Ol. 90, 2 keine Einnahme erwähnt wird. Da der
…
worden sind. Von dem Verzeichnis der Ausgaben sind nur noch wenige, arg
…
eine Parallele zu dem Rechenschaftsbericht der für das Goldelfenbeinbild der
57
auf eine so bedeutende Gewichtsmenge, dass die Annahme, das Erz sei bloß für
…
wurde, genügt, um Marmor als Material der Statuen auszuschließen. Für Bronce-
…
anzulegen, auf denen stehend die Arbeiter die Fertigstellung der Figur vornehmen
…
erscheinen. Der Preis einer lebensgroßen Broncestatue von Durchschnittsgüte
…
setzen müssen. Zwei- bis zweieinhalbfache Lebensgröße ist aber ein Maßstab, der
58
für Tempelstatuen aus der Zeit des peloponnesischen Krieges als durchaus üblich
…
Neben einer der Statuen befand sich demnach ein Schild, dem ein av9-ejj,ov, eine
…
STXOiTjaev 'AXxa|jL£V7}s, xrjv §£ 'Axl'rjVccv avYjp üapioc;, övojia 5e auxw Aöxpoq (ein Name, der,
…
Ares-Statue des Alkamenes mit keiner der beiden Aphroditefiguren zu einer
59
XXXII) die beiden besprochenen Inschriften auf Hephaistos bezogen. Dann darf
…
vielfach bezeugt, sondern auch eine Tempelgruppe der beiden Gottheiten ausdrücklich
…
Wie nun einerseits selbstverständlich ist, dass man die Tempelbilder der
…
müssen an der Athene-Statue in ungewöhnlicher Weise (etwa mit Zuhilfenahme
…
setzung, dass die dydXjxaxe der Inschriften CIA I 318 und 319 wirklich die Tempel-
…
Hephaistosfestes.1) A. Wilhelm hat kürzlich (Anzeiger der Wiener Akad. 1897
60
uns ein Theil der Uberschrift des Volksbeschlusses erhalten, mit der Datierung
…
der Athene gemeinsam galt. Kein Zweifel also, dass es sich an den gemeinsamen
…
nur dem Sinne nach die einzig zulässige ist, sondern auch der Buchstabenzahl
…
In der Inschrift CIA I 318 liegt uns nun der Rechenschaftsbericht einer
…
von staatswegen in Auftrag gegeben worden wären. Vielleicht könnte es auf den
61
paar handeln. Aber in dem Volksbeschlusse ist ausdrücklich der Bule über-
…
dass in dem gemeinsamen Heiligthum von Hephaistos und Athene der Gott nicht
…
Neben diesem, wie ich glaube, zwingenden Zusammentreffen der in den
…
S. Dimitrio Katephori, also etwa an dem Kreuzungspunkt der Prytaneion- und
…
bei der Kapnikaräa die Inschrift CIA IV 35 b, bei S. Dimitrio das zu dieser In-
62
dass im Theseion vielleicht noch das Fundament der Basis sich nachweisen
…
weiteren auch noch der Name ihres Verfertigers feststellen. Denn es kann kein
…
im Staatsauftrag vergeben wurden, auf dem Gipfel seines Ansehens, und man
…
Hephaistos in Athen spricht, der denkt eben an das Cultbild des Hephaistos-
…
Zug hat uns die Inschrift CIA I 319 übermittelt, der als ein äußeres Erkennungs-
63
größeren Maßstab vermuthen; dass auch noch während der Arbeit sich die
…
jedesfalls ist diese künstlerische Form der Schildstütze so vereinzelt, dass sie als
…
lung der Athene, die durch die Tracht und die schräge Aigis als Friedensgöttin
…
— so sicher lehrt die genauere stilistische Prüfung der Statue, dass wir es hier
…
für die Erkenntnis der Kunstart jener Athene des Alkamenes kann die Borghese'sche
64
stattet, in ihrem gesammten stilistischen Charakter so deutlich das Gepräge der
…
des ausgehenden V. Jahrhunderts erkannt worden ist, ganz in der Weise, wie
…
2) Seither habe ich durch eine freundliche Mit- bindung gebracht und mit der ,Athene mit der Ciste'
…
mit der Athene der Inschrift CIA I 319 in Ver- und sein plastischer Schmuck'ausführlicher sprechen.
65
Wie das Standmotiv, so weist uns auch die Gewandbehandlung auf ein
…
Cherchel gefundenen Copien zusammenzustellen ist, die in der Zeit Iubas II. und
66
worden sind; unter ihnen ragen die beiden (ebenfalls bei der Porte d'Alger gefundenen)
…
Was zunächst die äußere Charakteristik der Athene von Cherchel anlangt,
…
schrägumgelegter Aigis angethan, steht sie Hephaistos gegenüber auf einem
…
ihrer natürlichen Lage verschoben ist. Die zahlreichen Beispiele der Vasen, wo die
67
in der sie als Wehr und Waffe dient. Ein dauerndes Beharren in friedlicher
…
kriegerischen Zug, der darin sich auszusprechen scheint, hat man längst schon als
…
dem völligen Aufgeben aller Kriegsbereitschaft, wie sie in der Statue von Cherchel
…
darin, dass auch hier das Gorgoneion noch in der Mitte der Brust aufsitzt, ist
…
Werk auf Phidias zurückzuführen. Denn wenn sich
…
dem Bologneser Kopf und dem Kopf der Parthenos,
…
unbehelmt gewesen sei, schwebt zu sehr in der Luft,
68
■das bedeutungsvolle alte Schema gewahrt. Die Statuette, der man gerne mit
…
einem zweiten auf der Akropolis gefundenen Athene-Torso, der bei Conze,
…
der Schmalheit der schärpenartigen Aigis, dem ungegürteten Gewandüber-
…
wenn, wie ich nach Maßgabe der Athene des Louvre (Figur 35) annehmen zu müssen
69
hin zeigen werde — aller Wahrscheinlichkeit nach die Waffen der Göttin eben
…
dass ein gewissenhafter Copist — und als solcher stellt sich der Verfertiger der
…
Statue, die statt jener als Vorbild der Figur von Cherchel zu gelten hätte, das
…
weichen darin von der Figur von Cherchel ab, dass Schild und Akanthos-
…
verwendete Motiv der eingestützten Hand zu verwenden.
…
neuen Aufnahme P. Arndts abbilde. Die Figur ist r39m hoch, der Körper aus
70
Beide Arme sind ergänzt, die vier Fingerspitzen der Hand am Gewand auf der
…
graphie danke ich der freundlichen Ver-
…
Der einfache Charakter der Faltenbehand-
…
chem Marmor gearbeitet ist, besteht der
71
Ohr, wo der Überarbeiter versäumt hat, einzugreifen, noch erkennbar, dass unter
…
großkrystallinischem gelblichem Marmor. Kopf und Hals sind ergänzt, ebenso der
…
Original uns lehrte, nicht viel Neues hinzu. An der Athene Cherchel scheint kein
…
die Haltung des rechten Armes betrifft, so haben die Ergänzer der römischen
…
nächst scheinen mag, mit ziemlicher Sicherheit auf überlebensgroßen Maßstab
72
Zeigen die italischen Repliken, dass das Vorbild der Athene Cherchel auch
…
,Athene mit der Ciste', die aus Kreta in das Louvre-
…
Abbildung der französischen Publication wiederholt,
…
worden, was insbesondere an der Rückseite und am
…
des linken Unterarmes und die Form der Aigis: im
73
mit Hephaistos verbundene Göttin, so dass wir aus der Ähnlichkeit der beiden
…
des Kopfes würde ganz wohl auch mit dem Typus der Athene Cherchel vereinbar
…
Gibt uns die Athene des Louvre den deutlichen Beweis dafür, dass der von
…
Von allen den großen Schöpfungen der phidias'schen Epoche können wir
…
des einfachen, der Mantel zum Chiton tritt, zum Theile greifen die Änderungen
74
betrachten. Stellung und Haltung der Arme stimmen mit unserer Athene überein;
…
Durch das charakteristische Motiv der schrägen Aigis ist ferner mit der
…
d. Wissensch. XX 3, S. 33 T. V). Das Gewand ist im Marmorstile der nach-
…
Der Kopf ist nicht zugehörig. Ergänzt ist der rechte Arm mit dem Ärmel,
75
Seite gesetzt ist. Die linke Hand liegt auf dem Schilde, der auf einer Akanthos-
…
perhafte Arbeit der Statue
…
der in zahlreichen Repliken vor-
…
der Weise sich abgeleitet den-
76
dass der Künstler in Äußerlichkeiten an das Cultbild mit bewusster Absicht
…
geäußert wurde, es sei das Original der Borghesischen Figur eben jenes Weih-
…
Zu dieser Reihe von Statuen, die unter dem Einflüsse der Athene Hephai-
…
(Le Bas T. 48, Friederichs-Wolters 1169). Auf letzterem sehen wir Athene behelmt
…
habe, daraus das eine erkennen, dass Alkamenes der eigentliche Fortsetzer und
…
schärpenartige Aigis; der rechte Unterarm ist erhoben,
77
der.gegebenen Aufgabe charakteristisch angepasst.
…
charakter der Statue der Kopf der Athene des Louvre sich fügt, darf jetzt wohl
…
sodot als einen Vermittler zwischen der phidias'schen Herbe und dem ,Sentiment'
…
nicht verstärkt worden ist, nicht entkräftet worden. Ich vermag innerhalb der
…
die als Oiipavta der Nemesis verwandt war, von einem Künstler wie Alkamenes
78
Amelung7) behandelten Typus der angelehnten Aphrodite, wie er uns einerseits
…
Dagegen ließen sich wohl mit der Kunstart unserer Athene vereinigen die
…
mit der Frage, ob nicht auch von der zweiten Figur der Gruppe sich noch eine
…
eine weibliche Gewandstatue aus der Werkstätte der
79
significans." Wir werden uns nicht mit der Frage quälen, in welcher Weise der
…
Der Nachdruck, mit dem in jenen Bemerkungen das Gewand hervorgehoben
…
gehüllt, auf Stöcke gelehnt, den
…
der Votivreliefs. Ich hatte, da
…
auf sich zog, mir vom General-
80
berichte der Münchener Akademie, 1897, 290, publiciert worden.
…
Reliefs aus der Zeit um 400 kennen. Die kräftige, einfach profilierte untere Randleiste
…
einer zweiten ähnlichen Darstellung getrennt haben mag. Links ist der Stein
…
rechten Arm wird der Zipfel eines schmalen Mäntelchens sichtbar. Die Aigis läuft
…
zwischen den Brüsten zu erkennen. Die Partie von den Knien bis zur Mitte der
81
erkennen haben. Er lehnt auf einem Stab, der unter der linken Schulter einge-
…
Kopf ist Haar und Bart kurz gehalten. Mit der Rechten hat er den Helm am
…
zufahren und ihn so auf die Hand zu nehmen.
…
obwohl der Wortlaut auch die Möglichkeit offenlässt, dass der späte Autor nicht
…
alten Waffen, der Aigis und Lanze, geboren werden und die neueren Metallwaffen,
82
dersicht mit dem Schild am linken Arm, den gehobenen Speer in der Rechten,
…
in Hinweis auf die bei Apollodor vorliegende Sagenform geschehen, wonach
…
ist aber auf dem Relief von Epidauros durchaus ferngehalten. In Züchten und
…
beiden Elemente der Sage, die Liebeswerbung des Hephaistos und die Geburt
…
Zeugnis auf dem amykläischen Thron des Bathykles von Magnesia vor, unter
…
Harrison, Class. review 1895, 87; Dümmler bei matinger, Die attische Autochthonensage bis auf
83
Relief auf einem Altarfragmente, das jetzt vor dem Faustinatempel auf dem
…
verfolgt von Hephaistos, der den Hammer geschultert trägt und mit der Rechten
…
der ionischen Heimat mitgebracht haben; im ionischen Osten sind nach den über-
…
wir nicht mehr festzustellen. Aber gewiss ist, dass sie erst auf attischem Boden
…
die verschiedenen Versionen hier nur so weit, als sie sich auf den ,erdgeborenen
…
Die Vorstellung, dass Erichthonios-Erechtheus ein Sohn der Erde gewesen sei,
…
kaum annehmen dürfen, da einerseits die Mutterschaft der ,Erde' schon feststand, .
84
mögen. Als Sohn des Hephaistos und der Ge erscheint Erechtheus in der
…
in Verbindung bringen dürfen, wobei schon die demokratischen Ansätze der
…
und Hephaistos auf Erichthonios erworben hatten, hat die (in Anlehnung
…
scheint es mir zulässig, mit Robert (Die Marathonschlacht in der Poikile S. 75)
85
Hephaistostempel einen Neubau zu erkennen, der an Stelle einer älteren, wohl
…
Cultsage des Hephaisteion die Vorgeschichte der Geburt des Erichthonios im
…
von der Erichthonios-Sage völlig unabhängig waren. Schon in solonischer Zeit
…
zusammen in der Sorge für das athenische Volk und die ganze arbeitsame
…
der Anschauungen, die in den Tempelbildern verkörpert waren, entstanden ist. Wo
86
aufstellen, dass dem Künstler des Reliefs auch bei der Gestaltung seiner Figuren
…
in der Tempelgruppe selbst die beiden Gottheiten durch das Motiv der Helm-
…
der attischen Votiv- und Urkundenreliefs zur Parthenos stehen.
…
Aber wie einerseits der auf die ,Lemnia' bezogene Athenetypus aus stili-
…
wir wissen, eine Einzelfigur. Wie ich also nicht glaube, dass der Reconstruction der
…
So wenig der Künstler die Absicht haben mochte, das athenische Tempelbild
87
Zeit so vielfach beobachten, bei der Darstellung seiner Athene Hephaistia unter
…
nischen Hephaistosheiligthum enge verknüpft, so wird man gewiss auch in der
…
erscheint, wäre wohl geeignet, die Vorstellung zu erwecken, dass der Gott infolge
…
In einer Statue mochte derartiges kaum so stark betont sein, der Gott
…
so kann nach allem, was wir bisher ermitteln konnten, 'keinesfalls der kürzlich
…
Bedenken die Deutung des Torso auf Hephaistos überhaupt in Frage stellen,
88
dass unter den Statuen, die auf den Namen des Asklepios gehen, eine genauere
…
in der Zeit um 420 v. Chr. geschaffen hat. Schon Eranos Vindobonensis S. 22
89
werden wir ihm wohl entnehmen dürfen, dass der Hephaistos des Alkamenes
…
würdigte Kopf immerhin in seinen charakteristichen Zügen auf die von Alka-
…
schaffen worden war, zu der göttlichen Hoheit emporgetragen, die dem fürsorg-
…
einem Bilde der Göttin überliefert
…
Aufnahme des Pinax, die ich der
…
tafel zu thun, für deren genauere Beschreibung ich auf Furtwänglers Katalog
90
Die Darstellung des Fragmentes hat ebenso wie die Inschrift der Giebel-
…
Aber auch der jüngste Deutungsversuch von E. Curtius, Arch. Anzeiger 1894,
…
aus diesem Grunde liegt es nahe, die ganze Inschrift auf die eine Figur der
…
Damit wird der Kreis der Deutungen, die das fragmentarische Bild erlaubt,
…
nimmt, und Nike mit einem Kranz auf den Knaben zufliegt. Aber bei der
…
Die Art, wie der von der Aigis umhüllte linke Arm vorgestreckt
91
der knäuelartig zusammengeschobene Schlangenbesatz der Aigis nur dann seine
…
Gedächtnis, auf denen der siegreiche Fackelläufer neben dem Altare steht und
…
den Altar zu denken haben, dessen Feuer der von Nike bekränzte Läufer mit
…
eines reinen heiligen Feuers von einem Ort zum anderen. Dass der Wettlauf der
…
Wecklein, Hermes VII 437, Benndorf, Zeitschr. Jahrb., VII 149, Ad. Schmidt, Handb. der griech.
92
an den Promethien, wo der Fackellauf ein Nachbild des ersten Feuerraubes
…
des Burgplateaus, so könnte man auch an den Altar der Athene Nike oder an
…
geben, wie die vorher erwähnten Vasenbilder. Eine Statue, die den Namen der
93
der Burg, der das Stadtfest gilt, in mehr als einer Beziehung mit Hephaistos
…
So liegt es nahe, anzunehmen, dass auch im Culte ein Theil der Pana-
…
Ausübend wie betrachtend stand Goethe der bildenden Kunst durch sein
…
und auf die Wurzeln hingewiesen, mit denen sich Liebe und Bewunderung
…
der Burg, der das Stadtfest gilt, in mehr als einer Beziehung mit Hephaistos
…
So liegt es nahe, anzunehmen, dass auch im Culte ein Theil der Pana-
…
Ausübend wie betrachtend stand Goethe der bildenden Kunst durch sein
…
und auf die Wurzeln hingewiesen, mit denen sich Liebe und Bewunderung
Archäologisches zu Goethes Faust
94
zusammensetzt, die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme und die
…
Unterliegen kann aber offenbar nur der Mangel eines jener drei Elemente sein,
95
stückelte Natur, die als ganzes wirkt, sich eins weiß mit der Welt und die
…
empfunden wird, dass also der Künstler sich selbst und seine Empfindungen
…
derselben Sache, wenn für Goethe die Folge dieses Sicheinsfühlens der Person
…
in höherem Sinne Eines sind, geboten. Wenn aber der Bruch der Persönlichkeit
…
gutem wie in schlimmem Sinne darf man von der modernen Kunst behaupten,
96
immanenten Empfindungen des Geschehnisses im Beschauer hervorruft. In der
…
unsere Poesie Gefahr laufe, sich in eine Literatur der Memoiren und Selbst-
…
Werken technisch unausgebildeter Perioden die Keime eben jener Vorzüge auf,
…
auch der Reconstruction von Bildwerken, die bloß literarisch überliefert sind,
…
Production mit solcher Lebhaftigkeit vor, dass sie ihn über die Schranken der
97
pheles in der Vorahnung, dass nunmehr die Wette erfüllt werden muss, statt der
…
seinem Tode entbrannten Kampf der himmlischen Mächte schieben und den
…
genug, ebenso dass sie später mit den ,larvae', den bösen Geistern, die in der
…
Im Jahre 1809 war von Bauern in der Nähe von Cumae eine Grabkammer
98
Das zweite zeigt uns drei skelettartige Figuren, die jedoch nach Art der antiken
…
in der Unterwelt, wo
…
enthalten, was der
99
ihres Zustandes durch ihre Kunst zu erheitern, aber „ein wahres Bild der trau-
…
Gerippe erscheinen und zusammenstürzen." Ein Blick auf die Abbildung der drei
…
richtigt. Nur in einem Hauptpunkt, der Auffassung des ersten Bildes, scheint er
…
Tänzerin zu Lebzeiten in der Ausübung ihres Berufes dargestellt war, wenn man
…
der Tanz, in den drei Stadien des Lebens, des Übergangsstadiums und des
…
sehr der Goetheschen Auffassung nähern, dass wir ihn nicht zu verfolgen brauchen.
100
Nach Olfers Versicherung ist das Gelagbild in der Mitte der Grabkammer
…
Die Goethe'sche Anordnung steht und fällt mit der Annahme einer cycli-
…
zuletzt noch durch den Fund von Bosco Reale zutage getreten sind, von der Auf-
…
vivere ist, so muss sie allerdings die widerwärtigste Gestalt bilden, die der
…
und darauf verzichten, ein späteres Stadium, in welchem der Schatten in der
…
Composition der drei Bilder zu leugnen und damit unserem Skelettbilde einen
…
sie so beschrieben, wie sie dargestellt sind. In der Positur der tanzenden
101
Harlekin und Colombine unser Leben lang- zu entzücken wussten." Der Grund
…
beiden Zeilen der ersten Strophe fast wörtlich übereinstimmend, die letzten zwei
…
ihm in der Wundernacht plötzlich begegnet und von Faust zum Bleiben auf-
…
der auf seinem eigenen Rücken einst Helena trug und jetzt Faust trägt. Wie
102
der zügellose Reiter die Mähne des Pferdes fasst, so diese das Haar des Chiron.
…
Der Philyra berühmter Sohn!
…
als Pedanterie. Aber erinnert wird er sich dabei der Stelle in den 'A^iXAewg
…
Beziehung auf Philostratos, freilich nicht auf die imagines, sondern auf den
…
Hat doch Achill auf Pherae sie gefunden
103
In der classischen Walpurgisnacht treten die Pygmäen auf, die sich zum
…
Weht sie doch schon auf dem Helme
…
natürlich die bestimmte Beziehung auf die Feindschaft der Pygmäen und Kraniche
…
gekannt hat, bietet sich zunächst die Vase bei Tischbein-Hamilton1) dar, in der
104
bäuche der Goethe'schen Vorstellung entsprechen, und als unbehelmt seine Pyg-
…
der deutschen Übersetzung des Winckelmannischen Werkes, von der „Sammlung
…
Er nahm an, dass die Pygmäen nach der Vorstellung des Künstlers zuerst einen
…
Wandgemälde der casa dei capitelli colorati0) sind deutlich an den Helmen der
105
Tischbein noch eine zweite bildliche Darstellung hinzugesellte, der die Stelle
…
Der zeitliche Wandel in Goethes Verhältnis zur Antike
…
In den einleitenden Capiteln der vorangehenden Untersuchung hat Emil
…
benützen, mit der man in einzelnen Fällen die betreffenden Abschnitte der Zeit
…
Tischbein noch eine zweite bildliche Darstellung hinzugesellte, der die Stelle
…
Der zeitliche Wandel in Goethes Verhältnis zur Antike
…
In den einleitenden Capiteln der vorangehenden Untersuchung hat Emil
…
benützen, mit der man in einzelnen Fällen die betreffenden Abschnitte der Zeit
Der zeitliche Wandel in Goethes Verhältnis zur Antike dargelegt am Faust
106
Das sind die aufgeregten Gestalten der Kunst des achtzehnten Jahrhunderts mit
…
nach der Feldschlacht geht mein feurig Sehnen" —, Verse, die gut unter Tischbeins
…
Zeigt nun dieses Beispiel, wie selbst bei einem Manne, der der bildenden
…
vaterstuhl, mit dem sandbestreuten Boden wird geschildert, wie sie in der Zeit von
107
Stücke der Dresdner Gallerie die kleinen Scenen Domenico Fetis angezogen
…
dem Einzigen gemacht, der er ist". An anderen Stellen bricht zuweilen ein
…
beseitigen und das gothische Meisterwerk der ungeheuren Fenster mit nüchternem
…
Als Goethe vor der Rückreise von Rom 1788 den Faust wieder vornimmt,
…
der Hexenküche erscheint zum erstenmale die antike Heroine, nicht als Statue,
108
Hause des Jeronimo Marcello in die Dresdner Gallerie gekommen war, der Phantasie
…
Form aus der modernen Kunst heraus, die nun schon seit Jahrhunderten die
…
gelegentlichen Entwürfe der Hexenküche und einigen Änderungen bei der Aus-
…
wieder im Frühjahre 1806 ausgefüllt mit den Ereignissen der Osternacht, dem
…
dem Entwürfe zur ersten Erscheinung der Helena hat sich erhalten.3) Von spar-
109
Worte des Zigeuners: „ich bin Johann von Löwenstein aus Klein-Egypten" in der
…
der Egypterin mit einer „Drohung". Die Antwort der Egypterin darauf, die die
…
Darf der Frau ein Schnippchen schlagen
…
Helenas „Jammer" ertönt, „dass sie Venus wieder belogen", ihre „Klage der
…
wenig zu verspüren. Alles athmet die ruhige heimatliche Schönheit der Haupt-
…
Stuttgart 1891 n. 100 will in der Egypterin Mephi-
110
himmlischen Schlüsse, der aus dieser Zeit noch erhalten ist. Das Blatt mit der
…
Renaissance der Antike, dass er den heimischen Stoff von Hermann und Doro-
…
Goethe nieder, erfüllt von der Erinnerung an antike Poesie und antike Kunst.
111
von Bacchus begünstigt, der Quellgott auf einem Lager von Traubenblättern,
…
im Faust vor Augen, im ,Einschläferungsliede', wie er selbst den Gesang der
…
Verbindung der verschiedenen Elemente im Liede:
…
1450 Freundlich der blaue Geistige Schöne,
…
s) In einem Briefe an Zelter I 41g, n. 158. der Übersetzung „einige trinken, andere wälzen
112
Hat uns der Dichter erst durch atmosphärische Bilder in ein mildes Klima
…
Die sich auf Wellen
…
Flieget der Sonne,
…
Der Weinstrom, die Singenden, die Tanzenden sind aus den ,Andriern£
…
]I) Der Rhythmus und die Empfindung des Ein-
113
wo er aus der antiken Wolke sich niederlassend, wieder seinem bösen Genius
…
Ludwig Friedländer hatte die überraschende Entdeckung gemacht, dass der Chor
…
Kupferwerk über den Campo Santo beeinflusst sei, meinte dann, der ganze
…
„Chor der Büßerinnen . . . Maria Magdalena . . . Die Samariterin . . . Chor . . .
114
wiederholt, indem er der Magdalena, die er nun Magna Peccatrix nennt, und der
…
Der alte Kaiser hatte in einen Entwurf seiner allegorischen Lebensgeschichte
…
stück zum Vorspiel im Himmel; das klingt in den Liedern der Osternacht fort
…
Gericht über Faust."18) Daran hätte sich der vollendete Schluss gefügt. Bei der
…
10) Simon Laschitzer, der Tlieuerdank, Jahrb. ls) W. A. 15, 2. Abth. p. 243 Par. 194.
115
Der früh Geliebte,
…
Die Verse nach 12075 mussten jetzt fallen. Über den Bergschluchten der
…
Maria schwebt über der Weltkugel, Chöre heiliger Büßerinnen ziehen ihr
…
heiliger Verehrer der Maria gesellt sich anbetend zu den Gruppen im Weltenraume,
…
Entwurf berichtet, wo sie mit den Evangelisten und der Mutter Gottes um
…
aus einem Kreise heiliger Märtyrerinnen hervortretend, neigt sich demüthig vor der
116
die wie eine Illustration der letzten Scene des Faust aussehen. Aber das mag ein
…
Kuppelfresken sind gestochen. Die Kuppel der Chiesa Nuova mit den schwe-
…
auch zugemuthet, von der Kunst etwas zu verstehen. Es wäre einem gebildeten
…
lombardischen Vorbilder in jener Zeit schwerer hineingefunden. Auf den römischen
…
Über die Antike her war Goethe zu Raphael gekommen, auf diesem Wege
117
15- Jahrhunderts Rücksicht, und die Ausschmückung der Kapelle in den Wahlver-
…
In der Helena — mit ihr beginnt 1825 die neue Arbeit am Faust — ruft er
…
wohl in Fugen mit spiegelglatten Wänden", an denen selbst der Gedanke
…
Antike und mittelalterliche Architektur werden sich dann auch in der Scene
…
Kaiser und dem Hofe erscheint ein dorischer Tempel, den der Astrologe sogleich
…
23) Als weiter vor dem Erscheinen der Geister
…
dem Dreischlitz an der Leier des Apollo. Das geht
118
allermeist." (6409—6414). Der Unterschied dorischer und gallischer Baukunst
…
Ausruhens, den Arm zierlich über das Haupt legt, nennt das der deutsche
…
Anderswo erscheinen glänzende Bilder im Stile der italienischen Renais-
…
6920). Auf ältere italienische Malerei geht die Darstellung Faustens in der vor-
…
gedichteten zweiten Theile der Schlussscene erschien, als eine von Engelknaben
119
wenn nicht aus der Tradition, so doch aus dem Weißkunig wissen. Als er das
…
hatte Lorenzo Magnifico gemacht. Das Ganze war von der Antike ausgegangen. Mit
…
ein italienisches Kunstwerk der Renaissance vor Augen gehabt, den ihm so
…
Reimsprüche führen". Jahrb. der Kunstsamml. des
…
poli 1750), hier findet sich der Triumph der Klug-
120
großen Wagen erscheinen, dürften vielleicht mit der besprochenen Sammlung
…
genommen, ja sogar die Nymphen, die den großen Pan umgeben, gehen auf
…
Wie hier italienische und deutsche Kunst, der Nachklang deutscher und
…
und Mondeslicht, die nur ein Maler von der Größe und Kühnheit Tintorettos
121
gekommen sein. Der Seismos ist der Personification des Erdbebens nachgebildet
…
nur hier darauf hinweisen, dass auch der rosenstreuende Engel aus dem Fresco des
…
eine Seele zum Himmel geleiten, finden wir häufig auf alten Gemälden," dürfte
…
die Vorstellung der Körperformen dieser Engel, die Mann und Weib verführen
…
„wie frömmelnder Geschmack sich's lieben mag" (11688). Es mag sich darum der
122
Man könnte sich denken, dass der Faust nach allen Seiten hin durchforscht
…
In der Schrift ,Intermezzi' hatte Adolf Furtwängler die These zu begründen
…
Bande der archäologisch-epigraphischen Mittheilungen gerichtet. Sie zeigte, dass
…
sichtigt, also Scenen der dacischen Kriege zu erkennen seien; dass sich die
…
Man könnte sich denken, dass der Faust nach allen Seiten hin durchforscht
…
In der Schrift ,Intermezzi' hatte Adolf Furtwängler die These zu begründen
…
Bande der archäologisch-epigraphischen Mittheilungen gerichtet. Sie zeigte, dass
…
sichtigt, also Scenen der dacischen Kriege zu erkennen seien; dass sich die
Adamklissi noch einmal
123
dings in der Nähe entdeckte Inschrift nach Tocilescos und Theodor Mommsens
…
Besprechung des Monuments, welche die Sitzungsberichte der Münchener Aka-
…
geworden. Aber mit diesem Fortschritt der Einsicht verquickt sich eine Folgerung,
…
könnte daher seine an den Thatsachen scheiternde Vermuthung von der Entstehung
…
ironisch hingeworfenen Gedanken griff Furtwängler in vollem Ernste auf und
…
angebracht haben, die seinem eigenen Siege in der Dobrudscha galt. Ein zeich-
124
erscheinen kann, wenigstens dem Zeugnis der Inschrift nicht mehr offen wider-
…
Die ursprüngliche These, so behend sie alles auf den Kopf stellte, war wie
…
Bedeutung, den die Römer an der unteren Donau gegen die Barbaren führten,
…
er in der zeitlichen Reihe historischer Möglichkeiten an erster Stelle zu er-
…
dass eine solche Selbstbescheidung gerade von Trajan, einem der ersten Bau-
…
mente der Statue anzubringen, sind erbracht Adam-
125
der Zeuge vergangenen römischen Ruhmes, römischer Ehre, von den Barbaren
…
zeitweilig — nicht etwa ephemer bei einem der rasch zurückgewiesenen Einfälle,
…
wo er am ehesten denkbar wäre, ward die Verwaltung der Landschaft in ein
…
5 der traurigen Copie einer lusitanischen Inschrift
126
eroberung der Provinz, sondern der Wiedergewinn eines Gebäudes in der Provinz
…
Das Unvorstellbare steigert sich, wenn man der angenommenen neuen
…
vermied Furtwängler mit Recht zu sprechen. Kein Stein der Ruine lässt etwas
…
wie rathlos lässt die Rhetorik dieser vagen Ausdrücke. Gewiss mag ja der durch
…
hat, mit nichten aber eine neue Dedication, wie zahlreiche Fälle der Arvalacten
…
römischen Gottes entzog, und dass nach Rückerlangung der Provinz die Dedi-
127
erhält, wie der private Grundbesitz einer wiedergewonnenen Provinz ,iure post-
…
Entgegenstehende mit Gewalt hinwegzuräumen. So den wichtigen Namen der
…
schien, dass der Stadtname für das Monument beweisend sei, plötzlich in Abrede;
…
ihrem Gründer ,Traiani' oder ,Traianum' geheißen, so läge in der vereinigten
128
können glaubte." Die ausführlich behandelte Münze, auf die wir uns allerdings
…
besonders hervorzuheben, was so klar auf der Hand liegt, dass sie für die Ent-
…
das letztere an. Denn den eigenthümlichen Wert der Münze von Tomis hat
129
warum eine Beurtheilung dieser Frage nach der Publication unzulässig sei. Unter
…
ein Gefolge von Praetorianern, durch den Gestus der Adlocution und auch, wo er in
…
für den Kaiser typisch ist, wie namentlich die Trajanssäule lehrt, auf der er über
…
in der nämlichen Weise eingeordnet, wie
…
bestrebt waren. In Metope 39 ist von seinem Kopfe der obere Theil, in Metope 44
…
hochliegend, die Stirn zwischen den Brauen in scharfe Falten gelegt, der rechte
130
das Haar über der Stirn hohes Relief, während es am Hinterkopf schwach ist
…
Schärfe äußern könnte. Neben der geschilderten Haartracht gibt aber die Form
…
in Adamklissi. Ich habe früher mitgetheilt, dass mir diese Ähnlichkeit der Kaiser-
…
fasst die Metopenreihe als einen Nachtrag auf, den
131
nauere Kenntnis von der Entwickelung der Bauformen und ihrer Ornamente und
…
einen Kriegszug gegen die Daker und Bastarner. Veranlasst ist der Krieg durch
…
und stößt dann auf sie selbst beim Kebrosfiüsse (Cibrica,, östlich von Widin),
…
auf diese Vorhut, verfolgen sie in den Wald und werden von der vorbrechenden
…
des Octavian) gewesen wäre." Überlebende kommen um in der Donau, in einem
…
Im folgenden Jahre stehen die Bastarner nochmals an der Grenze Makedoniens
132
im Gebiete der Dentheleten. Crassus überfällt sie, besiegt sie zum zweitenmale
…
thrakischer Stämme mit Ausnahme des östlichen der Odrysen, denen er die
…
durch Zumauerung der Eingänge. Dann wendet er sich östlich auch gegen andere,
…
Land und Wasser und erobert es nur mit großer Anstrengung, obwohl der König
…
Alündungsgebiete der Donau an der Küste des schwarzen Meeres, in Luftlinie
…
taxov TTjj Zupa^ou dpyjjQ m^o? und der Schilderung, die er von seiner schwierigen
133
wo der Fluss ein Gebirge umströmt und von den Festungen Matschin und
…
Aber die Metopenreliefs sollen die deutlichste Darstellung der großen
…
Kampfbilder, alle ohne jede scenische Bezeichnung, nur auf zweien kommen
…
ist, eine im offenen Felde sich abspielende Schlacht schildern, die der Kaiser
…
hinwegsprengend, der zwischen den Vorderbeinen des Pferdes zusammenbrechend
134
Kaisers wiedergeben, der über einen am Boden liegenden Barbaren als
…
auf der Trajanssäule Herden dem Abzüge der Dacier folgen; keine Spur einer
…
Bemerkung allgemeinerer Art hinzuzufügen habe. Wenn die Form der nämlichen
…
erreichte politische Lage die Möglichkeit eines großen Römerbaues in der
135
Lauf der Donau ausgedehnt —, aber festen Landbesitz nirgends erzielt. Später
…
Werth nicht nur auf die eigene Freiheit legten, sondern andere Stämme zu
…
commando, das zunächst im Centrum der Balkanhalbinsel, in der Dardania, unter
…
städte an der Küste des schwarzen Meeres standen, aber unter Augustus auch
…
liches Bild von der im Lande herrschenden Anarchie. Barbareneinfall auf Bar-
…
endung fordern. Durchaus undenkbar wäre dies in der damaligen Dobrudscha ohne
136
Wie klagt der Arme über die Monotonie seiner Klagen, wie hascht er nach
…
Adamklissi nur an zwei Punkten einen Fortschritt. Dem einen der drei ver-
…
problem gelten, das zu der historischen Frage ganz außer Beziehung steht, be-
…
grabungen in der Römerstadt Adamklissi uns noch um weiteres Reconstructions-
…
In der ersten Besprechung unserer Publication hatte Furtwängler meinen beiden
…
da erst mit Einweihung des Tempels dieses Gottes auf
…
Rechte des Juppiter Capitolinus auf Mars ultor
137
Arbeitsgenossen Worte der Anerkennung, mir selbst eine übermüthige Kritik
…
wie es mit früheren in der Publication von Gjölbaschi geschehen sei. Das Belei-
…
ich weder da noch sonst wissentlich irgendwem eine Anerkennung versagt, auf
…
Noch einmal habe ich hiernach ernsthaft auf die Sache eingehen wollen,
…
nunmehr erfüllt. Der historische Stoff, den wir fassen und darbieten durften,
Zur Basis des Tropaeums von Adamklissi
138
Professor Bühlmann hat sich der dankenswerten Mühe unterzogen, eine neue
…
Zudem lassen sich die Formen der Werkstücke, welche Bühlmann benützt, dem
…
unserer Publication auf Seite 39 abgebildet sind, als Unterstufe des Waffenfrieses.
139
i-5™ betragende Spannweite der ergänzten Segmentbogen in gar keiner Beziehung
…
Die Hauptstütze des Entwurfes Bühlmanns ist aber der Eckpfeiler (Fig. 42 b),
…
andere Basis und, nach der Messung Herrn Dr. Dregers, einen Kantenwinkel
…
Höhe beträgt 2-34™ der Kantenwinkel misst
…
wie auf der linken Seite; vielmehr ist der
140
Capitäl unvermittelt der obere Pilaster daraufsteht. Neben dem oberen schmalen
…
Die Bearbeitung der oberen horizontalen Lagerfiäche mit ihren zwei breiten
…
Ich habe in der
…
der beim Monumente
Oinochoe aus Eretria
143
Das auf Tafel IV von vorne, Fig. 45 von der Seite abgebildete Gefäß aus
…
der Oinochoe, aber in jener
…
Pelike. Da der vordere Theil
…
duen reiche Classe der Kopf-
144
Gebrauch bestimmten irdenen Töpfen zu erzeugen liebt. In den Zeiten der höchsten
…
in verschiedener Größe auf den Markt brachten, vielfach auch zu gemeinsamem
…
licher Nutzung, während der Töpfer bei allem spielenden Umformen und Aus-
…
Schnauze, da es seiner Bestimmung nach spitz zulaufen sollte; der zweihenklige
145
Becher in der Gestalt nur eines dieser Köpfe und die vorwiegend als Frauen-
…
Unser Weinkrug ordnet sich in keine der genann-
…
aus zwei, aus Modeln gepressten Hälften, der einen
…
Fig. 46 Vase der kaiserlichen er um Fingerbreite kleiner als die Maske ist, so dass
…
verbinden konnte. Der Thon, in dem sie geformt wurde, ist von anderer Be-
…
Ganz im Sinne der Gefäßform verläuft ihr äußerer Contur. Ihr Haar scheint
…
n. 422; der untere Theil der Nase ist ergänzt.
146
Gefäßes, die; von Nase und Kinn durchbrochen, von der Stirne nicht erreicht
…
Lässt auch das Ganze unbefriedigt, so erkennen wir in der Maske für sich
…
Arethusaköpfe auf den syrakusischen
…
Künstlers, der sein Werk mit Hi oder NK
147
gering ihr Kunstwert gemessen an diesen unerreichten Meisterwerken der treff-
…
chung heran, die den Kopf der syrakusischen Nymphe im Dreiviertelprofile,
…
auch vor Kimon der mit <3> sich zeichnende Stempelschneider den Kopf der
…
K-opfe des Parthenope, der das wahre Urbild von Kimons Arethusa ist. Aber
…
Künstlerinschriften der sicil. Münzen (44 Berliner S. 165, wie mir Wilhelm Kubitschek nachweist.
148
hältnis von Haar und Gesicht. Wie die Nymphenköpfe der Münzen hat auch sie
…
verstreuten einzelnen Beeren findet sich allerdings auf den
…
wohl auf die ähnliche Bildung der Augen, die an der Terracotta ziemlich
…
sein. Die Übereinstimmungen der ihm eingefügten Terracottamaske mit den
…
S. 104 ff. der englischen Ausgabe, vgl. Taf. VI
Ein Vertrag des Maussollos mit den Phaseliten
149
Die Inschrift, der nachstehender Aufsatz gilt, ist von dem verewigten Pro-
…
allerdings bei der Verstümmlung des Steines schwerlich möglich und auch mir
…
vorträgt. Aber, wie die Sache liegt, kann nur willige Erörterung der ver-
…
an sich keine irgend erhebliche Schwierigkeit; vgl. die Umschrift auf S. 151-
…
') Monatsberichte der Berliner Akad. 1874, 716. Dialektinschriften n. 1269 (erste vollständige Lesung
150
der dritten Zeile war also der andere vertragschließende Theil genannt. Dann
…
hat auf
…
%-ov3) der
…
kehr der
…
einem rhodischen Actenstücke5) auf der Stele zu Ehren des Eudemos von Seleukeia
…
3) Vgl. K. Hirt, Indogermanische Forschungen richten und Inschriften, die sich auf die Rückkehr
…
grecques n. 356. Nebenbei, eine Sammlung der Nach- in Kilikien 109 ff. In der Deutung der Formel tcTo-
151
Schreibfehler aufweist. Mit Oa beginnt — so will es die Logik der Sprache —■ der
…
-txäv ei xivsc; öcpet'Xovxt E(i Der Name der Phaseliten wird also Z. 3
…
war, so lange Parallelen fehlten, Zurückhaltung ge- Der Herausgeber hat die rhodische Formel zur Er-
…
ird (Jttav sxxXr]Ci£av zum Gegensatze 'hat iitl äuo ex- der Zeit, ohne weiteren Anhalt und nähere Unter-
152
Maua][aü)XX- . .; auch in der letzten suche ich neben Maussollos wiederum die Phase-
…
ich nicht; für die Zeitgeschichte sei auf W. Judeichs Darstellung (Kleinasiatische
…
mäler nie zu liefern vermögen, nie die Vielgestalt der Buchstaben und den
…
Beurtheilung und überhebt mich der unter allen Umständen unzulänglichen Be-
…
Geschichte der griechischen Sprache 327.
153
seine Vorstellung von der Entwicklung griechischer Schrift aus den leblosen, irre-
…
sich, namentlich durch Dittenbergers ausgezeichnete Bearbeitung der Inschriften von
…
Ordnung der Buchstaben länger als andere Gebiete festgehalten hat. In dieser
…
unterrichte11) von altersher geläufige Übung der Silbentheilung.
…
9) So ist z. B. in der von E. Hula und E. Szanto
…
lungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog
154
setzen ist keineswegs geboten. Auch in dem letzten Satze der Urkunde kehrt
…
auf Grund der Voraussetzung, dass zur Linken des erhaltenen Stückes etwa je
…
der Drerier: & ok ßwXä -paiavxwv exaaxov xov xoa|iiovxa axaxfjpas Tievxaxoat'oug &y äq
…
■/.%'. a8öXß)£ in der Schwurformel ebenda 47, 8; lichem Zusammenhange: Inschriften von Pergamon
155
stehende, nicht erst künftig sich ergebende Verpflichtungen handelt, wird der
…
auf die Beschädigung des Steines % für sicher. Übrigens fiele es auch schwer
…
Erheblichen Schwierigkeiten unterliegt die Ergänzung der Zeilen 2, 4 und 6.
…
so häufig10) im Gegensatze zu Ttpo^xifrevat, in einer auf spätere Abänderung bezüg-
…
kann das Wort vielleicht auch hier verstanden werden. Der Vorschlag, den R. Schöll
…
mögliche Fügung zu ergeben, geht aber richtig von der Erwägung aus, dass e&i-
…
(De pactionum inter Graecas civitates factarum . . . nahmen eine jede der beiden Städte innerhalb
156
der Gegenpartei sein, also entweder Maussollos, neben ihm vielleicht Artemisia,
…
ihrem Schwüre irgend etwas, was sich auf den König bezieht tö ßaat[X-,
…
nehmen, es sei von Maussollos und den Seinen ein Schwur gefordert, der
…
ist der Eid auch durch Strabons Bericht 557 über das tepöv Mnjvög <J>apvaxou —) bekannt:
…
Irrig spricht Ziebarth, auf dessen Ausführungen über runt Alexander et successores eius (Paris 1890) 69.
…
hing in die Geschichte der griechischen Sprache 198.
157
an. Noch in Charitons Roman ruft der karische Satrap Mithradates V 7, 10 $eoI
…
etwas zu lang. Zu Gunsten der Formel Tu)(7jv ßaatXewg wage ich nicht die aus zwei
…
einzusetzen, bevorzuge ich zb ßaai[X£ü)s opxiov schon der Kürze wegen, da die
…
der Auswahl und Zuweisung einer Ehrengabe oder eines Ehrentheils (beim Opfer)
…
2S) Ich verweise auf E. Rohde, Der griechische
158
der Phaseliten zu bestimmen. Der Coniunctiv Ypat|i7jxai fordert im Vorangehenden
…
Formel des Schwures bezeichnen, der den Eid der Phaseliten zu begleiten hatte?
…
Noch ist Z. 9 in dem letzten Satze der Urkunde unergänzt geblieben. Er
…
der Zeitpunkt, von dem aus gerechnet gewisse ^Verbindlichkeiten' (um diesen
…
[laxwv trifft der Vertrag zwischen Hierapytna und Priansos 3'<) Z. 57, 63 ge-
…
der ersten Zeile des Psephisma CIA II n. 18.
159
xö Iv (nach Dittenberger, Sylloge n. 46) xotg ioim-zaic, xxX. in dem Vertrage der
…
suchen. So könnte man allenfalls an die der Ostküste Lykiens vorliegende Insel
…
die Gegenstand der dunklen, immer nur vorausgesetzten Begebenheit sein konnten;
…
30) So z. B. in der Inschrift von Zelea: Bechtel,
…
9pou]ptov y.a~a>,7j4'0!iCat Xi|iiva auf den Vertrag
…
können. Die Beziehung auf Philipp hatte übrigens,
…
40) In der Karte zu den Reisen in Lykien u. s.w.
160
es ein Eigenname sein soll, ebensowohl der einer Person, einer männlichen oder
…
zeugende Ergänzung vorzutragen. Trotzdem komme ich immer wieder auf die
…
Hermes 1897, 34- Nebenbei: ist zu der in der
161
Freilich könnte man vermuthen, es sei von der Verbindung -cwv Se IfmpoaS'S auv-
…
es will mir nicht gelingen, auf Grund solcher Auffassung . die zerrissenen Satz-
…
keiten der Deutung und Ergänzung zu Recht, so wäre neben dem Abschlüsse
…
verständlich, wenn jener räthselhafte Vorgang zu völligem Abbruche der Be-
…
scheint mir doch die Deutung auf Vollzug der Eidesleistung, dem Sinne der
…
gethan ward', lässt sich mit Recht einwenden, der Ausdruck klinge für eine
…
und aüvßoXa oder £uu.ßoXcd, wie es attisch im fünften blicke auf unsere Inschrift ßouX6|j.svog sESsvac ei Sn
162
Aufklärung über diese dunkelste, aber auch wichtigste Stelle der Inschrift
…
Der Freundlichkeit Herrn Professor Brunsmids danken wir es, dass wir hier
…
Adam Salzmann beim Fischfange in der Nähe des Dorfes Bijela Crkva, etwa
…
Aufklärung über diese dunkelste, aber auch wichtigste Stelle der Inschrift
…
Der Freundlichkeit Herrn Professor Brunsmids danken wir es, dass wir hier
…
Adam Salzmann beim Fischfange in der Nähe des Dorfes Bijela Crkva, etwa
Neue Militärdiplome
163
enthält, auf der äußeren die (jetzt verschwundenen) Siegel der sieben Zeugen
…
sichert, der antike Ursprung zweifellos; auch ist die Mächtigkeit der Platte, wie
164
Auf der Außenseite sind die Buchstaben weit seichter und sicher von einer
…
in der Mitte _i steht. Das seltene Cognomen Sanrici Z. 2 ist vielleicht kelti-
…
sicher. Zu deren Bestimmung ist das wichtigste Anzeichen die Angabe der Ört-
165
lichkeit, wo der Originalerlass des Kaisers in Bronce eingegraben zu sehen war:
…
die aedis Fidei p. R. kommt als benachbart noch in den Diplomen der Jahre
…
x9\c, ffiaxecog vecbv TcpoaTOurjyut'ag bestätigt, dass die Bronceurkunden auf dem Capitol
166
nalen der Militärdiplome das älteste vom J. 52 an diesem Tempel selbst angebracht
…
Namen der sieben Zeu-
…
heit der Platte. Von dem
…
in der Augsburger Aus- Militärdiplom vom J. 152 in Agram, erste Tafel Außenseite.
…
Arvali, auf den Tafeln zu p. 440 abgedruckt. Dieselben müssen nach den
…
legen derselben auf die Marini'sche Tafel überzeugt habe, identisch; ich
167
Platte wird daher an den Anfang der Entwicklung gehören.
…
cher der Ent-
…
Die Völkerschaft der Comaciates), aus der der Entlassene stammte, wird
…
durch bestimmte Angaben ersetzen : vom Diplom des 2. Juli 60, jetzt in Wien (II nach der Zählung des
168
Aavoüßiov Ttorajxov, ferner in den Itinerarien (sieh CIL III p. 421) und der Notitia
…
Der Name der Gattin, wohl sicher Lora3), ist wie der ihres Vaters (Prososius)
…
Dagegen sind die Namen des Sohnes und der jüngeren Tochter Emeritus
…
der ersten Tafel (Abb. sieh S. 166 und 167) und Umschrift aller vier Seiten hinzu.
…
der Text wiederholt von Hülsen Rom. Mitth. 6 (1891) S. 335 f., wieder mit
170
Z. 2 und Anfang von Z. 3 ist der Buchstabe L (Ael\lius); verhauen ist Z. 5 IP
…
Das Auffallendste ist, dass der Entlassene innen als ex gregale bezeichnet
…
erklären, dass unser Dasius, als der Praefect die Liste der zur Entlassung kom-
…
vor kurzem erschienenen Band XX der Arch.-epigr. Mittheilungen S. 164—167
…
war. Dobrusky hat es unter Beigabe genauer Reproductionen der vier Seiten in
172
auf die Abkürzungen; selbst die Zeilentheilung ist vielfach die gleiche, nämlich
…
GERMANICVS und Z. 11 GALLORVM. — In -v_\M der zweite Strich des V. — Z. 9 = 23 von
…
AVT PLVRA leidlich erhalten RA, vorher un- ganz, E bis auf geringe Spuren, weiterhin ETR
173
Auf der Außenseite von Tafel I ist in Z. 24 der entsprechenden Stelle des Innentextes das zu
…
Nach den Titeln des Kaisers Domitian fällt der Erlass, aus dem das Diplom
…
C. XI 5745 mit XVII Ii. Germanicas belegt, die auch ich in der Anmerkung in
…
Stellen der tabula Veleias C. XI 1147 III 13 u. 53, dass er zu Anfang der Regie-
…
noniens am 20. Februar 98, der im Diplom dieses Tages (XXVII = C. III p. 862
174
der Statthalter von
…
der Verwaltung
…
das Auxuien der ■ J
…
vinz noch nicht getheilt war. Andererseits war der III p. 855 n. XII) Pannonien verwaltete, vorher nach
175
der VII Claudia hatte, so erhebt sich die Frage, ob die in dem kaiserlichen Erlass
…
nicht aufgeführt sind, die also der anderen Legion zugetheilt sein werden.')
177
oder geringerer Sicherheit vermuthet worden. Ich füge in der Anmerkungs) über
…
Als Commandant der cohors I Cisipadensium wird ein L. Cilnius L. f.
178
Arretium ansässigen vornehmen Familie der Cilnier in Verbindung stand, mit
…
der Vater mit dem Gentilnamen bezeichnet ist, findet in anderen Diplomen
…
der für das J. 105 in Moesia inferior bezeugten ala
…
Diplom beweist, dass sie in der Zwischenzeit nach
…
Dobrusky bemerkt hat, in der istrischen Inschrift
…
Cohorte schon in der ersten Hälfte des I. Jahr-
…
n. h. V 4, 27 als Nachbar der großen Syrte in
…
Aber Ritterling hatgesehen, dass der in allen bisher be-
…
Mitth. XIX p. 219 n. 82, 3) co\h •!• CRE auf diese
179
der Zeit Vespasians an in den Diplomen häufig dieselben Personen als Zeugen.
…
Horum) eq{uilata) (diesWort fügt der Meilenstein hinzu)
…
wird sie mit der als cohors II Gallorum equitala
…
Mitte des zweiten Jahrhunderts war ihr Präfect der
…
Verschieden ist sie von der II Gallorum, die nach
…
Von der IUI Raetorum war bisher nur der
…
p. 213 n. 71; ebenso der in Szerb-Poszeszena be-
180
(C. Iulius Saturninus und 6 L. Pullius Heracia, wenn nicht der erstere im Diplom
…
Amphipolis ist merkwürdig arm an alten Inschriften1). Es ergieng der
…
May.sSovioc sv Xiirotj etc. Athen 1896 p. 690 ff. ge- sinne Dr. Wilhelms, der so freundlich war, die
…
gend werden in der Revue de l'Instruction publique mich Z. 26 ^rpimc, zu vermuthen.
…
(C. Iulius Saturninus und 6 L. Pullius Heracia, wenn nicht der erstere im Diplom
…
Amphipolis ist merkwürdig arm an alten Inschriften1). Es ergieng der
…
May.sSovioc sv Xiirotj etc. Athen 1896 p. 690 ff. ge- sinne Dr. Wilhelms, der so freundlich war, die
…
gend werden in der Revue de l'Instruction publique mich Z. 26 ^rpimc, zu vermuthen.
Ein neues Psephisma aus Amphipolis
182
Z. 1. "Exouj: wahrscheinlich das Jahr der macedonischen Ära von 148 v. Chr.
…
Z. 13. Der Gymnasiarch scheint zu dem von der Stadt gelieferten Ol anderes
183
am Anfang der Inschrift, die Worte xwv 'AjjicptTTOXixwv scheinen nur für einen öffent-
…
vermuthet (vgl. A. Mommsen, Feste der Stadt Athen 1893 S. 340 ff.), aber dafür
184
ist der Raum kaum genügend. Die 1168-1« wurden bekanntlich in zahlreichen
…
Z. 58. In der Inschrift von Themisonion (Michel 544 Z. 54) wird ähnlich
…
allgemeinen Charakter der griechischen Gymnasiarchie,3) weisen aber auf ein
…
der Schrift scheint das in Z. 1 leider verstümmelte Datum im ersten Jahrhundert
…
tragen. Der greise König sprach den Besucher mit dem stolzen Distichenpaar an:
…
3) Vgl. Glotz in Daremberg et Saglio Dictionnaire stellt, aber die historische Entwickelung der Gymnasi-
…
ist der Raum kaum genügend. Die 1168-1« wurden bekanntlich in zahlreichen
…
Z. 58. In der Inschrift von Themisonion (Michel 544 Z. 54) wird ähnlich
…
allgemeinen Charakter der griechischen Gymnasiarchie,3) weisen aber auf ein
…
der Schrift scheint das in Z. 1 leider verstümmelte Datum im ersten Jahrhundert
…
tragen. Der greise König sprach den Besucher mit dem stolzen Distichenpaar an:
…
3) Vgl. Glotz in Daremberg et Saglio Dictionnaire stellt, aber die historische Entwickelung der Gymnasi-
Heroenstatuen in Ilion
185
Wo der Stein gefunden worden ist, war schon dem ersten Herausgeber,
…
die Ilienser der Kaiserzeit die Helden der trojanischen Sage in marmornen oder
…
und auf Hektor hat Kaibel ein Distichon gedeutet, das Hunt auf dem Friedhofe
…
gleichen Zusammenhang gehört haben, ob nicht die Statuen, auf die sie sich
186
A, E, Z verwendet zu sein. In der ersten'werden einzelne Buchstaben über die
…
Und ebenso variieren die Dimensionen der zahlreichen Hermenschäfte, die
…
zu gleicher Zeit erfolgte und so rasch durchgeführt wurde, dass (wie auf dem
…
Endlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass keines der Epigramme
187
irgendwo so hier in der langathmigen Ausführung des kaiserlichen Briefes ein
…
Typen auftretenden neuen Münzbilder des Zehe, 'ISaibc;, des 'AnöXkw "Exaxog, der
…
Worte sei der in den Handbüchern zusammengestellten Serien von Statuen,
…
bei Behandlung der Epigramme des dritten Buches der Anthologia Palatina,
…
Buch der Anthologie) mit poetischer Begabung, wenn auch nicht in einwand-
…
Auf eine ähnliche Aufstellung, vielleicht an anderer
…
vorausgesetzt, dass es um die Richtigkeit der An-
188
gratissima" (auf dem letzten Blatte seines gleichfalls
…
der "Wiener Akademie angefertigten Literaturindex
…
augenscheinlich auf Herakles, den Oikisten Perinths,
…
Valentianus, der sonst recht selten vorkommt, und
…
dieser Gelegenheit mich über die Häufigkeit der
…
häufig, am seltensten — begreiflich genug — der
189
Der Mai des J. 6511 der constantinopolitanischen
…
Zwei Sculpturen der praxitelischen Schule.
…
Statuen anzusehen sind, gehört der sogenannte Narcisso aus Pompei im National-
…
mal veröffentliche, und zwar zu besserem Vergleich neben der florentinischen,
…
Torso flacher gehalten, bedeckt auch einen Theil der Brust und die linke Schulter.
…
0-51 m (am Florentiner 053™); Hüftenbreite in der
…
Der Mai des J. 6511 der constantinopolitanischen
…
Zwei Sculpturen der praxitelischen Schule.
…
Statuen anzusehen sind, gehört der sogenannte Narcisso aus Pompei im National-
…
mal veröffentliche, und zwar zu besserem Vergleich neben der florentinischen,
…
Torso flacher gehalten, bedeckt auch einen Theil der Brust und die linke Schulter.
…
0-51 m (am Florentiner 053™); Hüftenbreite in der
Zwei Sculpturen der praxitelischen Schule
190
Der Kopf war auch hier stark nach links geneigt, von den an der linken Hüfte
…
Fleisches gerühmt, so wirkt dasselbe an der afrikanischen Copie noch edler und
…
stehen, und bei der Beurtheilung des Stiles wird von ihr auszugehen sein.
…
eines Astes von dem Stamme, der daneben stand, darstellen kann. Thatsächlich
…
welcher vielleicht nach Analogie von Clarac-Reinach II 1, 137 Fig .5 in der mit
191
'Lage der Halsgrube hindeuten, welche sich bei der gegenwärtig-en Wendung
…
Stiertorso der Akropolis.
…
auf der Stelle lag, wo sie ausgegraben worden war. Jetzt ist sie auf die Stufen
…
Es ist der Torso eines Rindes, an den großen Geschlechtstheilen als Stier
…
fragmente, oben S. 17 fr. unterlief Das auf S. 21
…
charakter der Reliefs in Kürze festgestellt. 0. B.]
…
'Lage der Halsgrube hindeuten, welche sich bei der gegenwärtig-en Wendung
…
Stiertorso der Akropolis.
…
auf der Stelle lag, wo sie ausgegraben worden war. Jetzt ist sie auf die Stufen
…
Es ist der Torso eines Rindes, an den großen Geschlechtstheilen als Stier
…
fragmente, oben S. 17 fr. unterlief Das auf S. 21
…
charakter der Reliefs in Kürze festgestellt. 0. B.]
Stiertorso der Akropolis
193
Fläche geschoben, jedesfalls rückwärts der Betrachtung entzogen gewesen sein.
…
Beinen; denn nur bei einer derartigen Haltung kann der Contur des Rückens mit
…
Wie vollkommen das Erhaltene damit übereinstimmt, lehrt ein Blick auf das
194
Weihgeschenk der Marathonier auf der Akropolis zwischen Poliastempel und
…
Periegese, alles Übrige ist Logos, der die mythische Geschichte des mara-
…
tischen Commentars zu Pausanias in dem letzten Satze der Logospartie, dass
…
Münze ist nur von wenigen geringen Exemplaren bekannt und auch auf den
195
Gardner3) wiedergibt, in wesentlichen Dingen undeutlich. Mit der Nacktheit der
…
in der Bändigung des Stieres oder einem Kampfe mit ihm besteht, und von einem
…
das Münzbild auf das Weihgeschenk der Marathonier beziehe, nach dem Gesagten
…
sein, wie umgekehrt in der benachbarten Theseusthat, dem Funde der Gnorismata,5)
…
3) Irahoof-Blumer and Percy Gardner, A numis- 4) Beule, Monnaies d'Athenes S. 399, wo der
196
in der älteren Kunst durchaus vorherrschend und auch das zuweilen vorkommende
…
So ergibt ein junges anonymes Epigramm der Planudea,7) dessen Lemma den
…
Aber mit oder nach der Fesselung wäre die Tödtung durch eine Waffe nicht
…
Jane E. Harrison, journal of hellenic studies 1889 !l) Th. Gomperz, aus der Hekale des Kallimachos,
…
mäler II 1 und das Relief von Sunion, Athenische aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer
Bronzeinschrift von Olympia
197
Die auf der beigegebenen Doppeltafel in Originalgröße farbig abgebildete
…
Olympia ,in der Nähe der deutschen Ausgrabungen' zutage gekommen, und die
…
In der Mitte der vorletzten und drittletzten Zeile haben derbe Hiebe eines
…
gung sichergestellt. Diese Reinigung vollzog der Restaurator der kaiserlichen
…
gegen das Ende hinweisen. Aus dieser Epoche hat uns der Boden von Olympia bisher
…
28. Zeichen der 12. Zeile h ist diesem Alphabete fremd. Der Buchstabencomplex
198
auffassen. Die epigraphische Überlieferung kennt es auf böotischem Boden,
…
Die Formen der Buchstaben, namentlich die ATHAY, das nicht zu breite H,
…
der Schriftweise anderer Orte vorausgeeilt sein. Die einzelnen Zeilen scheinen durch
…
keine völlige Horizontale bilden, so namentlich der fünfte der neunten Zeile, der
…
manchmal auch die A. Das q in xiov von Z. 8 hat einen Punkt in der Mitte.
199
„Die Sippenglieder. soll man nicht verbannen auf keinerlei Weise, weder
…
(selbst) flüchtig sein vom Zeus zu Olympia wegen Blutschuld, und wenn der
…
jemand auf der Stele auslöscht, so soll er Strafe leiden wie ein Dieb von Götter-
…
Die Überschrift Qeöc,- züya. findet sich ebenso auf den etwas älteren Inschriften
…
und n. 2 Z. 3 [ivatg... v.a.(z)$-utciiq. Der Zusammenhang erfordert hier den Accusativ.
200
sicher auf einzelne Personen gehen, wie sie grammatisch auf ysved bezogen
…
kenntnis der Verfassung nicht ausmachen. Nach dem schon aus Homer bekannten
…
eingedrungene Form. Für den Comparativ verweist mich A. Wilhelm auf xwppsv-
…
seine Analogie in der Inschrift von Olympia n. 5. Dieses Beispiel und der
…
Wer entgegen der Bestimmung des ersten Paragraphen eine Verbannung
…
mit dem Wortlaut unserer Inschrift deckt. Wenn ferner von dem cpsuysxw der
201
Ahnlich wird auch in der Rhetra zwischen Skillus und Elis (Inschriften von
…
geflohen sind, als Mörder verurtheilt werden sollen, wenn sie aber in der
…
xjpi'freVTCOV dvSpocpo[vor 6 oe evSajjiewv iz<xpei-q xa toxc xxX. Die Folge ist, dass der
…
Schwieriger ist die folgende Bestimmung, von der zunächst das Prädicat
…
xaxuxpafov (mit der Bedeutung Verwünschung) oder das Particip eines Verbums
…
Es bliebe also die Schwierigkeit, dass neben dem xocxwtpauw der citierten
…
selben Erscheinung begegnen wir aber in unserer Inschrift selbst, in der neben
202
demnach der Name eines solchen sein, wie der inschriftlich und durch Hesychius
…
irgendwer, der will, verfluchen lässt, so soll er unverletzlich sein'. Wenn es
…
wurden, hat es in Olympia gegeben. Die Rhetra der Eleier (Inschr. v. Olympia
…
haben üaxptav als Eigennamen gefasst und in der Stelle die Bestimmung gefunden,
…
Opfer beim Altar des Zeus erfolgte, unter Strafe der Verbannung verboten, und
203
Da in den Verwünschungsformeln, die wir kennen, in der Regel nicht bloß die
…
Der schwache Aorist mit Schwund des Sigma ist eine bekannte Erschei-
…
Delta aus. Wenn in der Folgezeit bei fortwährendem Schwanken, welches
…
Uber den wirklichen Lautwert ist damit nichts gesagt. Auffällig ist ferner der
…
lebenden Personen, so wäre nicht der Aorist cpuyaoeuavx!, mit %a . zu erwarten,
204
gewesen, und wer solche Exulanten verstehen will, müsste sich zu der zwar
…
Der erste Gedanke, 'Aaiaxa als Genetiv eines Eigennamens zu fassen, konnte
…
01 d.YyjLazzLC, erklären. Ebenso in der Inschrift aus Tegea IGA n. 68 xot<S> ä(a)aiaxx
…
ich ihr nicht folge, so geschieht es mit Rücksicht auf die Wortstellung, die nach
…
Soll nun xoip e% ä(a)aiazx der Accusativ sein, so würde den Verwandten
205
außer bei der wegen unfreiwilligen Mordes und beim Ostrakismos, Gütereinziehung
…
urtheil nur auf die heilige Stätte. Endlich beweist der in den beiden ersten
…
Einziehung des Vermögens erfolgt war, so dass dieses sich auch im Besitze der
…
auch die Unbehilflichkeit des Ausdruckes auf weiter gehende Übertretungen be-
206
nicht gesagt, vermuthlich dem Staat, und zwar von dem Verwandten, der dem
…
Dass hier die Strafbestimmung für denjenigen, der die Inschrift unkenntlich
…
auf ac aus und der Complex ETA2TAAAN ist daher ev (= ei?) xd(v) axdXav zu
…
auf aca zu thun. Das Fleische wirft das Sigma des Aorists aus, wofür das cpuya-
207
hergeleitet ist. Ein doaXxow in der Bedeutung von Schrift auslöschen wäre daher
…
2. Zuwiderhandelnde trifft die Strafe der Verbannung, und solenne Ver-
…
5. Die Übertretung dieses Verbotes wird an den Schuldigen mit der Buße
208
Jahre, nach Xenophon, Hellen. VII 4, 28, theils in der Schlacht getödtet, theils
…
* Athen. Mittheilungen I 204 f. des Näheren ausführte, gegenseitig der Bestand der
…
346 der vergebliche Versuch eleischer Flüchtlinge, sich der Stadt zu bemächtigen,
…
der Heimat durch allerhand Beziehungen verbunden, in Griechenland herum-
…
trifft also zu. Zweifellos blieben die Oligarchen noch weiter im Besitze der
209
Nach der Schlacht bei Chaironeia zog Philipp in den Peloponnes und erreichte
…
Aber zwei Bestimmungen des Bundesvertrages mussten auf die Verhältnisse
…
bei bestehender oligarchischer Verfassung weniger auf die Verhütung der demo-
…
eine andere Bundesstadt ausziehen dürften, widrigenfalls die Stadt, aus der sie
210
das Verbot der Verbannung nachgekommen war, musste verhindert werden, dass
…
Abschluss des Vertrags in das Exil gegangen waren, und auf die daher auch der
…
es dennoch nicht in diese Zeit zu gehören, sondern sich auf die identischen
…
dings beschworen. Aber der Zug Alexanders nach Illyrien und das verbreitete
…
gefügt und verbot daher im Sinne der Bundessatzungen die Verbannungen. Ja,
…
zurückberufen wurden. Mag dies der Fall sein oder mögen, was ich eher
211
Rückberufung der Verbannten ein Glied in der Kette von Verfügungen war,
…
dem Pyrrhon Eponym der Demiurgen war. Das ist das Jahr des Gesetzes selbst.
…
ist er selten. Da darf denn wenigstens erwogen werden, ob der in der Inschrift
…
etwa nach der Rückkehr vom Alexanderzug erlangt haben, dass er vorher
212
Einfluss auf ein in seinem Amtsjahre zu Stande gekommenes Gesetz nicht
…
sonnen besprochene lykisch-griechische Inschrift aus der alten Bergstadt Isinda,
…
auf den merkwürdigen Fund lenken mögen. Dass der lykische Text mit dem
…
Urtheil, welches sich auf den Gesammttypus der Schrift, wie sich derselbe in
…
*) Zu Z. 8 (S. 203) erklärt A. Wilhelm üaidptv äSsaX-cohcas tä(v) axdXav als Optativ auf als statt
…
Einfluss auf ein in seinem Amtsjahre zu Stande gekommenes Gesetz nicht
…
sonnen besprochene lykisch-griechische Inschrift aus der alten Bergstadt Isinda,
…
auf den merkwürdigen Fund lenken mögen. Dass der lykische Text mit dem
…
Urtheil, welches sich auf den Gesammttypus der Schrift, wie sich derselbe in
…
*) Zu Z. 8 (S. 203) erklärt A. Wilhelm üaidptv äSsaX-cohcas tä(v) axdXav als Optativ auf als statt
Zur Bilinguis von Isinda in Lykien
213
hinaufzugehen, verbieten nicht sowohl die Buchstabenformen, als der Umstand,
…
Inschrift von Isinda nöthigt, an griechischen Ursprung zu denken. Als in der
…
halikarnassische Inschrift aus der Mitte des fünften Jahrhunderts eine Analogie,
…
2) Das und nichts anderes besagt der Artikel also sind die Perser in Pamphylien thatsächlich in der
214
erklärt als die Stele von Isinda. Der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts
…
Amyntasgrab von Telmessos, welches nach der Aufschrift in die Zeit um den
…
von Gjölbaschi S. 227). Die Masse der bilinguen und der griechischen Inschriften
…
hat, in dem Nachweise des in seinen Anfängen hinter der historischen Über-
…
3) Beiläufig: der auf einer lykischen Münze ge-
…
es der Erwähnung wert gewesen, dass in der grie-
Beiblatt / Provisorisches Statut für das k.k. österreichische archäologische Institut in Wien
1
oder geförderten Forschungen auf dem Gebiete der
…
c) die Oberleitung der selbständigen staatlichen
…
c) die Förderung der archäologischen Studien
…
Der durch das Allerhöchst genehmigte Statut
…
heiten hat das Institut im Einvernehmen mit der
…
An der Spitze des Institutes steht ein vom
…
ziigen in der Regel besondere Zulagen bewilligt.
…
bezüglich der Berufung von Mitgliedern, der Personal-
Beiblatt / Die Cathedrale von Herakleia
3
Die Abgrenzung der Competenz zwischen dem
…
ebenso die Vorstände der selbständigen staatlichen
…
Verhinderung ist der Vicedirector und in dessen
…
a) die Professoren der archäologischen Wissen-
…
An der Nordküste der Propontis liegt, malerisch
…
Namen Herakleia spielt Perinth in der Kirchenge-
…
davon zu entwerfen. Er ist nach OSO, wo der Altar
5
der Metropole. Sie sind einheitlich aus Ziegeln her-
…
Stuckverkleidung, die bis auf geringe Spuren abge-
…
nimmt auf die Nischen Rücksicht, die jüngere, figür-
…
Die Mitte der Kirche ist an den vier Seiten Gewölbe der Apsis sind von der Hand des jüngern
…
/ dass hier eine verschließbare Thüre das Alle diese gemalten Inschriften der Kirche sind aus
…
Der Fußboden des Presbyteriums liegt in der Diesseits der Apsis dehnt sich das Presbyterium
…
einfach geformtes Gesimse abgeschlossen, der Apsis entfernteren Nischen ist je eine mehr als
7
ums verbindet, ist der
…
der erwähnten Bank, hart unter dem Gesimse, die In- wand eine uncanellierte, monolithe Säule einge-
…
Die Nische gleich links vom eine ganz gleiche an der gegenüberliegenden Ost-
…
Zwischen Apsis und Schwelle zustand sehr erschwert. Auf dem zweiten Bilde
…
Ziegeln und unregelmäßigen Steinen errichtet, ge- Frau, der \irßy]p 9-soö (V), entgegengehalten; von
9
(VII) mit der Beischrift VIII ('Itoavvrjs.....) rechts. ist reich verziert. Die Epislylblöcke tragen mit
…
t[oi]]isvog töv 7iapoc[Xuxov] (XI) mit der Beischrift X genauesten, aber noch nicht abschließend, von J. H.
…
jüngerer Zeit nicht übermalt worden sind. Die dem steht die unter XVI a, auf dem rechts anschließenden
…
6 AcqiaaxTjvog (XII), in der linken Hand ein aufge- Überzug seicht eingehauen war, als das Mittelstück,
…
EXp[7]]|j,dTias), rechts o Koauäc; 6 TOirjrjtljg] (XIII).In der gegangen ist, so dass sich etwa folgende Ergänzung
…
über den Nischen und der dazwischenliegenden Z. 2 ['Iousvxtou KeAcjou TExou AücplSEou OEvEou
…
der zweiten Nische (XIV u.dxü)v
…
ionischen Epistyl in drei Bio- und mit fl-eoü); der herrschende Sprachgebrauch würde
…
^1__ obere Begrenzung mit der ETiapxs'av ne forte putes de procuratore dici) hat eine
11
Traiansmünzen mit der Aufschrift Tou. KsXa. Ttpsa.
…
Darüber erhebt sich ein Bogen, der jetzt bis
…
dadurch von den anderen Gemälden der Kirche, dass
…
baut, der so hoch überwölbt ist, wie die gegenüber-
…
Die ganz aus Ziegeln gebaute Thürwand der
…
seitlichen zugemauert sind, während der mittlere eine
…
besten erhalten hat sich das Gemälde in der Wöl-
…
Der innere Thürsturz des Hauptthores ist antik;
…
schnür gelegt ist. An der Außen- ^
…
an der Außenseite der beiden Neben- ThUrstockprofil.
…
der zwei Seitenöffnungen ist innen ein
…
Der einspringende Raum rechts von der Thor-
…
dieses ganzen Raumes ist in der unteren Hälfte aus
13
Bogen, in dem wieder zwei Heilige stehen, führt hier coria 104 ff. Der Nebeneingang der Vorhalle, der an
…
an der Wand, durch die wir eingetreten sind,
…
unten lineare Decoration. Der Thorbogen ist circa " iq IIsptv9'i(ov
…
den beiden Hauptthoren zwei Stichkappen ange- die Stelle einer kleinen Apsis der Innenseite getreten
…
Links von diesem Eingange setzt außen ein bis zur von der Thüre, ist in beträchtlicher Höhe mitten in
…
In ihm ist die Inschrift CIG 2022 (Dumont-Homolle Aufnahme der ganzen Kirche und ihrer Gemälde,
15
der Absicht, bei günstigerem Wetter zurückzukehren.
…
nischen Ccntralbau bis auf Justinian und die Sophien-
…
dort nach einer befriedigenden Lösung auf dem Ge-
…
sucht, der allen Anforderungen des Cultus entsprechen
…
auf vier Pfeilern oder Säulen ruhende Kuppel die
…
Osten außer der Hauptapsis noch die Apsiden von
…
Bauschema nachgewiesen, welches, der endgiltigen
…
kommt, indem sie allen drei Apsiden in der vollen
…
und — ohne Nebenräume — das Katholikon der
…
Kirchen der Provence Ansätze zur Gothik zeigen, so
…
selbständig nebeneinandergelegt sind. In der That
…
ein Blick auf den Grundriss (Fig. 1 und 2), dass sich
…
links und auf der Eingangsseite wiederholt. Die
17
Durchschnittsmaße der Kirchen vom spätmacedo-
…
wo die Tonnen in der Breite des Kuppcldurch-
…
gelegt erscheinen. Ich kenne für diese Art der An-
…
Von Bedeutung für die Datierung der Kirche
…
Lukas sind auf diese Art die zwischen Hauptapsis
…
tieren, weil sie sich in der Einfachheit und Strenge
…
linken Seitenraum. (Vgl. dagegen Kaiinka, der beider-
…
grabungen feststellen, weil sich der Schutt um die
…
wir auf eine Datierung des Baues in eine Zeit schließen,
…
Die Malereien der Palaia Metropolis sind arg
…
In der segmentförmigen Apsis an der Eingangs-
19
links eine zweite Figur, ein Engel, Jollannes der
…
zu der gleichen Inschrift dargestellt Christus als
…
dreijähriges Kind wie er auf einer Decke liegt und
…
uns haben, wie sie so oft über dem Eingange der
…
der Eingangsseite zeigt zwei Martyrien, südlich glaubte
…
die ganze Gliederung macht. Der Durchgang führt
…
sein sollen, die sonst links und rechts von der
…
Wand darüber hatte Darstellungen der Kriegerheili-
…
sie vor der Ikonostasis, von der noch 0*63m breite
…
Vom plastischen Schmucke der Kirche fand ich
…
geflochtene Bänder, wie sie zu allen Zeiten in der
…
Stück in Eregli nicht photographieren; der zur Zeit
21
Bilde links Johannes der Täufer gegeben, geflügelt, fesselt; es mag zum älteren Bestände der Palaia
…
Zwischen diesem Bilde nun und der Seitenthür bilde der Ikonostasis sieht man, wie sehr dieses kost-
23
den Seitenrändern sind ebenfalls Theile verloren IC XClm^M~P 0Y > aber mit einem Zusätze, der
…
Paenula, welche auch den Kopf umschließt und der Panagia, welche, als Tafelmosaikcn
…
Die kleinen, der Hodigitria
…
vorn auf den bringen sind.
…
schmal, der auf dem Athos,
…
so auf den - sind stark zer-
…
sieht. Er ist Fig. 10 EregHi Georgskirche: Mosaik der Hodigitaia. hntanistO-57m
…
Nach orthodoxer Sitte hat man diese segnende sehr breit, der Mund sehr klein. Auf den Wangen
25
gesenkt. Maria hält ihn wieder im linken Arm und orans in der erzbischöflichen Kapelle in Ravenna
…
menstellung der athoni- F" f " geführt war, gesellen sich
…
TpixspcOix. 2. IV./.a-/-o- ,'• '^tttSItaKmHK t'w' Georgiou am Athos, auf
…
der dem Buche beige- ten zur Aufstellung an
…
selbe soll als Wunder ist. In der Datierung dieser
…
Von der ursprünglichen In der Georgskirche
…
beiden Händen vor sich. Fiff- " Eregli, Georgskirche: Architekturstiick mit Inschrift. ähnlich wie das auch auf
…
langgestrecktes Etwas zu erkennen. schließe diesen Aufsatz, indem ich auf eine Inschrift
27
im Zusammenhange mit dem Steine, auf dem sie
…
und quellenmäßigen Notizen über die Geschichte der
…
das Haupt der Heiligen verwahrt war. — Zum Metrum
…
der Mitte eine Palmette, an den Seiten je drei Epheu-
…
an. (Vgl. darüber meinen Aufsatz in der Byz. Zeit-
…
der Stein barg ihren Kopf. Darüber ein Aufsatz
…
wo mit Basilius Macedo jene Renaissance der by-
…
ren Baue in Herakleia, einer der hl. Glykeria ge-
Beiblatt / Mosaikinschriften aus Cilli
29
Wenige Schritte entfernt von dem Orte, wo im frei mit Ausnahme eines kleinen Theiles, auf welchem
…
\ \ Grundaushe- während . der Ausgrabungen gelegentlich in den
…
- bäudes in der theilung. Den Buchstabenformen nach dürften sie
…
streifen, der
…
hinzog, bloß- die Angabe der Flächenfuße, welche der Spender
…
(1) in der Mitle unmittelbar vor dem Bischofsitze (?)
…
vom Bischofsitze und der ersten Inschrift befand.
…
Mittelschiffe aufgefunden, deren Lage aus der beige- ^ÖS^SS^f^^^^
…
Erinnert sei noch, dass der unter dem Hofe des 0*78m Durchmesser eingeschrieben. Im ersten
…
der Mosaikboden an den erhaltenen Stellen durch O'l5™ breites Flechtband; die dasselbe abschließende
…
gewesen sein. Der Platz war nämlich in dieser Zeit mit je einer Taube und wahrscheinlich je einer ara
31
der Inschrift n. 6 scheint zwar die Buchstabenan-
…
Die Anordnung der einzelnen Zeilen der In- 0 0
…
6. "^^V Ausdehnung der Inschriftflächen belief sich bei den
…
vis] /{ecerunt) p(cdes) XL befindlichen Reste der zweiten Zeile lagen höher
…
c£\ Ursa den Mosaikboden eingetrieben. In der ersten Ver-
33
Der rechte Theil mit den vier Buchstabenresten
…
In der ersten Zeile war nach Optati kein A zu
…
A zu lesen, in Zeile 6 ist der Rest eines R sicher.
…
f[e)c\it) f(cdes) ■ XL in der Breite und etwas über 2-5m in der Länge,
…
so wenig erhalten gewesen, dass auch Y mög- Hegt in der Mitte des Mittelschiffes. Unmittelbar
35
Die zweite Inschrift befand sich auf einem I'l8m
…
bodens wurden die Steinchen herausgenommen und orte hierher versetzt worden sein. Der Brunnen war
…
wegen der hoch aufgeschütteten lockeren Erde das Auf diese Platte war der Sarkophag verkehrt gelegt;
…
Auf dem als Landspitze endenden Felsrücken,
…
und Inschriften gefunden worden. Der Felsrückcn
…
beiten auf seinem daselbst gelegenen Felde (Cataster-
…
im Laufe der folgenden Monate. Was dabei zu
…
der Hand des Herrn Professor A. Bezic in Spalato
…
überzogen. Der Boden des Gebäudes besteht aus
…
Die zweite Inschrift befand sich auf einem I'l8m
…
bodens wurden die Steinchen herausgenommen und orte hierher versetzt worden sein. Der Brunnen war
…
wegen der hoch aufgeschütteten lockeren Erde das Auf diese Platte war der Sarkophag verkehrt gelegt;
…
Auf dem als Landspitze endenden Felsrücken,
…
und Inschriften gefunden worden. Der Felsrückcn
…
beiten auf seinem daselbst gelegenen Felde (Cataster-
…
im Laufe der folgenden Monate. Was dabei zu
…
der Hand des Herrn Professor A. Bezic in Spalato
…
überzogen. Der Boden des Gebäudes besteht aus
Beiblatt / Römische Cisterne in Salona
37
sind. Es ist hydraulischer Mörtel, wie an der diocle- kleinerer Pfeiler von o-4m .Seitenlänge, während
…
Fig. 13 Längsdurchschnitt der Cisterne.
…
Innerhalb der Grundmauern sind in regelmäßigen
…
dicken Schichte Cement ausgedichtet, der auch alle
39
in der Wölbung, worauf einige runde Cementstücke den Gewandzipfel. In der Mitte steht Neptun, be-
…
Als Ausfiuss diente ohne Zweifel ein Canal, in jugendlicher Gestalt Vulcan mit dem Pileus, in der
…
mit vielen schleift der
…
geln, von de- jraäp' \ was man auf
…
ma[ni, Ev~]a- vorläge, der
41
eine Darstellung der vier Elemente vermuthen, so
…
(Wiederholt aus dem Anzeiger der pllilos.-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 1897
…
und Unterricht zur Unterstützung der von Österreichern
…
dank der ebenso wohlwollenden als wirksamen
…
die Zahl der unveröffentlichten Stücke, die das
…
Sammelwerk der Berliner Akademie bucht, hat der
…
warten reich ist der Gewinn, den auch nach Kirch-
…
durch die Weite der Aufgabe, so war diese Wahl
…
Aufgabe und der Ergänzung und Berichtigung der
…
schen Berichtes und der folgenden archäologischen ertheilte
…
eine Darstellung der vier Elemente vermuthen, so
…
(Wiederholt aus dem Anzeiger der pllilos.-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 1897
…
und Unterricht zur Unterstützung der von Österreichern
…
dank der ebenso wohlwollenden als wirksamen
…
die Zahl der unveröffentlichten Stücke, die das
…
Sammelwerk der Berliner Akademie bucht, hat der
…
warten reich ist der Gewinn, den auch nach Kirch-
…
durch die Weite der Aufgabe, so war diese Wahl
…
Aufgabe und der Ergänzung und Berichtigung der
…
schen Berichtes und der folgenden archäologischen ertheilte
Beiblatt / Epigraphischer Bericht aus Griechenland
43
auf gleiche Weise, nicht aber y.a~oc TcX^iro; vorzu-
…
Zu dem Vertrage der Athener und Argeier CIA I 50
…
Gärtringen auf der Insel Siphnos abgeschriebener,
…
(Monatsberichte der Berliner Akademie 1855 S. 197),
…
Adlern in der Mitte. Die herrschende Ansicht über
…
Reihe von Urkunden, die der Gerichtsbarkeit des
…
der Urkunden demosthenischer Reden) lehren, ge-
45
Lesung der Stücke I 89, IV I p. 22, llöfl wird
…
der Akropolis gefunden, ein anderes noch unver-
…
phismen für einen Seher Namens Sthorys, der den
…
IV 2, 65 b (Vertrag der Athener mit Kersebleptes,
…
ich. in vollem Umfange herstellen zu können; der
…
örtere ich die |is-udi)-sais und |is-S7tr,'pacf y) der Weihe-
…
Von wichtigeren neuen Stücken aus der In-
…
Polyperchons veranlasst. Dank der liebenswürdigen
…
den, so der Hermokopidensteine und der Verzeich-
…
der preisgekrönten Aufführungen, Dichter und Schau-
47
richtigt. Eines der neuen Stücke gehört, an II 977 i
…
ist ein Stein, der einst in 10 Spalten sämmtliche
…
urkunde aus Eleusis, mit der sich übrigens, wie ich
…
der Winde entdeckten Brief der Kaiserin Plotina
…
raschender Weise bestätigt; in der auf Tenos ver-
…
der Satrapen über die Beziehungen zum Großkönige,
…
axoi/Yjäöv geschrieben, wie für die Zeit, aus der sie
…
worden ist. Sie trägt unter der Überschrift nicht
…
mals ergeben haben. Übrigens ist der Stein mittler-
49
auf dem erhöhten Rande der Platte steht, lautet nach
…
(ebenda S. 97), ist dieser ^suAv der erste Beamte
…
In dem ersten Worte der zweiten Zeile der
…
Art der Berichtigung begegnet in Handschriften,
…
darf ich auf meine Bemerkung, ebenfalls zu einer
…
Vitrinitsa im Gebiete der ozolischen Lokrer eine
…
hatten. Der Stein ist angeblich vor einigen Jahren
…
lieferung zufolge auf Geheiß des delphischen Orakels
…
Der Schrift nach, über deren Entwicklung in Lokris
…
nicht leicht verständliche Urkunde der ersten Hälfte
Beiblatt / Bericht über eine Reise in Bulgarien
51
(Bericht II der Balkancommission, wiederholt aus dem Anzeiger der philosophisch-historischen Classe der kaiserl. Akademie
…
Schatz namentlich inschriftlicher Denkmäler, der
…
Gebrüdern Skorpil wie von ihm selbst auf ausge-
…
Bedeutung irnd Mannigfaltigkeit der Objecte schon
…
der Namensliste der Ansiedler, insbesondere der
…
Hoffilier, der uns nachgereist war, fünf weitere Wochen
…
In Philippopel gewährten Ausbeute die mit der
…
der namentlichen Aufzählung der zahlreichen Stifter,
…
und die Sammlung der griechischen Metropolie aus-
…
docent Zlatarski aus Sofia im Auftrage der fürstlichen
…
sich wie überall auf den türkischen Friedhöfen; be-
…
jedem Sinne ragt unter ihnen ein in der Nähe von
…
dass hier Namen der bulgarischen Chane Krum und
…
Auf Anregung Bormanns soll jedoch das Monument
53
Thürmen und Thoren unter der Erddecke zu erkennen.
…
bis zur rumänischen Grenze. Auf dieser Route fanden
…
relief. Jenseits der Grenze, in Mangalia (Kallatis),
…
den neuerdings in der Nähe ausgegrabenen Resten
…
letzten Jahren aufgedeckten Tbeile der Civilstadt
…
Der Hauptzweck, den er dabei verfolgte und erreichte,
…
Burgas aus, stellenweise auf wohlerhaltenen Römer-
…
und für Mcsembria, das auf einer Küstenfahrt nach
…
("Wiederholt aus dem Anzeiger der philosophisch-historischen Classc der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
…
Studienbetricbe Antheil an der internationalen Erfor- setzen angezeigt erschien, eine Voruntersuchung aber
…
Thürmen und Thoren unter der Erddecke zu erkennen.
…
bis zur rumänischen Grenze. Auf dieser Route fanden
…
relief. Jenseits der Grenze, in Mangalia (Kallatis),
…
den neuerdings in der Nähe ausgegrabenen Resten
…
letzten Jahren aufgedeckten Tbeile der Civilstadt
…
Der Hauptzweck, den er dabei verfolgte und erreichte,
…
Burgas aus, stellenweise auf wohlerhaltenen Römer-
…
und für Mcsembria, das auf einer Küstenfahrt nach
…
("Wiederholt aus dem Anzeiger der philosophisch-historischen Classc der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
…
Studienbetricbe Antheil an der internationalen Erfor- setzen angezeigt erschien, eine Voruntersuchung aber
Beiblatt / Vorläufige Berichte über die Ausgrabungen in Ephesus
55
Die gewünschte Voruntersuchung kam im Früh- In der weiten Thalebene des Kaystros (Fig. 16),
…
maßen in der Umgebung
…
von der sich sonst kein Bau-
…
sale der Stadt hauptsächlich
…
' 113 4 i 7 9 10 U te. Wie rasch sich der Boden
…
P-ft f- • j / cfi. "ti 1 cv cr j. tl v x bat des Artemision, der nach
…
wiederholte, und für die Ausführung lieh mir Geheim- Spiegel der See erhoben ist, heute aber durchschnittlich
…
Nach den berühmten Grabungserfolgen in Pergamon Um acht bis neun Meter also hat sich der Thalgrund
…
reichischen Forschungen insbesondere von jeher erhöht. Dieses Wachsthum der Alluvion erklärt, dass
…
ihm, von der vorgesetzten Behörde in Berlin auf die ganze Stadt eine halbe Stunde im Thale weiter
57
der über das Rückgrat zweier Berge hinweg, in weitem,
…
die Verwaltung der Römer, unter der Epliesus die
…
Vegetationskruste überzogen, aus der Schilf wald-
…
ödete und wird der herrschenden Ineberluft halber
…
Uberlieferung dar, der in neuerer Zeit glücklicher-
…
der hellenistisch-römischen Stadt, und dritthalb Kilo-
…
Alexanders des Großen und der mittelalterlichen
…
mannes Wood, der sein in persönlicher Bravour
…
zu lichtendes Dunkel zurückgeblieben, der Wissen-
…
Heiligthums im Innern der Cella annahm, wo kein
…
des Altars und dort wie anderweit in der Nähe
…
britische Terrain anstößt. Auf diesen beiden Feldern
59
mit einer kritischen Durchprüfung der Wood'schen
…
ständlich, dass wir auf dem in beträchtlicher Aus-
…
l'flasterstelle findet sich in der Achse des Tempels
…
feldes bis auf 40m Entfernung vollkommen fehlte, so
…
nisse, die ich der angekündigten Abhandlung vor-
…
wir in der hellenistischen Stadt auf dem kurzweg
…
überall kam in der Tiefe Architektur aus mannig-
…
eines verheerenden Brandes, der sich mit Wahr-
…
zu fundamentieren. Der Untersuchung in hohem
…
ließ, da der Zufluss durch das schüttere Geröll sich
…
Humanns leistete mit der Truppe geschulter Arbeiter,
…
an der vornehmsten Stelle der Stadt auf einer Fund-
…
der den Hafenspiegel und damit das Grundwasser
61
Fortschreiten ermöglicht. Zwei Ruinen der Stadt in Anschaulichkeit kaum möglich ist, umsomehr als
…
Frau Louise verw. Humann sich gütig bemühte, ein ziehenden Quaibaues, den wir auf circa 40™ Länge
…
biegt, haben der zweistöcki-
…
besondere Interesse der Ar-
…
Gebäude in der Nähe als Wohnung für die Arbeiter sphärische Vertiefungen, die wir mit Sand genau aus-
…
wieder seine Mitwirkung, neben ihm trat der Architekt dem attischen Deigma am Piräushafen.
…
Hauptmann Anton Schindler von der k. u. k. Militär- Ruine, aus Reihen mächtiger Quaderpfeilcr mit auf-
63
römischer Zeit, von der "wir bisher drei Theile bloß-
…
durchbrochen werden, um auf den drei bis vier Meter
…
somit ein Theil der nachantiken Stadt im Grundrisse
…
von der Straße aus nicht in das Innere sehen konnte.
…
nach drei Seiten so weit vor, bis das Centrum der
…
Sculpturstücken auf und nahmen alles hier Gefundene
…
abgeschlossen ist, was noch auf geraume Zeit hin
…
der Sachverhalt dar — eine lange Colonnade, deren
…
schwierigen Baubefund auf. Der Saal ist rechteckig
…
bewiesen, von einer bei der gegebenen Spannweite
65
die Marmorherrlichkeit der Wände. An und über
…
Form wie Farbe ein ähnliches Luxusspiel der Aus-
…
dass erst ein sehr eingehendes Studium der unge-
…
sei. Von der Bauinschrift, die sich in colossalcn
…
Auch von den Broncestatuen, die längs der
…
Gymnasiarchen datiert. Nur gegen Westen in der
…
und der Schutt noch höher aufgeschichtet war, kamen
…
von edlen Formen dar. Der Kopf, die rechte Hand
…
der linken Hand lehren, dass sie mit gekrümmten
…
an dem schönen, geschmeidigeren Flusse der überaus
…
Ausgestaltung, während es sich an der Bronce in
67
Künstler der sogenannten zweiten attischen Schule
…
vorstellbar. Ich muss mich für jetzt auf diese kurze,
…
vollständig wiederherstellbaren Wandaedicula, auf
…
schienen uns auf augusteische, jedesfalls frührömische
…
dem berühmten Knaben mit der Gans zur Seite,
…
geformt, hat sich mit emporgeschlagenen Flügeln auf
…
schule, der die schönen Kentauren im Capitol ent-
…
etwa ein Drittel unter Lebensgröße, alle Seiten der
…
aus weißem Marmor, in der wir nach nackten Partien
…
in dem erwähnten mittelalterlichen Einbaue der Nord-
…
artigen Räuchergeräthes. Sein etwa auf anderthalb
69
bärtigen Herakles, der den Schleier der Ompllale,
…
steigen, ausstaffiert mit der Keule und dem Löwen-
…
und des kämpfend auf ihm knieenden Herakles, da
…
Erwerbungen, die mir der Kunsthandel des Orients
…
auf ein archaisches Idol stützte und den linken Fuß
…
An Inschriften sind uns im Laufe der beiden
…
Boden auf einer Quader des Thurmes eingegraben,
…
weislich der Stadtmauer des Königs Lysimachos an-
…
Julius Banko, gesehen worden; ich copierte sie auf
…
stellend; einen Catasterplan der Ortschaft Ajasoluk
…
Einleitungsarbeiten für eine geographische Karte der
…
talischer Baukunst. In der Veste Ajasoluk, unter den
…
einem von Arkaden umgebenen Vorhofe und der
71
orientalischen Institut der Universität Wien. Hier
…
Namen mit Unrecht, ist vielmehr auf Befehl Sultans
…
(AV iederholt aus dem Anzeiger der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in
…
und Privatbeiträgen, die wir der andauernden per-
…
Architekt der Assistent der k. k. Staatsgewerbeschule
…
Philipp Forchheimer von der technischen Hochschule
…
sie im Maßstabe I : 1200 den Lauf der antiken
…
Säugling unter der Hirschkuh darstellt. An der
…
Anhalt mit Wahrscheinlichkeit als Agora der frühen
73
vollkommenen Zusammenbruche alles Aufgellenden auf ein gleichmäßiges Niveau von 0'8—l'Om über
…
auf Wandverkleidungen
…
Fig. 18 Agora der frühen Kaiserzeit. aüfe. u gez. v V Hoefert von je zwei etwa halb
…
wohl erst beträchtlich, später durch die von Osten Nur der südwestliche Bi konnte bis jetzt genauer
…
wurden, welche schlecht construiert und nicht bis in der Fußboden im Innern um etwa 2™ gehoben und
75
Dieser Epoche entstammt die Gestalt, in der der
…
Hauptzugang bildete außer der erwähnten Nordthür
…
diesem Bauwerke das atrium thermarum der obigen
…
Ungefähr um diese Zeit wurde auch der Corridor
…
denen zwei auf uns gekommen sind:
…
Aus der Nordwestecke von B\ führt eine noch
…
Vor jedem der bisher aufgegrabenen vier Pfeiler
…
Eine zweite, bilingue (b) ist der Artemis, Kaiser
…
An Sculpturfunden zeigte sich das Innere der
…
der Nordfront von Bi lag aber in hohem Schutte
…
flotter Arbeit der ersten Kaiserzeit. Mindestens zwölf
77
zeichen einen Stern in der Öffnung eines Halbmondes
…
gegen den großen Hafen hin. Der hoch den Berg
…
ihn in drei Ränge, auf dem obersten Umgange lief
…
Aus technischen Gründen wurde von der Ebene
…
Hellenistischer Zeit entstammen der größte Theil
…
Wasserspeiern, sowie der Kern des Skenengebäudes,
…
vor Abschluss der ganzen Grabung ein sicheres
…
Gange öffnen, der in dieser Gestalt dem römischen
…
der Nemesis-Tyche, langgewandet, mit Polos auf dem
…
Kopfschmuck, einen schmalen Reif, auf dem kleine
79
An der Südparodos fand sich außer kleineren
…
graphischen Recognoscierung auf dem Panajir-dagh
…
über die Hauptniederung der Stadt und den großen
…
vermochte. Auf viereckigem, nach allen Seiten frei-
…
pteros, zwölf zierliche Säulen auf niedrigen Basen
…
im Capitell das an der Innenseite regelmäßig ge-
…
gestellt ist der obere Abschluss; wahrscheinlich lei-
…
Durchbildung der Einzelformen gestatten indessen,
…
scpulcraler Bedeutung aus, der Mangel eines zugäng-
…
bei der lückenhaften Überlieferung der Geschichte
…
an der Bergseite später Mauern an dasselbe heran.
81
Die Anlagen zur Wasserversorgung der Stadt
…
fasst haben, neben dem heute der Weg nach Azizieh
…
Wassermasse auf den Sattel südlich vom sogenannten
…
überwölbter, also aufstaubarer Wildbach an der
…
der — vom Bahnhofe durchbrochen — jedem Rei-
…
unterstützten die Annahme, dass der Aquäduct einen
…
auf der Burg vier gedeckte Cisternen erbaut und
…
Herrn Professor Emich an der technischen Hoch-
…
Olkitt, wie ihn Vitruv erwähnt, sein, der im Laufe
…
Auf einem Ausfluge nach dem vier Stunden
Beiblatt / Ein Denarfund in Dalmatien
83
sowie einigen Schmuck gehoben. Der Fund wurde nato zu vereinigen. Es sind folgende Typen vertreten:
…
nach dem 84 Denare auf ein Pfund Silber geschlagen man annehmen, dass die noch nicht wieder auf-
…
dürfte der kleine Schatz vergraben worden sein. Da Funde von Krusevo seltenere Sorten bloß aus der
…
Straßen und Höfen der Stadt. Was im Jahre 1869
…
hinter der Apsis des Domes deponiert, allwo auch
…
der Domkirche im Laufe der Zeit gebildet hatten,
…
scriptes, das der Priester P. M. Corbatto im Jahre 1862
…
sowie einigen Schmuck gehoben. Der Fund wurde nato zu vereinigen. Es sind folgende Typen vertreten:
…
nach dem 84 Denare auf ein Pfund Silber geschlagen man annehmen, dass die noch nicht wieder auf-
…
dürfte der kleine Schatz vergraben worden sein. Da Funde von Krusevo seltenere Sorten bloß aus der
…
Straßen und Höfen der Stadt. Was im Jahre 1869
…
hinter der Apsis des Domes deponiert, allwo auch
…
der Domkirche im Laufe der Zeit gebildet hatten,
…
scriptes, das der Priester P. M. Corbatto im Jahre 1862
Beiblatt / Inschriften in Grado, [1]
85
im folgenden nach der Reihenfolge des Corpus eine
…
Corb. n. 6. Pais n. 62. Noch am Hause n. 133 der
…
7. n. 899. Corb. n. 5. Pais n. 72. Noch über der
…
hoch, r8 m breit, unten gebrochen. In der Mitte eine
…
haar, in gegürteter Ärmeltunica und quer von der
…
fransten viereckigen Stück Zeug besteht, in der Rechten,
…
auf beiden Fahnen ^Qyj^ erkannt; die Schrift-
…
stehenden Buchstaben, zwischen denen nichts in der
…
jetzt hinter der Domkirche; unterer Theil einer Grab-
87
wurden die Apices auf O und zweitem A in Z. I,
…
gleichlautend wiederholt n. 27 mit der Bemerkung
…
20. n. 1428. Corb. n. 7 mit der Angabe: ,incassata
…
Grabschrift mit der in Aquileja häufigen Wendung
…
platte, auf der die von Früheren beschriebenen eingra-
…
Stelle der Archäologisch-epigraphischen Mittheilungen aus Österreich-Ungarn,
Beiblatt / Weihung einer koischen Schiffsmannschaft in Samothrake?
89
Die schöne und wertvolle Stele der Koer, die als ein Weihgeschenk. Und dieses wohl kaum auf
…
ihrer Bedeutung, namentlich für das Seewesen der auswärtiges, anerkanntes Heiligthum, das vor allem
…
Jahrhundert setzen möchte; aber wie sich anderwärts richtig erklärt von O.Kern. Auf der Rückseite steht
…
vorstellte, und dass zum wenigsten die Zeit der Facsimile zeigt, mehrfach weiter.4) Wir lesen da
…
Zunächst freilich gehört die Urkunde der Stadt [|isTa — — — — — — trüpocT]T)"fo5 ccvö-UTtäxou
…
Nominativ der Stab und die Besatzungsmannschaft. Xou Tep£[v]ttou Aü[X]ou uEoö Oödpptovoc;
…
1) Toepffer, Beiträge zur griechischen Alterthumswissen- Air7]Va£ü)V u. s. w. hinzugefügt haben; in der Heimat ver-
91
fallen zu lassen; zum Genetiv tstpripscog, nach der
…
wird, diese Behörde inmitten all der Kriegsleute
…
der Ergänzung des samothrakischen Steines ver-
…
gänzt. Es versteht sich für den, der gelernt hat,
…
gleicher Zeit auf verschiedenem Wege erreicht wird.
…
7) Die äußere Möglichkeit der Verschleppung- ist unnöthig
…
für Diels 1895, 105 Anm. 2, hingewiesen; natürlich konnte der
…
Koer; dafür spricht der sicher ergänzte Name des
…
deln. Der wichtigste von allen ist der Führer der
…
losen Rhodier kennen, der zu fünf hochgestellten
…
Tage ihrer Auffindung bis auf das Jahr genau zu
…
Mommscn u) Sulla wegen der unzutreffenden Titulatur
…
von Hula und Szanto genau der gleiche Verstoß
…
Namens KGc[py.t[ASVV]]g, dessen Herstellung sich nur auf die
…
Auch der attische Name dürfte aus KapTtSaJ-lOg verlesen sein.
…
TCCCTGV cPüJ(laiu)V. Auf diese Inschrift macht mich jetzt auch
93
auf einen ,lapsi.s memoriae' zurückgeht, während die
…
selbst, auf die Brandis ja auf ganz anderem AVege
…
neue Urkunde von Bedeutung für die Geschichte der
…
der zweiten Conzeschen Expedition stattgefunden
…
der Künstler Epicharmos, Vater und Sohn, die keines-
…
Filialen auf Rhodos und der rhodischen Insel Kar-
…
So kehrt die Betrachtung immer wieder zu der
…
in erster Linie der entscheiden, dessen anregende
…
der des kyzikenischen doch wesentlich verschieden
…
zählung der für den Kriegszug fallweise eingesetzten,
Beiblatt / Zu kleinasiatischen Inschriften
97
Nach neuerlicher Prüfung der Abklatsche ergibt
…
dann KP etc., also in der That etwa E]T -ut[g |iVY]-
…
den Arch.-epigr. Mitth. gegebene Ergänzung der
…
Sie war mit verschieden geformten, bald vier-, bald Darunter fand sich, mit der Inschriftfläche nach unten
…
der gewachsene Fels anstand; die Straße war dem- CAWWTIABVITALFVX®| uxori\äWb{crHs)
…
der Porta Gemina und der Via Kandier sammt der
…
r8m, die hügelseitige 2-9™ Dicke besaß. In dieser Der Stein ist rÖ9m breit, 0-91m hoch, 0-23™
…
Nach neuerlicher Prüfung der Abklatsche ergibt
…
dann KP etc., also in der That etwa E]T -ut[g |iVY]-
…
den Arch.-epigr. Mitth. gegebene Ergänzung der
…
Sie war mit verschieden geformten, bald vier-, bald Darunter fand sich, mit der Inschriftfläche nach unten
…
der gewachsene Fels anstand; die Straße war dem- CAWWTIABVITALFVX®| uxori\äWb{crHs)
…
der Porta Gemina und der Via Kandier sammt der
…
r8m, die hügelseitige 2-9™ Dicke besaß. In dieser Der Stein ist rÖ9m breit, 0-91m hoch, 0-23™
Beiblatt / Alterthümer in Pola und Umgebung
99
Klammerlöcher, rückwärts an der rechten Schmal- formen stimmen zur Zeit des Septimius Severus. Vgl.
…
Dieser Umstand, sowie die Größe und Schwere der ) ^TTS if^tf^1 (T^\Üii(Z\ Procop[e]
…
arbeiten mag ein Theil des anstoßenden Friedhofes Am Schlüsse von Z. 2 hat der Steinmetz ein
…
Reste von Hausmauern und 24 Ziegelgräber zutage. 6. Vor dem Hauptportal der Marinekaserne und
…
denke ich nach Beendigung der Erdarbeiten im kommen seien. Ein ebendort gefundener Sarkophag
…
dünner Marmorplatten und profilierter Marmorleisten. An der Spitze der Bucht von Veruda in un-
…
„eine marmorne Säulentrommel von etwa l'Om Durch- gemauerte Gräber auf. Letztere sollen nur Knochen
…
der sich auf einem jener Plattenfragmente fand:
…
\ 3 Die Inschrift dürfte C. Fu[lvio Pt]au- Vorschein. Eines der letzteren misst in seinem auf-
101
in der Breite; es ist aus blaugrauen Marmorwürfel- links hingegen unvollständig; sie besaß ursprünglich
…
fen umrandet und mit unregelmäßig gestellten und ist der Stein ausgebrochen. Das V der früheren
…
ebenfalls schwarz, besitzt eine Bordüre von abwech- wenn mich der Abklatsch nicht täuscht, T. — Z. 6
…
Lavarigo. Auf dem Hügel Vesazze (Gradina) bei Altura
…
graben. Die rechte und die linke Schmalseite sind welche von der Altura-Seite her zum Hügel hinan-
…
Der Stein ist in der Kapelle Die Funde sollen durch Geschenk in das Museum
…
S Ag. HEY^gj' links von Mörtel bedeckt. Als ich Kreta erwarb der k. u. k. Fregatten-Capitän M.
…
g vacat vielleicht auch oben vollständig, er in Polykarpo in dessen Villa aufgestellt ist. Der
103
mit Dübellöcfiern versehen. In der Breite misst er ten veröffentlichte B. Haussoullier, bull, de corresp.
…
Tiefe bei A 0-5 m, bei B, wo die Inschriftfläche um Originalen auf einer Reise durch Kreta genommen
…
und 1864 unter den Ruinen der kretischen Stadt fachen Interesses halber die folgende Wiederholung
105
A steht auf dem Blocke linker-, B rechterhand.
…
Der Bedeutung, die Perinth im Alterthum und
…
ist, ein Verdienst erworben. Auf meinen thrakischen
…
losen Skizzen mit. Bei der Umzeichnung einiger
…
die der Director des kais. russischen archäologischen
…
Der Schwulst dieser ungelenken Verse verwehrt
…
Demzufolge kann sich |iot Z .5 wohl nur auf die Ver-
…
A steht auf dem Blocke linker-, B rechterhand.
…
Der Bedeutung, die Perinth im Alterthum und
…
ist, ein Verdienst erworben. Auf meinen thrakischen
…
losen Skizzen mit. Bei der Umzeichnung einiger
…
die der Director des kais. russischen archäologischen
…
Der Schwulst dieser ungelenken Verse verwehrt
…
Demzufolge kann sich |iot Z .5 wohl nur auf die Ver-
Beiblatt / Antiken zu Perinth
107
einer unedierten Grabschrift aus Xanthos; Z.yff. ist der als Buße angedrohten fünf Silberpfunde, eine gewichts-
…
Zwickeln; in der Mitte des vertief-
…
der stärker vertieften oberen Hälfte
…
der Mitte rechts eine Grabstele' (?),
109
Profil ist glatt weggearbeitet, der Stein dient jetzt
…
die mit der bloßen Zahlangabe, ohne Cognomen, in Xd5t 2ü)£oii,evoü y.ai
…
haben, der dem unterirdischen Hyporykton aufge- Ttapopögal XI TO0 xdcfou,
…
tief, Buchstaben 0-025™ hoch; oben und unten ein- Der Name des Grabherrn mit dem Verbum
111
7. Marmorstele O'ßö111 breit, 0'68m hoch, 0'095m Arch.-epigr. Mitth. VIII 223 n. 56, der noch in Z. 2
…
schrieben war, ist zweifelhaft; zu der Analogie-
…
xs, ScooEi xvj tcoXei Inschrift so eng mit der antiken Tradition zusammen,
…
staben 0'025m hoch, im Fußboden vermauert; Schrift bitschek bemerkt, die hergebrachte Festsetzung der
113
allerdings schon auf eine enorme Entwertung des brochen; J. H. Mordtmann Arch.-epigr. Mitth. VIII
…
Diese Grabschrift ist nach der christlichen Schluss-
…
yjg Ixxyjg xaxsax- u(fo)>5 TO5 &(eo)0. In Z. 4 ist der ursprünglich ausge-
115
X\irpsi sxsp- Ledergürtel herab, der so befestigt ist, dass seine
…
Stoast TCpsa- zurückgebogen und eingeknöpft sind; der linke Arm
…
Unter $s.ot.o-.'.v.öv ist natürlich der Fiscus zu ver-
…
Das Gentile Agidius, das auf Agis zurückzu-
…
16. Marmorstele (Fig. 27) in vier —=^ niana führt auf die Zeit Caracallas.
117
0"4m hohen Felde ist als Relief der Oberkörper
…
hält, der sicher keine Rolle in Schrägansicht ist;
…
Schwert von einem Gürtel herab, der linke Arm hält Verwendung, indem der größte Theil der Fläche
…
Metallplättchen mit einem Knopfaufsatz, der den de sclwl\a secunda sc\utarior(iim).
119
der Steinmetz schon in der letzten Textzeile zu einer römischen / -'^^^^^^^^^k h^S^M
…
scutariorum, in nachconstantinische Zeit, der auch kleiner gebildeten / 3%jL^ I ^SsaJBjlilf
…
die Stelle der Prätorianer getreten zu sein Der in anderthalb- ^^yy,. fjlß/'^^S^^^^^^.
…
nach rechts gewendet; cula; Sagum, auf rechter Schulter durch Fibel fest-
…
len Locken auf die Schuh bekleidetes linkes Bein einer sonst ganz
…
Fig. 31 Dionysostorso zu Perinth. eine Schale oder der, Unterschenkel fehlen. Rechtes
…
arm, beide Beine von der Mitte der Oberschenkel umgeschlungen ist, ferner der gurt-
121
motiv. Über der linken Guirlande, von der etwa die
…
Piombo der legio XI Claudia p. f. aus Gardun.
…
der legio XI, zum Vorschein kommende Denkmal
…
Stärke. Auf dem Avers stehtin erhabenen, o'007mhohen
…
]) Der für diesen Ort übliche antike Name Delminium
…
solche Controlesiegel in verschiedenen Zweigen der
…
schließen, dass eine Vexillation der XI. Legion in
…
wesenheit der Eilfcr im Prätorium der legio VII:
…
motiv. Über der linken Guirlande, von der etwa die
…
Piombo der legio XI Claudia p. f. aus Gardun.
…
der legio XI, zum Vorschein kommende Denkmal
…
Stärke. Auf dem Avers stehtin erhabenen, o'007mhohen
…
]) Der für diesen Ort übliche antike Name Delminium
…
solche Controlesiegel in verschiedenen Zweigen der
…
schließen, dass eine Vexillation der XI. Legion in
…
wesenheit der Eilfcr im Prätorium der legio VII:
Beiblatt / Piombo der legio XI Claudia p. f. aus Gardun
123
nordöstlich von Gardun); daselbst von Hirschfcld auf
…
ist, wie mir auf Befragen Director Bulic bestätigt,
…
drei Buchstaben, auf die sicher noch mehreres folgte,
…
messer; auf der einen
…
dass ein Detachement der Legion in Gardun stationiert
…
man, da in den beiden Inschriften und auf der
…
Doch ist es auch möglich, dass Abtheilungen der
…
Der Grund dieser
…
Detachement der Le-
…
Vexillationen der bei-
…
3) In dem von Bulic llull. XX S. 131 wiedergenannt. Auch er wird der XI. Logion angehört haben,
Beiblatt / Inschriften in Grado, [2]
127
anche im tumulo, fatto con pietre cotte, in cui deve streifen, der auf der Vorderseite durch den Rahmen
…
che le donne adoperano nell'acconciatura del loro Seiten der Inschrift je ein stehender nackter Erot
…
abito di seta (alcune fila unite cioe per parlar esatta- Basen und unverzierten Kelchcapitellen, auf die ein
…
eziandio la vera od annello che in dito doveva avere... in symmetrischer Haltung auf der einen Schulter ein
…
Escavando i Sarcofaghi in discorso si trovö anche in der freien Hand eine Weintraube mit einem Zweig,
…
auf dem Platze vor dem linken Seitenschiffe des Domes. sib^i) et Pclroniae Aiigcni c'oniugi incomp(arabili),
…
hoch, 2'26m lang, viim tief, bis auf den theil- ist die Ligatur unvollständig. Die Buchstaben sind
…
den Reliefs vollkommen erhalten; die rückwärtige jederscits ein schlangenhaariges Medusenhaupt, auf
129
Ecken des Sarges stehen auf einer Boden-
…
Pfeilern sind auf der Rückseite und den
…
wärts sphärischen Eckakroterien, auf denen
…
Fehlhiebe beim Einmeißeln der Inschrift
…
und schriftlos; sein Deckel unterscheidet sich von den Spur eines Pilaslers. Der Erot rechts hält eine bren-
…
kommendes Motiv, das sich u. a. auf
…
auf drei Seiten sculpiert, rückwärts und
…
sib(i)ct |[.....iaeAmpYmte \ {coniu~]gi\[_picntis~]simae. schmückt waren. Am Schaft der Stele: £>(«) M(ani-
131
An der Vorderseile des Aufsatzes, doch abwärts Der im CIL mitgetheilten Abschrift fehlen die
…
der Brust, die erhobene Rechte hat einen aus dem Hause n. 144 für das Museum erworben. Vergl.
…
Kopf und Brust sind abgesplittert, das Auge aber mit je zwei, in der letzten Zeile, mit je einem Buch-
…
I 310), in der Ganymedes den Hals des entführenden
…
bloß „das anmuthige Spiel der sorglosen Jugend"
…
1812 in Grado, früher im Besitze der Familie Marocco, r~ \
…
ist an der Außenwand der Küche im neuen Gebäude
133
34- Das Bruchstück bei Gregorutti n. 225 das Museum erworben. Der Eckcippus aus Kalkstein
…
Hause n. 29 für das Museum erworben, veröffent- Buchstaben sind o-03m hoch und von der zweiten
…
38. n. 1187 ist nunmehr verschollen. Aus Corbatto, der, wie bemerkt, auch Inschriften
…
mal mit der fast übereinstimmenden Angabe ,in
…
del Duomo'. Leider ist diese Inschrift bei der ( E /V 0 A A <E K £. f T £
…
lichte Inschrift Wurde bei der Renovierung des Hauses \ » ■ r / \ »',1-« ./..,_r
…
letzte Wort wohl den Monatsnamen im Genitiv gab.
…
der Kirche, angeblich gefunden bei Wiederherstellung
137
mit o'im hoben Buchstaben, jetzt im Hofe der 57. Bruchstück einer Kalksteinplatte, 0'l3m hoch,
…
der mater dolorosa im Baptisterium. Schöne, 0*045m Hause n. 298, für das Museum 1897 erworben,
…
Kalkstein, auf einem Steinhaufen hinter der Kirche,
…
als Stufe im Geschäfte der Brüder Marchesini, jetzt
…
Brunneneinfassung bei der "Werfte des Romano
…
in der Vorhalle des Hauses n. 100, 0'35m hoch,
…
früher als Pflaster bei der „Piazza Patriarcato" vor
…
PAI lassung in das provisorische Museum hinter der
Beiblatt / Archäologische Miscellen
139
findliche Gemme mit der Bemerkung ,Mercure et
…
Mantel, dessen Ende sie im Schöße mit der Linken
…
geflochtene Ciste, auf der sie sitzt, den Ährenkranz
…
Wieseler II 30, 329). Hier hält Hermes der auf
…
— die Literatur bei Wiescler, Denkmäler der alten
…
barkeit zu verstehen und eine Variante der näm-
…
sierte Ernte, zurück erhält, wie auf dem Neapeler
…
jenigen nicht in Abrede stellen, welche sich der be-
…
Jeder Besucher des Palazzo Pitti, der die herr-
…
sitzt, die Feder in der Hand, Philipp Rubens.
…
mit triftigeren Gründen Johannes Woverius, der
141
gleich manchem Werke aus der Frühzeit des Meisters
…
auf Winckelmann unangefochten als Bildnis Senecas
…
erklärt? Der Beschauer mag sich immerhin in diesem
…
2) Burckhardt, Der Cicerone II 896 der 7. Auflage.
…
5) In der Vorrede zu den von Lipsius edierten Werken
…
benden Seneca, den ,pccheur africain' aus der Samm-
…
Dichter der Diadochenzeit in ihr erkennen, so
…
wänglcr, Sammlung Somzee Tafel XXVI, und der dort ange-
…
Florenz in der Hausflur der Casa Buonarotti über der Ein-
143
neuerdings Furtwängler auf Hipponax,15) Arndt gar
…
stimmt zu sein. „Es sei nicht der natürliche Verfall
…
Leidenschaften durchwühlt. Der Ausdruck sei der
…
Hässlichkeit noch verwahrlost, weil Rücksicht auf
…
anführen, dass die gelehrten Grammatiker der ale-
…
einem Komiker, wie Diphilos, auf die Bühne ge-
…
Es ist schwer einzusehen, was einen Künstler der
…
Zu der von W. Klein, Praxiteles S. III ge-
…
von der Gruppe des Silen mit dem Dionysoskinde
Beiblatt / Die Anfänge der Provinz Moesien
145
Die Anfänge der Provinz.Moesien.
…
daher von der Ethnographie der Landschaft im
…
und A. v. Domaszewski, Die Entwicklung der Provinz
…
schiebungen in der moesischen Bevölkerung, welche
147
entsprechen sich die Landschaft Dardania der ersten
…
Dem Wege der römischen Occupation folgend,
…
In der Organisation Diocletians bildete die Dardania
…
Gebiet der Scordisci an, welche gegen Westen über
…
Skordisker fast ganz aus Moesien und zogen sich auf
…
IV 54, 68, nach der einleuchtenden Herstellung von
…
Flaviern) nichts Bestimmtes sagen. In der Eintheilung
…
der Dardania erstreckt sich längs der Donau das Gebiet
…
Orientierung deutet auf Benützung der Karte des
…
Cassius Dio, der an dieser Stelle nach seiner
…
der Moeser und der Triballer an:
149
Ptolemaeus verlegt die Moeser — ein Name, der
…
auch die Darstellung der Ereignisse des J. 725^9
…
übrigens, wie unten gezeigt wird, zur Landschaft der
…
lichen Sitze der Moeser in der Kaiserzeit nach
…
und großen dürfte das Territorium der civitates Moesiae
…
403 mit A. 2). Wie die ursprünglich auf ein be-
…
liche Nachbarn der Moeser die Geten und eine Reihe
151
im Westen der späteren Provinz) xs v.oti Tizca racoav
…
Nach zahlreichen Stellen der ovidischen Tristien
…
an der Grenze zwischen Untermoesien und Thrakien
…
Stammesangehörige der eigentlichen Moesi, wie
…
wähnten Masseneinwanderungen der Geten völlig
…
umsomehr in der Kaiserzeit, wo ihre Landschaft, mit
…
führt als Nachbarn der Moesi ausdrücklich nur die
…
mit der von Augustus festgestellten Westgrenze des
…
sind sämmtlich aus Legions- und Auxilienlagern der
…
diesseits der Donau gelegenen Theil der Provinz
…
Zweig der Bastarner getischer Herrschaft unter-
…
der Feste KvoöxXa aufbewahrt, welche damals dem
…
scheinlich nächst der von Bastarnern besiedelten
153
gewöhnlichen Einbruchstelle der Barbaren, am steil
…
Ursprunges und Hauptfestung der Thraker (vgl. IV
…
Moesien zur Zeit der römischen Occupation in zwei
…
hundertes wenigstens rechtlich einen Theil der
…
II. Die römische Landschaft an der unteren
…
von der früheren Zeit des Augustus. M. Licinius
…
n. 126; Gardthausen, Augustus II 211, 35), der im
…
kaiserlichen Mandatars, d. i. nach der später geläu-
…
gehender erörtern werde, ist in der Zeit der Trium-
…
Bei der Theilung der Provinzen im J. 727/27
…
hauptung Dios LIII 12, 2, der Senat habe damals
…
in der Eigenschaft von Proconsuln der .Senatsprovinz
155
(Mangalia) an der damals mit Macedonien verwalte-
…
Ü7ia-a~'°S charakterisiert, obgleich es der oben er-
…
scheinlich im Nordosten der Provinz; man könnte
…
Annalen der Zeit nach 727/27, wie wir noch sehen
…
gewissermaßen der Vorgänger des moesischen Legaten
…
späteren Kriege der Römer in den nördlichen Balkan-
…
Statthalterschaft wie der militärische Oberbefehl —
…
Die Geschichte der Kämpfe an der unteren
…
Der Erstgenannte ist sicher der bekannte M.
…
auch das TtpoTspov bei Dio, der an dieser Stelle, wie
157
Aodxio;, sondern der zweite Bestan^lfheil verderbt.
…
Wissowas RE I 491 n. 35\ der dann nach seinem
…
weist auf einen entfernteren Zeilpunkt. Es steht
…
auf dem diesseitigen Donauufer angesiedelt. Diese
…
rische Unternehmungen des Tiberius an der unteren
…
nämlichen Jahre in Raetien und an der Grenze Thra-
…
baren von jenseits der Donau. Unter den von
…
Tiberius muss nach der Fassung bei Vellerns und
159
Der Ansatz bei Eusebius unter 739/15 wird dem-
…
ßen können. In der sogenannten consolatio ad Liviam
…
V. 385. 386 weist hier auf den raetisch-vindeli-
…
Tiberius zurückgewiesenen Beutezuge der Daker
…
wegen der Worte ,huic hosti perbreve Pontus iter'
…
Fast parallel mit der großen und erfolgreichen
…
uevov) auf die Reise des Piso nach seiner Provinz
…
der Thraker nieder, an welchem sich vielleicht auch
161
jectur fällt auch die Annahme, dass Piso einer der
…
bezieht sich auf die zweite Seite seiner Doppelbe-
…
Die bisherigen Kämpfe an der unteren Donau
…
die Einfälle der Barbaren in Macedonien den Anstoß
…
auf pannoniscbem Boden errungen, endlich die Ruhe
…
unter der Herrschaft des Odrysenfürsten gemacht.
…
theidigung der Donaugrenze dem dortigen Proconsul
…
754/1, wo der Proconsul von Macedonien noch als
…
der Consular A. Caecina Severus (Prosopogr. I 256 f.
…
der Legionen, die im benachbarten Pannonien längst
…
Der Mittelpunkt des neuen Militärdistrictes, die
…
der Bedenken Mommsens, RG V 13, 1 (vgl. dagegen
163
mit einer Neueinführung der Zollorganisation Hadrians,
…
dem Gesichtspunkte der ersten Kaiserzeit erklären
…
weist auf eine frühere Zeit als die Hadrians. Eine
…
Rufius Festus breviar. 8, die Aufzählung der militäri-
…
standen also außer der erst kürzlich besetzten Dar-
…
der Pontus Euxinus, wie man sonst entsprechend
…
wurde, hat Illyricum, dessen Begriff der von Augustus
…
p. 564, Q8, wonach das Territorium der 2£[p]8[(fl]v
…
Maroboduus mit Bezug auf die Ereignisse des Jahres
…
welche Tiberius bei Carnuntum an der Donau ge-
165
die Legionen von der unteren Donau sich befanden,
…
also fünf auf dieses Heer kommen, so zählte das
…
was auf diesem Umwege wahlscheinlich gemacht
…
bis auf Domitian im Westen des späteren Moesiens
…
scheinlich bei Naissus (Nig), dem Hauptorte der
…
districte bis auf die Zeit des pannonischen Aufstandes
…
Legionen der Dardania und die thrakischen Hilfs-
…
neuerdings Einfälle der Daker und Sarmaten
…
Augustus ein weiterer. Fortschritt in der Sicherung
…
Das Datum für die Anlage der praesidia hängt
…
Kämpfe an der unteren Donau erwähnt. Dagegen
167
ins Innere Dakiens, vielleicht sogar mit der Absicht
…
ä-apavuog), der sie mit Hilfe der thrakischen Truppen
…
auf moesischem Boden geführte Krieg nach Dios Be-
…
zu setzen. Auf diese Zeit weisen auch die "Worte
…
TOtg 'Pojiiafccs. Allem Anscheine nach ist es der
…
motione patuerunt. Auf Episoden desselben Krieges
…
gewesen. AVahrscheinlich wurde der Feldzug jedoch
…
nismus, wenn sich dies wirklich nur auf die alsbald
…
passen. Vielleicht ist er der unmittelbare Nachfolger
…
III 51 n. 373). Der Fundort des Steines am rechten Ufer des
169
Die Errichtung der römischen praesidia, über
…
Für die größeren Ufercastelle an der unteren Donau
…
Wien 1890, 22 f.: ,Bei Galaz auf der Strecke zwischen den
…
mit den hiberna der Legionen in der Dardania wurde
…
der gleichzeitig eine delegierte Jurisdiction in den
…
Donaulaufes der etwa gleichzeitige praefectus ripae
…
Iulium Carnicum aus der Zeit des K. Claudius CIL
…
im Februar. . . Der Stand des Eises dauerte also durchschnitt-
171
fügung der Treballia. Der Umfang beider wurde
…
vallicrung der Stellungen kaum denkbar ist. In dem
…
eine enger begrenzte Landschaft auf eine Zeit hin,
…
liegt zwischen dieser Stellung und der Praefectur im
…
ernennungen der Beamten in Rechnung zu ziehen;
…
anders Mommsen, RG V 13, 1). Noch der im J. 30
…
Sp. 158), wo der Ausdruck ,provincias' die Er-
…
Namen und Verhältnisse auf die ältere Zeit und
173
mit der Neugestaltung Illyricums und der Balkan-
…
XLV i ff.). Unter dem Oberstatthalter der vereinig-
…
Beweisführung ein Legat praetorischen Ranges, der
…
szewski S. 3 f. Die römische Landschaft an der
…
gebenen Beweise vor der Errichtung des Stand-
…
der darin erwähnten ,quinque decuriae' nicht vor
…
Moesien erst unter Tiberius unterworfen wurde, auf
…
der Provinz Moesien. Im allgemeinen äußert sich
…
9, 77 f. (vom J. 16 n. Chr., oben Sp. 156) die der
…
thiakische Getenland ganz der Moesia inferior ein-
175
der Moeser mitbegriffen; doch ist es bemerkenswert,
…
hunderts der Name Moesia gerade jener Landschaft
…
Die endgiltige Feststellung der Bezeichnung
…
aus der Dardania an die Donau ins eigentliche Moeser-
…
Jurisdiction und der militärische Befehl am Donau-
…
dem ersten, der nach der Vereinigung der Balkan-
…
Auch der Bericht des Tiberius an den Senat
…
der Lager im moesischen Stammlande sich befand:
…
15. Legion an die Donau kam, zunächst die eine der
…
iager am Strome entstanden, wahrscheinlich bei der
…
Aus dem Beinamen der legio IUI Scythica,
177
Mit der Ubersiedlung der Legionen an die Donau
…
in der Grabschrift des Ti. Plautius Silvanus CIL
…
der Kern der Grenzwehr an der unteren Donau in
…
tiaria, Oescus, also in der alten römischen Land-
…
war. Erst mit der Errichtung der Provinz Moesia
…
Moesien war bis auf Hadrian beinahe ganz auf das
…
hist. Cl. XCIX 437 ff.) Unter dem Schutze der Lager
…
vereinzelte griechische finden, geben von der Romani-
…
III. Das thrakische Gebiet an der unteren
…
er den Crassus sowohl nach der Schlacht am Ciabrus
…
Mündungsgebiete der Donau (LI 26, I ff.); sein
…
diese Zusammenkunft zu Korinth statt, wo der Caesar
…
So bestand seit der Expedition des Crassus im
…
er ihm einen Theil der den Bessern gehörigen-
179
um das J. 732/22 führte der Proconsul Macedoniens
…
wieder auf der Seite der Odrysen. In hartnäckigen
…
wurde. Der 743/11 zur Regierung gelangte Rhoeme-
…
unter Rhoemetalkes im Gefolge der Legionen des
…
Desgleichen noch später in der Schilderung, die Kaiser
…
Noch Strabo VII fr. 10 C. 329 (vgl. fr. 9), der
…
grenzt werden und nennt VII fr. 48 C. 331 in der
…
schaft der Odrysen nahezu in jenem Umfang wieder-
…
sehen werden, von der Herrschaft des thrakischen
…
in der allerdings aus heterogenen Quellen zusammen-
…
Nach der Chorographie des Mela wurde Thrakien
…
die Quartiere der römischen Legionen weit weg vom
181
beherbergte Aegisus nahe der Donaumündung, welches
…
Die Beihilfe der Römer, wahrscheinlich einer Legion
…
mufhlich, weil hier auf seinem eigenen Gebiete eben
…
unter Hinweis auf die Nachbarschaft Tomis' und des
…
die thrakische Herrschaft bis an die Sitze der Sky-
…
besser auf den in Kämpfen ergrauten Bundesgenossen der
…
Zweifel erhielt Rhoemetalkes, der Sohn des im J. 19
…
entsprechende Stück der ripa Thraciae. Nach der
…
hörige Stück der ripa Thracia in eine geordnete
…
augetreten hatte. Der Tod des Rhoemetalkes und die Theilung
183
gefallen war, führte seit diesem Jahre der Praetorier
…
(Mommsen, Eph. epigr. II p. 257). An der Erhe-
…
staates vorbereitet. Nach der kurzen Unterbrechung
…
zeigt die Übersicht der Reichstruppen im J. 66 bei
…
der Civilverwaltung einem kaiserlichen Procurator
…
der provincia Moesia. Nach CIL VI n. 3828 wurde
…
der Patronat der colonia Flavia Pacis Deultensium
…
der ersten Legaten von Thracia an, obgleich dieses
…
Moesia ansprechen dürfen, der im J. 82 die DeduCtion
…
erhielt. Wegen der eigenthümlichen Stellung, welche
…
welche damals unter dem Statthalter der Senatsprovinz
…
Korrespondonzblatt der Westd. Zeitschr. XVI
185
auf den militärischen Schutz des untermoesisclien
…
schen Reiches bildeten, sind auch nach der Errich-
…
Jahrhundertes wurde in der von Hadrian organisierten
…
CIL III n. 751 ; H. Kiepert, Lehrbuch der alten
…
Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan I2 185 ff.) als
…
Zeit des Commodus die Namen der Statthalter von
…
Vorgange annehmen, mit der Provinz Moesia inferior
…
zu Hotnica (Hodnitza) an der Rosica, einem Neben-
…
s. ö. vom Knie der Osma bei Bulgareni);
…
Eparchie und der ripa Thraciae überhaupt zur pro-
187
mit der alten Gemarkung des thrakischcn Clientel-
…
Strecke dürfte das in der Gegend von Novae (Svistov)
…
II p. 307, 23), das heutige Nikopoli an der Donau
…
ciae erwähnt, der anderwärts (CIL III n. 753 -
…
Auch die östliche Grenze der provincia Thracia
…
selbstredend .nicht auf die kleine Landschaft der
…
schaften längs der ripa Thraciae gewiss mit Recht
…
Der scheinbare Widerspruch der unter B und C'
…
ein District der provincia Thracia gewesen. Rechtlich
…
Auf das ganze Gebiet, welches ehemals dem thraki-
…
Legaten von Moesia inferior gehemmt wird. In der
189
Praxis wurde gewiss sehr bald, wie in der Gallia
…
Dingen sich übrigens, gleich der des obergermanischen
…
umgangen wurde, im Rechtssinne dennoch der Ab-
…
Provinzstatthalter oder auf dessen Befehl, sondern
…
kommt daher in der Inschrift nicht zum Ausdrucke.
…
181 n. 28 unter Gordian) erscheint der Name des
…
zeichnet. Auch auf der Inschrift des illyrischen
…
(oder Vettius) Iuvenis aus der ersten Hälfte des
…
auf eine spätere Statthalterschaft desselben Mannes
…
hat sie nur die Uferlandschaft an der Donau er-
…
vor nur in der alten moesischen Landschaft statio-
191
lager gegründet, eines für die V Macedonica bei der
…
fortan der Amtssitz des sacerdos provinciae für
…
der reichen städtischen Entfaltung des moesischen
…
Haemus, der auch am längsten unter dem Legaten
…
I vermuthet, die Bundesgenossen der Römer an der
…
gleich mit den Bastarnern unter die Herrschaft der
…
die Einbeziehung der griechischen Küstenstädte in
…
getreten zu sein. In der dimensuratio provinciarum
…
III 239). Noch um das J. 754/1 ehrte der Demos
…
weilte. Der Umstand, dass Ovid dort interniert (rele-
193
Ovid spricht dies ausdrücklich in der Elegie an
…
Auf seiner Landreise von Tempyra nach Tomis um
…
dessen Provinz der Küstenstreifen am Pontus auch
…
lösen, als sich um die Regelung der dortigen Ver-
…
(oben Sp. 177), im Mündungsgebiete der Donau über-
…
Bei unvorhergesehenem Herannahen der Feinde werden
…
Die Reorganisation der Balkanländer zu Beginn
…
Legaten von Moesien, der dem Statthalter des
…
Zur Vertretung dieses Statthalters, der im westlichen
…
den Pontus entsandt, der aber jedesfalls mit dem
195
besten der Umstand, dass Ovid mit Ausnahme eines
…
diesen Gegenstand variieren. Auf die Rückkehr
…
Kenntnis Tomi's und der Nachbargebiete, Jahns
…
Geburtstage des divus Augustus, bei welchen der
…
thrakischen Reiches im J. 46, haben an der Ver-
…
szewski, Rhein. Mus. NF XLVII 209 ff.). Seit der
…
Bestandtheil der neuen Provinz, deren Legaten sie
…
einem eigenen Kaisercultus, dem der novTdpx?); vor-
…
besten der Umstand, dass Ovid mit Ausnahme eines
…
diesen Gegenstand variieren. Auf die Rückkehr
…
Kenntnis Tomi's und der Nachbargebiete, Jahns
…
Geburtstage des divus Augustus, bei welchen der
…
thrakischen Reiches im J. 46, haben an der Ver-
…
szewski, Rhein. Mus. NF XLVII 209 ff.). Seit der
…
Bestandtheil der neuen Provinz, deren Legaten sie
…
einem eigenen Kaisercultus, dem der novTdpx?); vor-
Beiblatt / Zur Bronzeinschrift von Olympia
197
äSrjXoj, äy.upöco von äy.upo;, in der Bedeutung ,un-
…
auf der Bronze nicht äSsXTttihaie oder, mit einem
…
daruntergesetzt ward? Ungerne wird man der so
…
nur noch für TOip stz äaiaxa auf töv STtav/ioTOV in
…
Friedrich Marx auf einer Bronzemünze des British
…
Mittheilung) ein drittes des Wiener Cabinets, auf dem
…
schen Alterthums an der Wiener Hochschule ge-
…
Vorliebe von Jugend auf forschend zugethan war. Ge-
…
sich als Conservator der Centralcommission für Kunst-
…
eine Zierde der Stadt bildet.
…
äSrjXoj, äy.upöco von äy.upo;, in der Bedeutung ,un-
…
auf der Bronze nicht äSsXTttihaie oder, mit einem
…
daruntergesetzt ward? Ungerne wird man der so
…
nur noch für TOip stz äaiaxa auf töv STtav/ioTOV in
…
Friedrich Marx auf einer Bronzemünze des British
…
Mittheilung) ein drittes des Wiener Cabinets, auf dem
…
schen Alterthums an der Wiener Hochschule ge-
…
Vorliebe von Jugend auf forschend zugethan war. Ge-
…
sich als Conservator der Centralcommission für Kunst-
…
eine Zierde der Stadt bildet.
Tafel I - VII
n
Im Auftrage der kleinasiatischen Commission der kaiserlichen Akademie der \\ lssenschaften
…
Mit 75 Abbildungen im Texte. (Heft XII der Abhandlungen des archäologisch-epigraphischen Seminars der
o
K. SCHENKL Der Georgos des Menandros.............. 49
…
F. WICKHOFF Der zeitliche Wandel in Goethes Verhältnis zur Antike
r
classische Philologie an der Universität in Wien. — Preis 7 M. >
…
I. Theil: Der demotische Theil der Inschrift von Rosette. — Der Sethon-Roman. s- Der Leidener Papyrus 1.384.
…
Die Grundgesetze der ursemitischen Poesie erschlossen und nachgewiesen in Bibel, Keilinschriften und Koran und in ihren
…
Zur Geschichte der mittellateinischen Dichtung.
…
Beitrag- zur Geschichte der karolingischen Gelehrsamkeit. — Preis i M. 80 Pf-
Umschlag
15
oberen Streifen hinaus bis in den obersten Randstreifen hinein erstrecken. Dieses
gewaltige Gehörn verstärkt den Eindruck des mächtigen Thieres wesentlich. Uber-
haupt merkt man überall, wie viel Mühe der Maler aufwandte, sein Bestes zu
leisten. Bekanntlich ist der Schwanz des Thieres dreimal verändert (die Spitzen
des ausgeführten Schweifes verlaufen hinter der Wade des Mannes), und die Vorder-
beine sind fünfmal umgestaltet (nicht viermal wie bei Gillieron: auch der linke
Vorderhuf war ursprünglich gestreckter gehalten). Aber auch die Nackenlinie ist
dreimal vorgezeichnet, bis der Hals genügend verengt und der als wünschens-
wert empfundene Knick in den Halswirbeln erreicht war.
Bei dem in Sprungstellung auf dem Stiere knienden Manne hat man bisher
zwar die Körperhaltung mehrfach besprochen, den Kopf jedoch unerörtert gelassen,
offenbar weil man ihn gradeaus nach links gerichtet glaubte. Das war jedoch
nicht der Fall. Allerdings ist von diesem Kopfe nicht viel erhalten. Ein größerer
und zwei kleine Flecken Deckfarbe zeigen nur, dass er wie der übrige Körper
weiß aufgetragen und die Haare sowohl als die Innenlinien des Gesichtes schwarz
oder gelb übergemalt waren. Von der äußeren Form ist jedoch in blauer Vor-
zeichnung der beiderseitige Halscontur, das Kinn, die Oberlippe und der Unter-
theil der Nase noch kenntlich. Der Kopf war also rückwärts nach rechts gedreht,
was schon aus der Wendung des Oberkörpers sicher zu erschließen wäre. Sonst ist
der Grund um den Kopf so verrieben, dass sich weiteres nicht feststellen lässt.
Gewiss ist nur noch, dass er barhäuptig war, weil über ihm bis zum Rand-
streifen die blaue Grundfarbe sichtbar ist, wie dies auch Gillieron richtig angibt.
Auch über die Technik des Bildes muss ich von Fabricius abweichen, der
1. c. S. 346 bemerkt: „Der Grund rings um die Figuren ist blau, und zwar ist
die blaue Farbe um den mit Weiß zuerst grundierten Stier herumgezogen, dessen
Contur sich von dem hier dicker aufgetragenen Blau deutlich abhebt. Während
also der Stier direct mit Weiß grundiert ist, hat der Maler die Figur des Mannes
auf den blauen Grund mit Deckweiß aufgetragen. An Stellen, wo das Deckweiß
abgesprungen ist, kommt der blaue Grund wieder zum Vorschein". Mir scheint
dagegen der Sachverhalt folgender: die vermuthlich unreine Kalkoberfläche wurde
zunächst durchaus hellgrau grundiert. Diese Grundierung kommt nicht nur in
großen Partien am Körper des Mannes zum Vorschein, wo das Weiß abgefallen
ist (s. Gillieron), sondern in kleinern Fleckchen auch am Stiere. Auf diesem Grund
sind mit pastoser blauer Farbe beide Figuren in den Umrissen ausgezeichnet;
diese Contur lässt sich auch an dem Manne verfolgen. Innerhalb der Vorzeich-
nung ist der Stierkörper mit dünner gelblichweißer Deckfarbe ausgefüllt. Eine
oberen Streifen hinaus bis in den obersten Randstreifen hinein erstrecken. Dieses
gewaltige Gehörn verstärkt den Eindruck des mächtigen Thieres wesentlich. Uber-
haupt merkt man überall, wie viel Mühe der Maler aufwandte, sein Bestes zu
leisten. Bekanntlich ist der Schwanz des Thieres dreimal verändert (die Spitzen
des ausgeführten Schweifes verlaufen hinter der Wade des Mannes), und die Vorder-
beine sind fünfmal umgestaltet (nicht viermal wie bei Gillieron: auch der linke
Vorderhuf war ursprünglich gestreckter gehalten). Aber auch die Nackenlinie ist
dreimal vorgezeichnet, bis der Hals genügend verengt und der als wünschens-
wert empfundene Knick in den Halswirbeln erreicht war.
Bei dem in Sprungstellung auf dem Stiere knienden Manne hat man bisher
zwar die Körperhaltung mehrfach besprochen, den Kopf jedoch unerörtert gelassen,
offenbar weil man ihn gradeaus nach links gerichtet glaubte. Das war jedoch
nicht der Fall. Allerdings ist von diesem Kopfe nicht viel erhalten. Ein größerer
und zwei kleine Flecken Deckfarbe zeigen nur, dass er wie der übrige Körper
weiß aufgetragen und die Haare sowohl als die Innenlinien des Gesichtes schwarz
oder gelb übergemalt waren. Von der äußeren Form ist jedoch in blauer Vor-
zeichnung der beiderseitige Halscontur, das Kinn, die Oberlippe und der Unter-
theil der Nase noch kenntlich. Der Kopf war also rückwärts nach rechts gedreht,
was schon aus der Wendung des Oberkörpers sicher zu erschließen wäre. Sonst ist
der Grund um den Kopf so verrieben, dass sich weiteres nicht feststellen lässt.
Gewiss ist nur noch, dass er barhäuptig war, weil über ihm bis zum Rand-
streifen die blaue Grundfarbe sichtbar ist, wie dies auch Gillieron richtig angibt.
Auch über die Technik des Bildes muss ich von Fabricius abweichen, der
1. c. S. 346 bemerkt: „Der Grund rings um die Figuren ist blau, und zwar ist
die blaue Farbe um den mit Weiß zuerst grundierten Stier herumgezogen, dessen
Contur sich von dem hier dicker aufgetragenen Blau deutlich abhebt. Während
also der Stier direct mit Weiß grundiert ist, hat der Maler die Figur des Mannes
auf den blauen Grund mit Deckweiß aufgetragen. An Stellen, wo das Deckweiß
abgesprungen ist, kommt der blaue Grund wieder zum Vorschein". Mir scheint
dagegen der Sachverhalt folgender: die vermuthlich unreine Kalkoberfläche wurde
zunächst durchaus hellgrau grundiert. Diese Grundierung kommt nicht nur in
großen Partien am Körper des Mannes zum Vorschein, wo das Weiß abgefallen
ist (s. Gillieron), sondern in kleinern Fleckchen auch am Stiere. Auf diesem Grund
sind mit pastoser blauer Farbe beide Figuren in den Umrissen ausgezeichnet;
diese Contur lässt sich auch an dem Manne verfolgen. Innerhalb der Vorzeich-
nung ist der Stierkörper mit dünner gelblichweißer Deckfarbe ausgefüllt. Eine