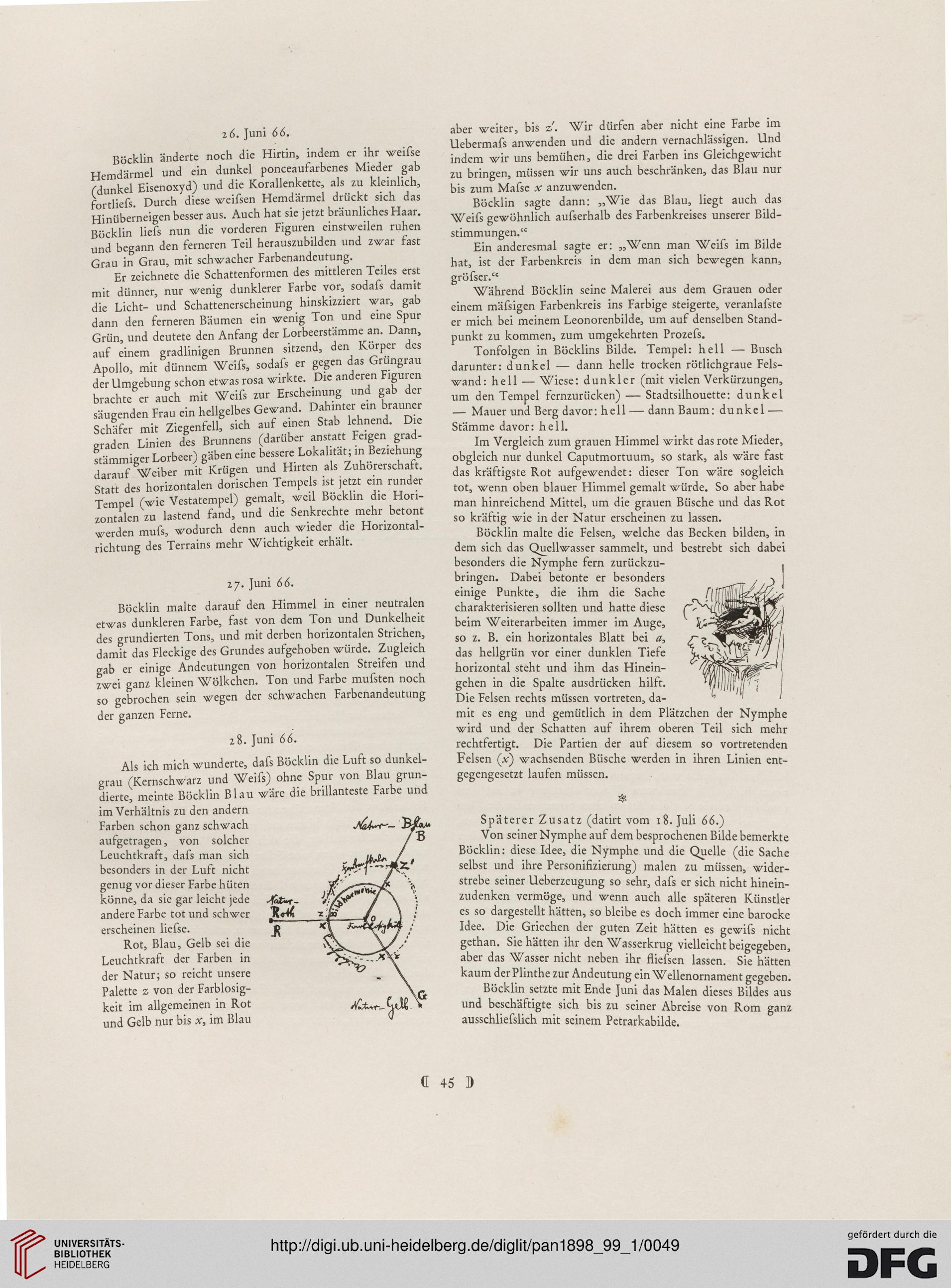z6. Juni 66.
Böcklin änderte noch die Hirtin, indem er ihr weiße
Hemdärmel und ein dunkel ponceaufarbenes Mieder gab
f dunkel Eisenoxyd) und die Korallenkette, als zu kleinlich,
fortließ Durch diese weißen Hemdärmel drückt sich das
Hinüberneigen besser aus. Auch hat sie jetzt bräunliches Haar.
Böcklin liefs nun die vorderen Figuren einstweilen ruhen
und begann den ferneren Teil herauszubilden und zwar fast
Grau in Grau, mit schwacher Farbenandeutung.
Er zeichnete die Schattenformen des mittleren Teiles erst
mit dünner, nur wenig dunklerer Farbe vor, sodafs damit
die Licht- und Schattenerscheinung hinskizziert war, gab
dann den ferneren Bäumen ein wenig Ton und eine Spur
Grün, und deutete den Anfang der Lorbeerstämme an. Dann,
auf einem gradlinigen Brunnen sitzend, den Körper des
Apollo, mit dünnem Weiß, sodafs er gegen das Grungrau
der Umgebung schon etwas rosa wirkte. Die anderen Figuren
brachte er auch mit Weiß zur Erscheinung und gab der
säugenden Frau ein hellgelbes Gewand. D^ "°^a™'
Schäfer mit Ziegenfell, sich auf einen Stab lehnend. Die
g aden Linien des Brunnens (darüber anstatt Feigen grad-
ftämmiger Lorbeer) gäben eine bessere Lokalität; in Beziehung
darauf Weiber mit Krügen und Hirten als Zuhörerschaft.
Statt des horizontalen dorischen Tempels ist jetzt ein runder
Tempel (wie Vestatempel) gemalt, weil Böcklin die Hori-
zontalen zu lastend fand, und die Senkrechte mehr betont
werden mufs, wodurch denn auch wieder die Horizontal-
richtung des Terrains mehr Wichtigkeit erhält.
27. Juni 66.
Böcklin malte darauf den Himmel in einer neutralen
etwas dunkleren Farbe, fast von dem Ton und Dunkelheit
des grundierten Tons, und mit derben horizontalen Strichen,
damit das Fleckige des Grundes aufgehoben würde. Zugleich
gab er einige Andeutungen von horizontalen Streifen und
zwei ganz kleinen Wölkchen. Ton und Farbe mußten noch
so gebrochen sein wegen der schwachen Farbenandeutung
der ganzen Ferne.
28. Juni 66.
Als ich mich wunderte, daß Böcklin die Luft so dunkel-
grau (Kernschwarz und Weiß) ohne Spur von Blau grun-
dierte, meinte Böcklin Blau wäre die brillanteste Farbe und
im Verhältnis zu den andern
Farben schon ganz schwach
aufgetragen, von solcher
Leuchtkraft, dafs man sich
besonders in der Luft nicht
genug vor dieser Farbe hüten
könne, da sie gar leicht jede
andere Farbe tot und schwer
erscheinen ließe.
Rot, Blau, Gelb sei die
Leuchtkraft der Farben in
der Natur; so reicht unsere
Palette z von der Farblosig-
keit im allgemeinen in Rot
und Gelb nur bis x, im Blau
Jfa4"<^- '4
aber weiter, bis z. Wir dürfen aber nicht eine Farbe im
Uebermaß anwenden und die andern vernachlässigen. Und
indem wir uns bemühen, die drei Farben ins Gleichgewicht
zu bringen, müssen wir uns auch beschränken, das Blau nur
bis zum Maße x anzuwenden.
Böcklin sagte dann: „Wie das Blau, liegt auch das
Weifs gewöhnlich außerhalb des Farbenkreises unserer Bild-
stimmungen."
Ein anderesmal sagte er: „Wenn man Weifs im Bilde
hat, ist der Farbenkreis in dem man sich bewegen kann,
größer."
Während Böcklin seine Malerei aus dem Grauen oder
einem mäßigen Farbenkreis ins Farbige steigerte, veranlaßte
er mich bei meinem Leonorenbilde, um auf denselben Stand-
punkt zu kommen, zum umgekehrten Prozeß.
Tonfolgen in Böcklins Bilde. Tempel: hell — Busch
darunter: dunkel — dann helle trocken rötlichgraue Fels-
wand: hell — Wiese: dunkler (mit vielen Verkürzungen,
um den Tempel fernzurücken) — Stadtsilhouette: dunkel
— Mauer und Berg davor: hell — dann Baum: dunkel —
Stämme davor: hell.
Im Vergleich zum grauen Himmel wirkt das rote Mieder,
obgleich nur dunkel Caputmortuum, so stark, als wäre fast
das kräftigste Rot aufgewendet: dieser Ton wäre sogleich
tot, wenn oben blauer Himmel gemalt würde. So aber habe
man hinreichend Mittel, um die grauen Büsche und das Rot
so kräftig wie in der Natur erscheinen zu lassen.
Böcklin malte die Felsen, welche das Becken bilden, in
dem sich das Quellwasser sammelt, und bestrebt sich dabei
besonders die Nymphe fern zurückzu-
bringen. Dabei betonte er besonders
einige Punkte, die ihm die Sache
charakterisieren sollten und hatte diese
beim Weiterarbeiten immer im Auge,
so z. B. ein horizontales Blatt bei a,
das hellgrün vor einer dunklen Tiefe
horizontal steht und ihm das Hinein-
gehen in die Spalte ausdrücken hilft.
Die Felsen rechts müssen vortreten, da-
mit es eng und gemütlich in dem Plätzchen der Nymphe
wird und der Schatten auf ihrem oberen Teil sich mehr
rechtfertigt. Die Partien der auf diesem so vortretenden
Felsen (x) wachsenden Büsche werden in ihren Linien ent-
gegengesetzt laufen müssen.
Späterer Zusatz (datirt vom 18. Juli 66.)
Von seiner Nymphe auf dem besprochenen Bilde bemerkte
Böcklin: diese Idee, die Nymphe und die Quelle (die Sache
selbst und ihre Personifizierung) malen zu müssen, wider-
strebe seiner Ueberzeugung so sehr, daß er sich nicht hinein-
zudenken vermöge, und wenn auch alle späteren Künstler
es so dargestellt hätten, so bleibe es doch immer eine barocke
Idee. Die Griechen der guten Zeit hätten es gewiß nicht
gethan. Sie hätten ihr den Wasserkrug vielleicht beigegeben,
aber das Wasser nicht neben ihr fließen lassen. Sie hätten
kaum der Plinthe zur Andeutung ein Wellenornament gegeben.
Böcklin setzte mit Ende Juni das Malen dieses Bildes aus
und beschäftigte sich bis zu seiner Abreise von Rom ganz
ausschließlich mit seinem Petrarkabilde.
C 45 3
Böcklin änderte noch die Hirtin, indem er ihr weiße
Hemdärmel und ein dunkel ponceaufarbenes Mieder gab
f dunkel Eisenoxyd) und die Korallenkette, als zu kleinlich,
fortließ Durch diese weißen Hemdärmel drückt sich das
Hinüberneigen besser aus. Auch hat sie jetzt bräunliches Haar.
Böcklin liefs nun die vorderen Figuren einstweilen ruhen
und begann den ferneren Teil herauszubilden und zwar fast
Grau in Grau, mit schwacher Farbenandeutung.
Er zeichnete die Schattenformen des mittleren Teiles erst
mit dünner, nur wenig dunklerer Farbe vor, sodafs damit
die Licht- und Schattenerscheinung hinskizziert war, gab
dann den ferneren Bäumen ein wenig Ton und eine Spur
Grün, und deutete den Anfang der Lorbeerstämme an. Dann,
auf einem gradlinigen Brunnen sitzend, den Körper des
Apollo, mit dünnem Weiß, sodafs er gegen das Grungrau
der Umgebung schon etwas rosa wirkte. Die anderen Figuren
brachte er auch mit Weiß zur Erscheinung und gab der
säugenden Frau ein hellgelbes Gewand. D^ "°^a™'
Schäfer mit Ziegenfell, sich auf einen Stab lehnend. Die
g aden Linien des Brunnens (darüber anstatt Feigen grad-
ftämmiger Lorbeer) gäben eine bessere Lokalität; in Beziehung
darauf Weiber mit Krügen und Hirten als Zuhörerschaft.
Statt des horizontalen dorischen Tempels ist jetzt ein runder
Tempel (wie Vestatempel) gemalt, weil Böcklin die Hori-
zontalen zu lastend fand, und die Senkrechte mehr betont
werden mufs, wodurch denn auch wieder die Horizontal-
richtung des Terrains mehr Wichtigkeit erhält.
27. Juni 66.
Böcklin malte darauf den Himmel in einer neutralen
etwas dunkleren Farbe, fast von dem Ton und Dunkelheit
des grundierten Tons, und mit derben horizontalen Strichen,
damit das Fleckige des Grundes aufgehoben würde. Zugleich
gab er einige Andeutungen von horizontalen Streifen und
zwei ganz kleinen Wölkchen. Ton und Farbe mußten noch
so gebrochen sein wegen der schwachen Farbenandeutung
der ganzen Ferne.
28. Juni 66.
Als ich mich wunderte, daß Böcklin die Luft so dunkel-
grau (Kernschwarz und Weiß) ohne Spur von Blau grun-
dierte, meinte Böcklin Blau wäre die brillanteste Farbe und
im Verhältnis zu den andern
Farben schon ganz schwach
aufgetragen, von solcher
Leuchtkraft, dafs man sich
besonders in der Luft nicht
genug vor dieser Farbe hüten
könne, da sie gar leicht jede
andere Farbe tot und schwer
erscheinen ließe.
Rot, Blau, Gelb sei die
Leuchtkraft der Farben in
der Natur; so reicht unsere
Palette z von der Farblosig-
keit im allgemeinen in Rot
und Gelb nur bis x, im Blau
Jfa4"<^- '4
aber weiter, bis z. Wir dürfen aber nicht eine Farbe im
Uebermaß anwenden und die andern vernachlässigen. Und
indem wir uns bemühen, die drei Farben ins Gleichgewicht
zu bringen, müssen wir uns auch beschränken, das Blau nur
bis zum Maße x anzuwenden.
Böcklin sagte dann: „Wie das Blau, liegt auch das
Weifs gewöhnlich außerhalb des Farbenkreises unserer Bild-
stimmungen."
Ein anderesmal sagte er: „Wenn man Weifs im Bilde
hat, ist der Farbenkreis in dem man sich bewegen kann,
größer."
Während Böcklin seine Malerei aus dem Grauen oder
einem mäßigen Farbenkreis ins Farbige steigerte, veranlaßte
er mich bei meinem Leonorenbilde, um auf denselben Stand-
punkt zu kommen, zum umgekehrten Prozeß.
Tonfolgen in Böcklins Bilde. Tempel: hell — Busch
darunter: dunkel — dann helle trocken rötlichgraue Fels-
wand: hell — Wiese: dunkler (mit vielen Verkürzungen,
um den Tempel fernzurücken) — Stadtsilhouette: dunkel
— Mauer und Berg davor: hell — dann Baum: dunkel —
Stämme davor: hell.
Im Vergleich zum grauen Himmel wirkt das rote Mieder,
obgleich nur dunkel Caputmortuum, so stark, als wäre fast
das kräftigste Rot aufgewendet: dieser Ton wäre sogleich
tot, wenn oben blauer Himmel gemalt würde. So aber habe
man hinreichend Mittel, um die grauen Büsche und das Rot
so kräftig wie in der Natur erscheinen zu lassen.
Böcklin malte die Felsen, welche das Becken bilden, in
dem sich das Quellwasser sammelt, und bestrebt sich dabei
besonders die Nymphe fern zurückzu-
bringen. Dabei betonte er besonders
einige Punkte, die ihm die Sache
charakterisieren sollten und hatte diese
beim Weiterarbeiten immer im Auge,
so z. B. ein horizontales Blatt bei a,
das hellgrün vor einer dunklen Tiefe
horizontal steht und ihm das Hinein-
gehen in die Spalte ausdrücken hilft.
Die Felsen rechts müssen vortreten, da-
mit es eng und gemütlich in dem Plätzchen der Nymphe
wird und der Schatten auf ihrem oberen Teil sich mehr
rechtfertigt. Die Partien der auf diesem so vortretenden
Felsen (x) wachsenden Büsche werden in ihren Linien ent-
gegengesetzt laufen müssen.
Späterer Zusatz (datirt vom 18. Juli 66.)
Von seiner Nymphe auf dem besprochenen Bilde bemerkte
Böcklin: diese Idee, die Nymphe und die Quelle (die Sache
selbst und ihre Personifizierung) malen zu müssen, wider-
strebe seiner Ueberzeugung so sehr, daß er sich nicht hinein-
zudenken vermöge, und wenn auch alle späteren Künstler
es so dargestellt hätten, so bleibe es doch immer eine barocke
Idee. Die Griechen der guten Zeit hätten es gewiß nicht
gethan. Sie hätten ihr den Wasserkrug vielleicht beigegeben,
aber das Wasser nicht neben ihr fließen lassen. Sie hätten
kaum der Plinthe zur Andeutung ein Wellenornament gegeben.
Böcklin setzte mit Ende Juni das Malen dieses Bildes aus
und beschäftigte sich bis zu seiner Abreise von Rom ganz
ausschließlich mit seinem Petrarkabilde.
C 45 3