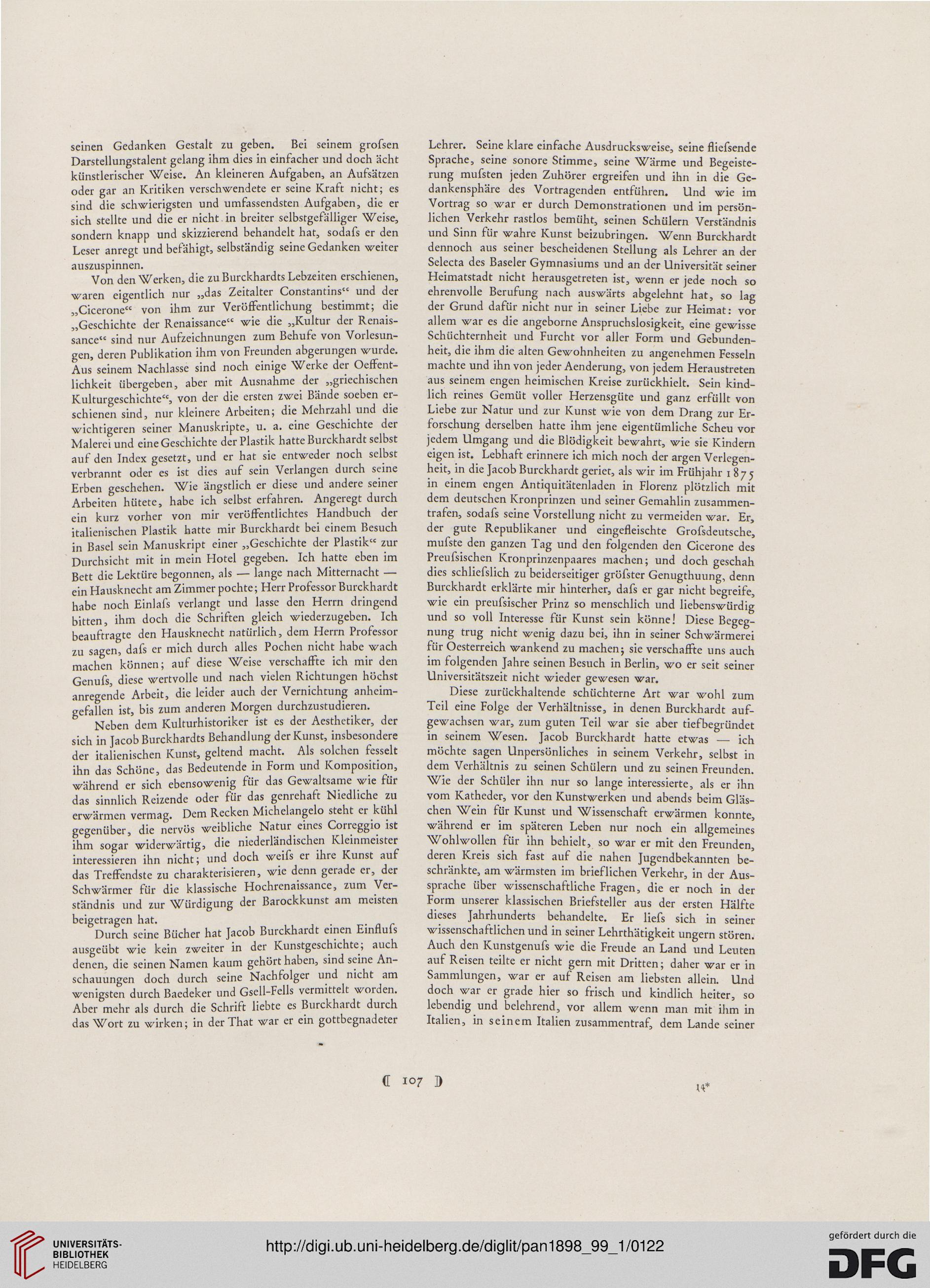seinen Gedanken Gestalt zu geben. Bei seinem grofsen
Darstellungstalent gelang ihm dies in einfacher und doch acht
künstlerischer Weise. An kleineren Aufgaben, an Aufsätzen
oder gar an Kritiken verschwendete er seine Kraft nicht; es
sind die schwierigsten und umfassendsten Aufgaben, die er
sich stellte und die er nicht in breiter selbstgefälliger Weise,
sondern knapp und skizzierend behandelt hat, sodafs er den
Leser anregt und befähigt, selbständig seine Gedanken weiter
auszuspinnen.
Von den Werken, die zu Burckhardts Lebzeiten erschienen,
waren eigentlich nur „das Zeitalter Constantins" und der
„Cicerone" von ihm zur Veröffentlichung bestimmt; die
^Geschichte der Renaissance" wie die „Kultur der Renais-
sance" sind nur Aufzeichnungen zum Behufs von Vorlesun-
gen, deren Publikation ihm von Freunden abgerungen wurde.
Aus seinem Nachlasse sind noch einige Werke der Oeffent-
lichkeit übergeben, aber mit Ausnahme der „griechischen
Kulturgeschichte", von der die ersten zwei Bände soeben er-
schienen sind, nur kleinere Arbeiten; die Mehrzahl und die
wichtigeren seiner Manuskripte, u. a. eine Geschichte der
Malerei und eine Geschichte der Plastik hatte Burckhardt selbst
auf den Index gesetzt, und er hat sie entweder noch selbst
verbrannt oder es ist dies auf sein Verlangen durch seine
Erben geschehen. Wie ängstlich er diese und andere seiner
Arbeiten hütete, habe ich selbst erfahren. Angeregt durch
ein kurz vorher von mir veröffentlichtes Handbuch der
italienischen Plastik hatte mir Burckhardt bei einem Besuch
in Basel sein Manuskript einer „Geschichte der Plastik" zur
Durchsicht mit in mein Hotel gegeben. Ich hatte eben im
Bett die Lektüre begonnen, als — lange nach Mitternacht —
ein Hausknecht am Zimmer pochte; Herr Professor Burckhardt
habe noch Einlafs verlangt und lasse den Herrn dringend
bitten, ihm doch die Schriften gleich wiederzugeben. Ich
beauftragte den Hausknecht natürlich, dem Herrn Professor
zu sagen, dafs er mich durch alles Pochen nicht habe wach
machen können; auf diese Weise verschaffte ich mir den
Genufs, diese wertvolle und nach vielen Richtungen höchst
anregende Arbeit, die leider auch der Vernichtung anheim-
gefallen ist, bis zum anderen Morgen durchzustudieren.
Neben dem Kulturhistoriker ist es der Aesthetiker, der
sich in Jacob Burckhardts Behandlung der Kunst, insbesondere
der italienischen Kunst, geltend macht. Als solchen fesselt
ihn das Schöne, das Bedeutende in Form und Komposition,
während er sich ebensowenig für das Gewaltsame wie für
das sinnlich Reizende oder für das genrehaft Niedliche zu
erwärmen vermag. Dem Recken Michelangelo steht er kühl
gegenüber, die nervös weibliche Natur eines Correggio ist
ihm sogar widerwärtig, die niederländischen Kleinmeister
interessieren ihn nicht; und doch weifs er ihre Kunst auf
das Treffendste zu charakterisieren, wie denn gerade er, der
Schwärmer für die klassische Hochrenaissance, zum Ver-
ständnis und zur Würdigung der Barockkunst am meisten
beigetragen hat.
Durch seine Bücher hat Jacob Burckhardt einen Einflufs
ausgeübt wie kein zweiter in der Kunstgeschichte; auch
denen, die seinen Namen kaum gehört haben, sind seine An-
schauungen doch durch seine Nachfolger und nicht am
wenigsten durch Baedeker und Gsell-Fells vermittelt worden.
Aber mehr als durch die Schrift liebte es Burckhardt durch
das Wort zu wirken; in der That war er ein gottbegnadeter
Lehrer. Seine klare einfache Ausdrucksweise, seine fliefsende
Sprache, seine sonore Stimme, seine Wärme und Begeiste-
rung mufsten jeden Zuhörer ergreifen und ihn in die Ge-
dankensphäre des Vortragenden entführen. Und wie im
Vortrag so war er durch Demonstrationen und im persön-
lichen Verkehr rastlos bemüht, seinen Schülern Verständnis
und Sinn für wahre Kunst beizubringen. Wenn Burckhardt
dennoch aus seiner bescheidenen Stellung als Lehrer an der
Selecta des Baseler Gymnasiums und an der Universität seiner
Heimatstadt nicht herausgetreten ist, wenn er jede noch so
ehrenvolle Berufung nach auswärts abgelehnt hat, so lag
der Grund dafür nicht nur in seiner Liebe zur Heimat: vor
allem war es die angeborne Anspruchslosigkeit, eine gewisse
Schüchternheit und Furcht vor aller Form und Gebunden-
heit, die ihm die alten Gewohnheiten zu angenehmen Fesseln
machte und ihn von jeder Aenderung, von jedem Heraustreten
aus seinem engen heimischen Kreise zurückhielt. Sein kind-
lich reines Gemüt voller Herzensgüte und ganz erfüllt von
Liebe zur Natur und zur Kunst wie von dem Drang zur Er-
forschung derselben hatte ihm jene eigentümliche Scheu vor
jedem Umgang und die Blödigkeit bewahrt, wie sie Kindern
eigen ist. Lebhaft erinnere ich mich noch der argen Verlegen-
heit, in die Jacob Burckhardt geriet, als wir im Frühjahr i 875
in einem engen Antiquitätenladen in Florenz plötzlich mit
dem deutschen Kronprinzen und seiner Gemahlin zusammen-
trafen, sodafs seine Vorstellung nicht zu vermeiden war. Er,
der gute Republikaner und eingefleischte Grofsdeutsche,
mufste den ganzen Tag und den folgenden den Cicerone des
Preufsischen Kronprinzenpaares machen; und doch geschah
dies schliefslich zu beiderseitiger gröfster Genugthuung, denn
Burckhardt erklärte mir hinterher, dafs er gar nicht begreife,
wie ein preufsischer Prinz so menschlich und liebenswürdig
und so voll Interesse für Kunst sein könne! Diese Begeg-
nung trug nicht wenig dazu bei, ihn in seiner Schwärmerei
für Oesterreich wankend zu machen; sie verschaffte uns auch
im folgenden Jahre seinen Besuch in Berlin, wo er seit seiner
Universitätszeit nicht wieder gewesen war.
Diese zurückhaltende schüchterne Art war wohl zum
Teil eine Folge der Verhältnisse, in denen Burckhardt auf-
gewachsen war, zum guten Teil war sie aber tiefbegründet
in seinem Wesen. Jacob Burckhardt hatte etwas — ich
möchte sagen Unpersönliches in seinem Verkehr, selbst in
dem Verhältnis zu seinen Schülern und zu seinen Freunden.
Wie der Schüler ihn nur so lange interessierte, als er ihn
vom Katheder, vor den Kunstwerken und abends beim Gläs-
chen Wein für Kunst und Wissenschaft erwärmen konnte,
während er im späteren Leben nur noch ein allgemeines
Wohlwollen für ihn behielt, so war er mit den Freunden,
deren Kreis sich fast auf die nahen Jugendbekannten be-
schränkte, am wärmsten im brieflichen Verkehr, in der Aus-
sprache über wissenschaftliche Fragen, die er noch in der
Form unserer klassischen Briefsteller aus der ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts behandelte. Er liefs sich in seiner
wissenschaftlichen und in seiner Lehrthätigkeit ungern stören.
Auch den Kunstgenufs wie die Freude an Land und Leuten
auf Reisen teilte er nicht gern mit Dritten; daher war er in
Sammlungen, war er auf Reisen am liebsten allein. Und
doch war er grade hier so frisch und kindlich heiter, so
lebendig und belehrend, vor allem wenn man mit ihm in
Italien, in seinem Italien zusammentraf, dem Lande seiner
C 107 D
«*
Darstellungstalent gelang ihm dies in einfacher und doch acht
künstlerischer Weise. An kleineren Aufgaben, an Aufsätzen
oder gar an Kritiken verschwendete er seine Kraft nicht; es
sind die schwierigsten und umfassendsten Aufgaben, die er
sich stellte und die er nicht in breiter selbstgefälliger Weise,
sondern knapp und skizzierend behandelt hat, sodafs er den
Leser anregt und befähigt, selbständig seine Gedanken weiter
auszuspinnen.
Von den Werken, die zu Burckhardts Lebzeiten erschienen,
waren eigentlich nur „das Zeitalter Constantins" und der
„Cicerone" von ihm zur Veröffentlichung bestimmt; die
^Geschichte der Renaissance" wie die „Kultur der Renais-
sance" sind nur Aufzeichnungen zum Behufs von Vorlesun-
gen, deren Publikation ihm von Freunden abgerungen wurde.
Aus seinem Nachlasse sind noch einige Werke der Oeffent-
lichkeit übergeben, aber mit Ausnahme der „griechischen
Kulturgeschichte", von der die ersten zwei Bände soeben er-
schienen sind, nur kleinere Arbeiten; die Mehrzahl und die
wichtigeren seiner Manuskripte, u. a. eine Geschichte der
Malerei und eine Geschichte der Plastik hatte Burckhardt selbst
auf den Index gesetzt, und er hat sie entweder noch selbst
verbrannt oder es ist dies auf sein Verlangen durch seine
Erben geschehen. Wie ängstlich er diese und andere seiner
Arbeiten hütete, habe ich selbst erfahren. Angeregt durch
ein kurz vorher von mir veröffentlichtes Handbuch der
italienischen Plastik hatte mir Burckhardt bei einem Besuch
in Basel sein Manuskript einer „Geschichte der Plastik" zur
Durchsicht mit in mein Hotel gegeben. Ich hatte eben im
Bett die Lektüre begonnen, als — lange nach Mitternacht —
ein Hausknecht am Zimmer pochte; Herr Professor Burckhardt
habe noch Einlafs verlangt und lasse den Herrn dringend
bitten, ihm doch die Schriften gleich wiederzugeben. Ich
beauftragte den Hausknecht natürlich, dem Herrn Professor
zu sagen, dafs er mich durch alles Pochen nicht habe wach
machen können; auf diese Weise verschaffte ich mir den
Genufs, diese wertvolle und nach vielen Richtungen höchst
anregende Arbeit, die leider auch der Vernichtung anheim-
gefallen ist, bis zum anderen Morgen durchzustudieren.
Neben dem Kulturhistoriker ist es der Aesthetiker, der
sich in Jacob Burckhardts Behandlung der Kunst, insbesondere
der italienischen Kunst, geltend macht. Als solchen fesselt
ihn das Schöne, das Bedeutende in Form und Komposition,
während er sich ebensowenig für das Gewaltsame wie für
das sinnlich Reizende oder für das genrehaft Niedliche zu
erwärmen vermag. Dem Recken Michelangelo steht er kühl
gegenüber, die nervös weibliche Natur eines Correggio ist
ihm sogar widerwärtig, die niederländischen Kleinmeister
interessieren ihn nicht; und doch weifs er ihre Kunst auf
das Treffendste zu charakterisieren, wie denn gerade er, der
Schwärmer für die klassische Hochrenaissance, zum Ver-
ständnis und zur Würdigung der Barockkunst am meisten
beigetragen hat.
Durch seine Bücher hat Jacob Burckhardt einen Einflufs
ausgeübt wie kein zweiter in der Kunstgeschichte; auch
denen, die seinen Namen kaum gehört haben, sind seine An-
schauungen doch durch seine Nachfolger und nicht am
wenigsten durch Baedeker und Gsell-Fells vermittelt worden.
Aber mehr als durch die Schrift liebte es Burckhardt durch
das Wort zu wirken; in der That war er ein gottbegnadeter
Lehrer. Seine klare einfache Ausdrucksweise, seine fliefsende
Sprache, seine sonore Stimme, seine Wärme und Begeiste-
rung mufsten jeden Zuhörer ergreifen und ihn in die Ge-
dankensphäre des Vortragenden entführen. Und wie im
Vortrag so war er durch Demonstrationen und im persön-
lichen Verkehr rastlos bemüht, seinen Schülern Verständnis
und Sinn für wahre Kunst beizubringen. Wenn Burckhardt
dennoch aus seiner bescheidenen Stellung als Lehrer an der
Selecta des Baseler Gymnasiums und an der Universität seiner
Heimatstadt nicht herausgetreten ist, wenn er jede noch so
ehrenvolle Berufung nach auswärts abgelehnt hat, so lag
der Grund dafür nicht nur in seiner Liebe zur Heimat: vor
allem war es die angeborne Anspruchslosigkeit, eine gewisse
Schüchternheit und Furcht vor aller Form und Gebunden-
heit, die ihm die alten Gewohnheiten zu angenehmen Fesseln
machte und ihn von jeder Aenderung, von jedem Heraustreten
aus seinem engen heimischen Kreise zurückhielt. Sein kind-
lich reines Gemüt voller Herzensgüte und ganz erfüllt von
Liebe zur Natur und zur Kunst wie von dem Drang zur Er-
forschung derselben hatte ihm jene eigentümliche Scheu vor
jedem Umgang und die Blödigkeit bewahrt, wie sie Kindern
eigen ist. Lebhaft erinnere ich mich noch der argen Verlegen-
heit, in die Jacob Burckhardt geriet, als wir im Frühjahr i 875
in einem engen Antiquitätenladen in Florenz plötzlich mit
dem deutschen Kronprinzen und seiner Gemahlin zusammen-
trafen, sodafs seine Vorstellung nicht zu vermeiden war. Er,
der gute Republikaner und eingefleischte Grofsdeutsche,
mufste den ganzen Tag und den folgenden den Cicerone des
Preufsischen Kronprinzenpaares machen; und doch geschah
dies schliefslich zu beiderseitiger gröfster Genugthuung, denn
Burckhardt erklärte mir hinterher, dafs er gar nicht begreife,
wie ein preufsischer Prinz so menschlich und liebenswürdig
und so voll Interesse für Kunst sein könne! Diese Begeg-
nung trug nicht wenig dazu bei, ihn in seiner Schwärmerei
für Oesterreich wankend zu machen; sie verschaffte uns auch
im folgenden Jahre seinen Besuch in Berlin, wo er seit seiner
Universitätszeit nicht wieder gewesen war.
Diese zurückhaltende schüchterne Art war wohl zum
Teil eine Folge der Verhältnisse, in denen Burckhardt auf-
gewachsen war, zum guten Teil war sie aber tiefbegründet
in seinem Wesen. Jacob Burckhardt hatte etwas — ich
möchte sagen Unpersönliches in seinem Verkehr, selbst in
dem Verhältnis zu seinen Schülern und zu seinen Freunden.
Wie der Schüler ihn nur so lange interessierte, als er ihn
vom Katheder, vor den Kunstwerken und abends beim Gläs-
chen Wein für Kunst und Wissenschaft erwärmen konnte,
während er im späteren Leben nur noch ein allgemeines
Wohlwollen für ihn behielt, so war er mit den Freunden,
deren Kreis sich fast auf die nahen Jugendbekannten be-
schränkte, am wärmsten im brieflichen Verkehr, in der Aus-
sprache über wissenschaftliche Fragen, die er noch in der
Form unserer klassischen Briefsteller aus der ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts behandelte. Er liefs sich in seiner
wissenschaftlichen und in seiner Lehrthätigkeit ungern stören.
Auch den Kunstgenufs wie die Freude an Land und Leuten
auf Reisen teilte er nicht gern mit Dritten; daher war er in
Sammlungen, war er auf Reisen am liebsten allein. Und
doch war er grade hier so frisch und kindlich heiter, so
lebendig und belehrend, vor allem wenn man mit ihm in
Italien, in seinem Italien zusammentraf, dem Lande seiner
C 107 D
«*