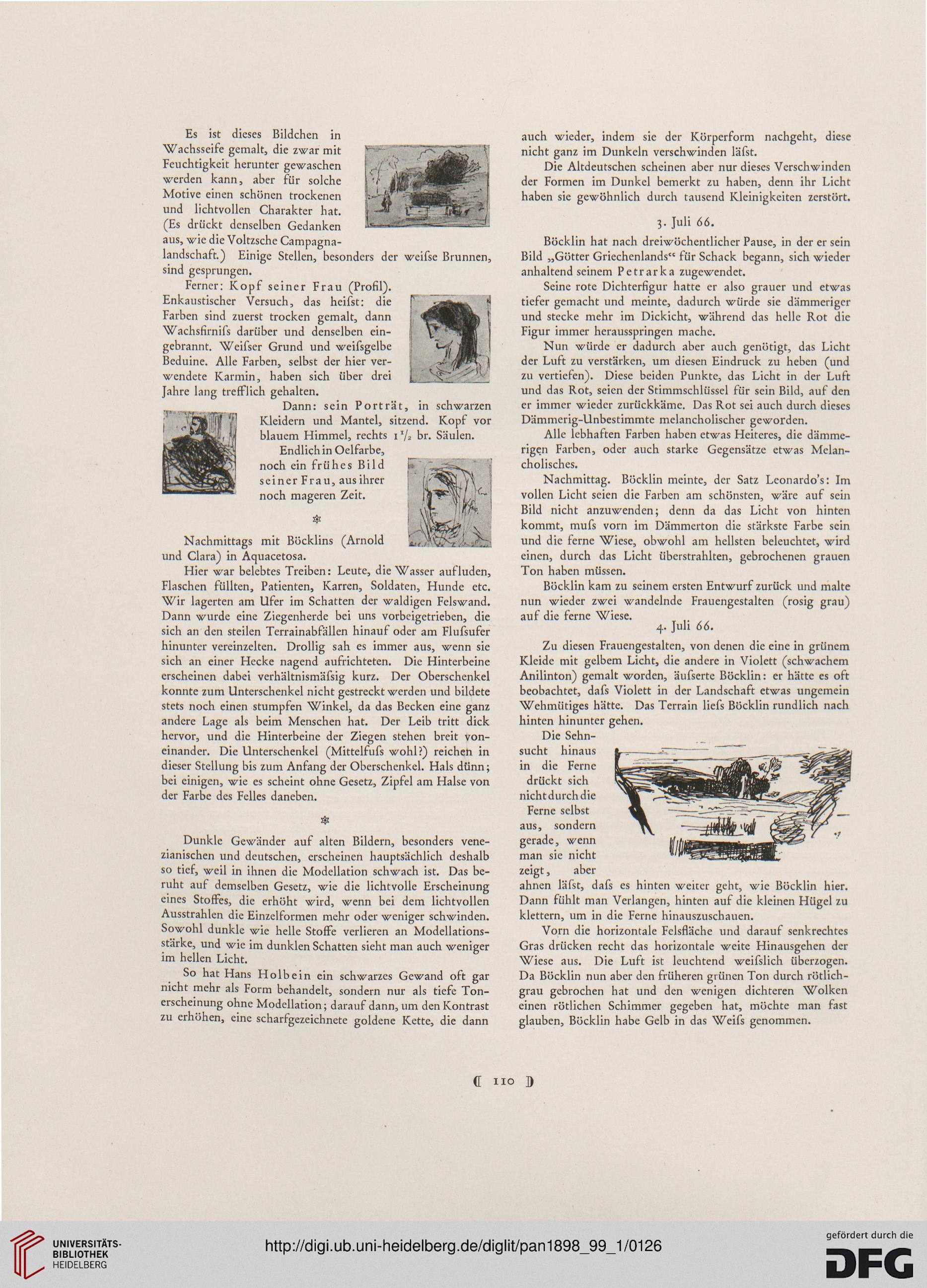Es ist dieses Bildchen in
Wachsseife gemalt, die zwar mit
Feuchtigkeit herunter gewaschen
werden kann, aber für solche
Motive einen schönen trockenen
und lichtvollen Charakter hat.
(Es drückt denselben Gedanken
aus, wie die Voltzsche Campagna-
landschaft.) Einige Stellen, besonders der weifse Brunnen,
sind gesprungen.
Ferner: Kopf seiner Frau (Profil).
Enkaustischer Versuch, das heifst: die
Farben sind zuerst trocken gemalt, dann
Wachsfirnifs darüber und denselben ein-
gebrannt. Weifser Grund und weifsgelbe
Beduine. Alle Farben, selbst der hier ver-
wendete Karmin, haben sich über drei
Jahre lang trefflich gehalten.
Dann: sein Porträt, in schwarzen
Kleidern und Mantel, sitzend. Kopf vor
blauem Himmel, rechts i J/2 br. Säulen.
Endlich in Oelfarbe,
noch ein frühes Bild
seiner Frau, aus ihrer
noch mageren Zeit.
Nachmittags mit Bücklins (Arnold
und Clara) in Aquacetosa.
Hier war belebtes Treiben: Leute, die Wasser aufluden,
Flaschen füllten, Patienten, Karren, Soldaten, Hunde etc.
Wir lagerten am Ufer im Schatten der waldigen Felswand.
Dann wurde eine Ziegenherde bei uns vorbeigetrieben, die
sich an den steilen Terrainabfällen hinauf oder am Flufsufer
hinunter vereinzelten. Drollig sah es immer aus, wenn sie
sich an einer Hecke nagend aufrichteten. Die Hinterbeine
erscheinen dabei verhältnismäfsig kurz. Der Oberschenkel
konnte zum Unterschenkel nicht gestreckt werden und bildete
stets noch einen stumpfen Winkel, da das Becken eine ganz
andere Lage als beim Menschen hat. Der Leib tritt dick
hervor, und die Hinterbeine der Ziegen stehen breit von-
einander. Die Unterschenkel (Mittelfufs wohl?) reichen in
dieser Stellung bis zum Anfang der Oberschenkel. Hals dünn;
bei einigen, wie es scheint ohne Gesetz, Zipfel am Halse von
der Farbe des Felles daneben.
Dunkle Gewänder auf alten Bildern, besonders vene-
zianischen und deutschen, erscheinen hauptsächlich deshalb
so tief, weil in ihnen die Modellation schwach ist. Das be-
ruht auf demselben Gesetz, wie die lichtvolle Erscheinung
eines Stoffes, die erhöht wird, wenn bei dem lichtvollen
Ausstrahlen die Einzelformen mehr oder weniger schwinden.
Sowohl dunkle wie helle Stoffe verlieren an Modellations-
stärke, und wie im dunklen Schatten sieht man auch weniger
im hellen Licht.
So hat Hans Holbein ein schwarzes Gewand oft gar
nicht mehr als Form behandelt, sondern nur als tiefe Ton-
erscheinung ohne Modellation; darauf dann, um den Kontrast
zu erhöhen, eine scharfgezeichnete goldene Kette, die dann
auch wieder, indem sie der Körperform nachgeht, diese
nicht ganz im Dunkeln verschwinden läfst.
Die Altdeutschen scheinen aber nur dieses Verschwinden
der Formen im Dunkel bemerkt zu haben, denn ihr Licht
haben sie gewöhnlich durch tausend Kleinigkeiten zerstört.
3. Juli 66.
Böcklin hat nach dreiwöchentlicher Pause, in der er sein
Bild „Götter Griechenlands" für Schack begann, sich wieder
anhaltend seinem Petrarka zugewendet.
Seine rote Dichterfigur hatte er also grauer und etwas
tiefer gemacht und meinte, dadurch würde sie dämmeriger
und stecke mehr im Dickicht, während das helle Rot die
Figur immer herausspringen mache.
Nun würde er dadurch aber auch genötigt, das Licht
der Luft zu verstärken, um diesen Eindruck zu heben (und
zu vertiefen). Diese beiden Punkte, das Licht in der Luft
und das Rot, seien der Stimmschlüssel für sein Bild, auf den
er immer wieder zurückkäme. Das Rot sei auch durch dieses
Dämmerig-Unbestimmte melancholischer geworden.
Alle lebhaften Farben haben etwas Heiteres, die dämme-
rigen Farben, oder auch starke Gegensätze etwas Melan-
cholisches.
Nachmittag. Böcklin meinte, der Satz Leonardo's: Im
vollen Licht seien die Farben am schönsten, wäre auf sein
Bild nicht anzuwenden; denn da das Licht von hinten
kommt, mufs vorn im Dämmerton die stärkste Farbe sein
und die ferne Wiese, obwohl am hellsten beleuchtet, wird
einen, durch das Licht überstrahlten, gebrochenen grauen
Ton haben müssen.
Böcklin kam zu seinem ersten Entwurf zurück und malte
nun wieder zwei wandelnde Frauengestalten (rosig grau)
auf die ferne Wiese.
4. Juli 66.
Zu diesen Frauengestalten, von denen die eine in grünem
Kleide mit gelbem Licht, die andere in Violett (schwachem
Anilinton) gemalt worden, äufserte Böcklin: er hätte es oft
beobachtet, dafs Violett in der Landschaft etwas ungemein
Wehmütiges hätte. Das Terrain liefs Böcklin rundlich nach
hinten hinunter gehen.
Die Sehn-
sucht hinaus
in die Ferne
drückt sich
nicht durch die
Ferne selbst
aus, sondern
gerade, wenn
man sie nicht
zeigt, aber
ahnen läfst, dafs es hinten weiter geht, wie Böcklin hier.
Dann fühlt man Verlangen, hinten auf die kleinen Hügel zu
klettern, um in die Ferne hinauszuschauen.
Vorn die horizontale Felsfläche und darauf senkrechtes
Gras drücken recht das horizontale weite Hinausgehen der
Wiese aus. Die Luft ist leuchtend weifslich überzogen.
Da Böcklin nun aber den früheren grünen Ton durch rötlich-
grau gebrochen hat und den wenigen dichteren Wolken
einen rötlichen Schimmer gegeben hat, möchte man fast
glauben, Böcklin habe Gelb in das Weifs genommen.
C ho I)
Wachsseife gemalt, die zwar mit
Feuchtigkeit herunter gewaschen
werden kann, aber für solche
Motive einen schönen trockenen
und lichtvollen Charakter hat.
(Es drückt denselben Gedanken
aus, wie die Voltzsche Campagna-
landschaft.) Einige Stellen, besonders der weifse Brunnen,
sind gesprungen.
Ferner: Kopf seiner Frau (Profil).
Enkaustischer Versuch, das heifst: die
Farben sind zuerst trocken gemalt, dann
Wachsfirnifs darüber und denselben ein-
gebrannt. Weifser Grund und weifsgelbe
Beduine. Alle Farben, selbst der hier ver-
wendete Karmin, haben sich über drei
Jahre lang trefflich gehalten.
Dann: sein Porträt, in schwarzen
Kleidern und Mantel, sitzend. Kopf vor
blauem Himmel, rechts i J/2 br. Säulen.
Endlich in Oelfarbe,
noch ein frühes Bild
seiner Frau, aus ihrer
noch mageren Zeit.
Nachmittags mit Bücklins (Arnold
und Clara) in Aquacetosa.
Hier war belebtes Treiben: Leute, die Wasser aufluden,
Flaschen füllten, Patienten, Karren, Soldaten, Hunde etc.
Wir lagerten am Ufer im Schatten der waldigen Felswand.
Dann wurde eine Ziegenherde bei uns vorbeigetrieben, die
sich an den steilen Terrainabfällen hinauf oder am Flufsufer
hinunter vereinzelten. Drollig sah es immer aus, wenn sie
sich an einer Hecke nagend aufrichteten. Die Hinterbeine
erscheinen dabei verhältnismäfsig kurz. Der Oberschenkel
konnte zum Unterschenkel nicht gestreckt werden und bildete
stets noch einen stumpfen Winkel, da das Becken eine ganz
andere Lage als beim Menschen hat. Der Leib tritt dick
hervor, und die Hinterbeine der Ziegen stehen breit von-
einander. Die Unterschenkel (Mittelfufs wohl?) reichen in
dieser Stellung bis zum Anfang der Oberschenkel. Hals dünn;
bei einigen, wie es scheint ohne Gesetz, Zipfel am Halse von
der Farbe des Felles daneben.
Dunkle Gewänder auf alten Bildern, besonders vene-
zianischen und deutschen, erscheinen hauptsächlich deshalb
so tief, weil in ihnen die Modellation schwach ist. Das be-
ruht auf demselben Gesetz, wie die lichtvolle Erscheinung
eines Stoffes, die erhöht wird, wenn bei dem lichtvollen
Ausstrahlen die Einzelformen mehr oder weniger schwinden.
Sowohl dunkle wie helle Stoffe verlieren an Modellations-
stärke, und wie im dunklen Schatten sieht man auch weniger
im hellen Licht.
So hat Hans Holbein ein schwarzes Gewand oft gar
nicht mehr als Form behandelt, sondern nur als tiefe Ton-
erscheinung ohne Modellation; darauf dann, um den Kontrast
zu erhöhen, eine scharfgezeichnete goldene Kette, die dann
auch wieder, indem sie der Körperform nachgeht, diese
nicht ganz im Dunkeln verschwinden läfst.
Die Altdeutschen scheinen aber nur dieses Verschwinden
der Formen im Dunkel bemerkt zu haben, denn ihr Licht
haben sie gewöhnlich durch tausend Kleinigkeiten zerstört.
3. Juli 66.
Böcklin hat nach dreiwöchentlicher Pause, in der er sein
Bild „Götter Griechenlands" für Schack begann, sich wieder
anhaltend seinem Petrarka zugewendet.
Seine rote Dichterfigur hatte er also grauer und etwas
tiefer gemacht und meinte, dadurch würde sie dämmeriger
und stecke mehr im Dickicht, während das helle Rot die
Figur immer herausspringen mache.
Nun würde er dadurch aber auch genötigt, das Licht
der Luft zu verstärken, um diesen Eindruck zu heben (und
zu vertiefen). Diese beiden Punkte, das Licht in der Luft
und das Rot, seien der Stimmschlüssel für sein Bild, auf den
er immer wieder zurückkäme. Das Rot sei auch durch dieses
Dämmerig-Unbestimmte melancholischer geworden.
Alle lebhaften Farben haben etwas Heiteres, die dämme-
rigen Farben, oder auch starke Gegensätze etwas Melan-
cholisches.
Nachmittag. Böcklin meinte, der Satz Leonardo's: Im
vollen Licht seien die Farben am schönsten, wäre auf sein
Bild nicht anzuwenden; denn da das Licht von hinten
kommt, mufs vorn im Dämmerton die stärkste Farbe sein
und die ferne Wiese, obwohl am hellsten beleuchtet, wird
einen, durch das Licht überstrahlten, gebrochenen grauen
Ton haben müssen.
Böcklin kam zu seinem ersten Entwurf zurück und malte
nun wieder zwei wandelnde Frauengestalten (rosig grau)
auf die ferne Wiese.
4. Juli 66.
Zu diesen Frauengestalten, von denen die eine in grünem
Kleide mit gelbem Licht, die andere in Violett (schwachem
Anilinton) gemalt worden, äufserte Böcklin: er hätte es oft
beobachtet, dafs Violett in der Landschaft etwas ungemein
Wehmütiges hätte. Das Terrain liefs Böcklin rundlich nach
hinten hinunter gehen.
Die Sehn-
sucht hinaus
in die Ferne
drückt sich
nicht durch die
Ferne selbst
aus, sondern
gerade, wenn
man sie nicht
zeigt, aber
ahnen läfst, dafs es hinten weiter geht, wie Böcklin hier.
Dann fühlt man Verlangen, hinten auf die kleinen Hügel zu
klettern, um in die Ferne hinauszuschauen.
Vorn die horizontale Felsfläche und darauf senkrechtes
Gras drücken recht das horizontale weite Hinausgehen der
Wiese aus. Die Luft ist leuchtend weifslich überzogen.
Da Böcklin nun aber den früheren grünen Ton durch rötlich-
grau gebrochen hat und den wenigen dichteren Wolken
einen rötlichen Schimmer gegeben hat, möchte man fast
glauben, Böcklin habe Gelb in das Weifs genommen.
C ho I)