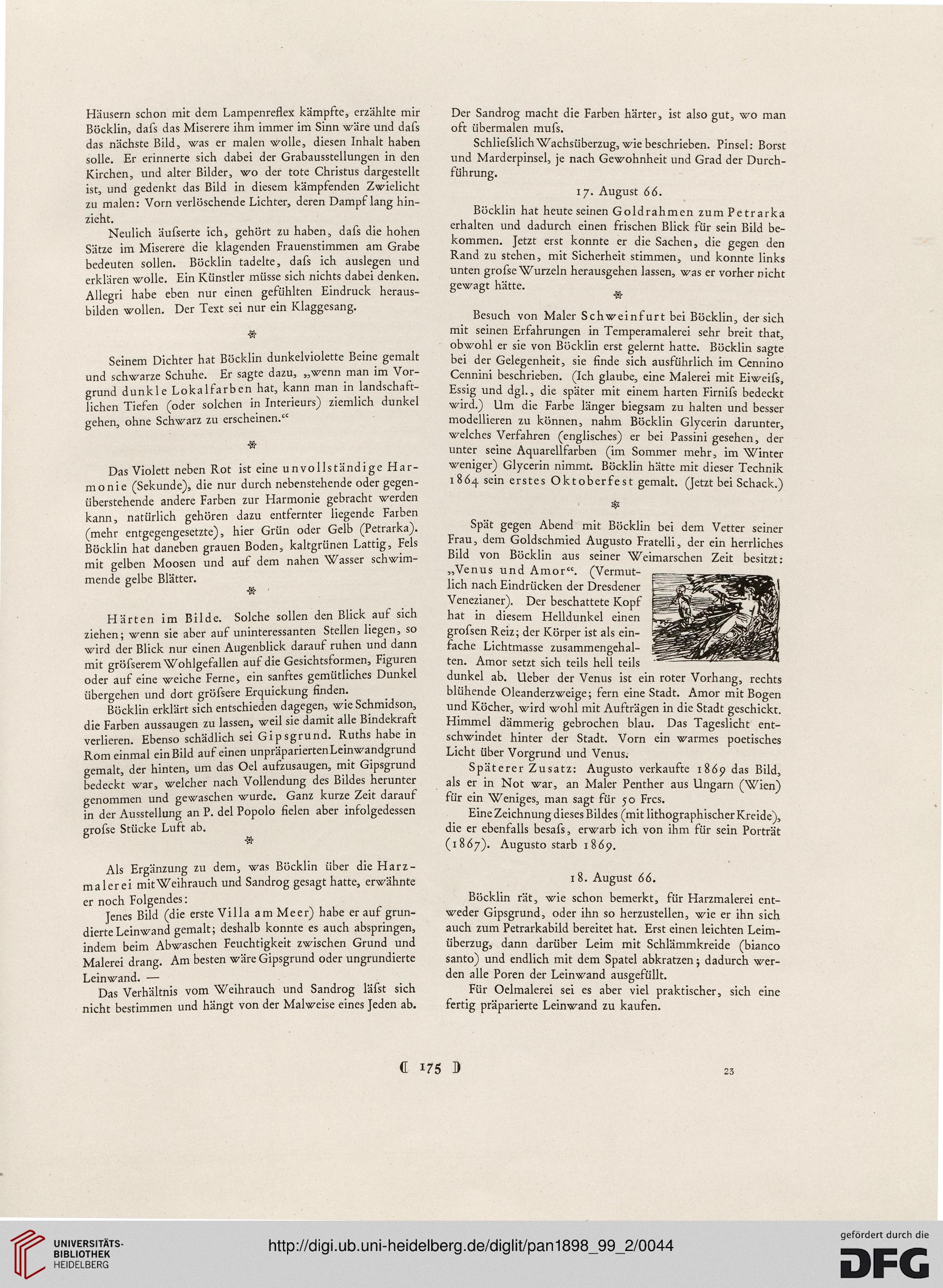Häusern schon mit dem Lampenreflex kämpfte, erzählte mir
Böcklin, dafs das Miserere ihm immer im Sinn wäre und dafs
das nächste Bild, was er malen wolle, diesen Inhalt haben
solle. Er erinnerte sich dabei der Grabausstellungen in den
Kirchen, und alter Bilder, wo der tote Christus dargestellt
ist, und gedenkt das Bild in diesem kämpfenden Zwielicht
zu malen: Vorn verlöschende Lichter, deren Dampf lang hin-
zieht.
Neulich äufserte ich, gehört zu haben, dafs die hohen
Sätze im Miserere die klagenden Frauenstimmen am Grabe
bedeuten sollen. Böcklin tadelte, dafs ich auslegen und
erklären wolle. Ein Künstler müsse sich nichts dabei denken.
Allegri habe eben nur einen gefühlten Eindruck heraus-
bilden wollen. Der Text sei nur ein Klaggesang.
Seinem Dichter hat Böcklin dunkelviolette Beine gemalt
und schwarze Schuhe. Er sagte dazu, „wenn man im Vor-
grund dunkle Lokalfarben hat, kann man in landschaft-
lichen Tiefen (oder solchen in Interieurs) ziemlich dunkel
gehen, ohne Schwarz zu erscheinen."
Das Violett neben Rot ist eine unvollständige Har-
monie (Sekunde), die nur durch nebenstehende oder gegen-
überstehende andere Farben zur Harmonie gebracht werden
kann, natürlich gehören dazu entfernter liegende Farben
(mehr entgegengesetzte), hier Grün oder Gelb (Petrarka).
Böcklin hat daneben grauen Boden, kaltgrünen Lattig, Fels
mit gelben Moosen und auf dem nahen Wasser schwim-
mende gelbe Blätter.
Härten im Bilde. Solche sollen den Blick auf sich
ziehen; wenn sie aber auf uninteressanten Stellen liegen, so
wird der Blick nur einen Augenblick darauf ruhen und dann
mit gröfserem Wohlgefallen auf die Gesichtsformen, Figuren
oder auf eine weiche Ferne, ein sanftes gemütliches Dunkel
übergehen und dort gröfsere Erquickung finden.
Böcklin erklärt sich entschieden dagegen, wie Schmidson,
die Farben aussaugen zu lassen, weil sie damit alle Bindekraft
verlieren. Ebenso schädlich sei Gipsgrund. Ruths habe in
Rom einmal ein Bild auf einen unpräparierten Leinwandgrund
gemalt, der hinten, um das Oel aufzusaugen, mit Gipsgrund
bedeckt war, welcher nach Vollendung des Bildes herunter
genommen und gewaschen wurde. Ganz kurze Zeit darauf
in der Ausstellung an P. del Popolo fielen aber infolgedessen
grofse Stücke Luft ab.
Als Ergänzung zu dem, was Böcklin über die Harz-
malerei mit Weihrauch und Sandrog gesagt hatte, erwähnte
er noch Folgendes:
Jenes Bild (die erste Villa am Meer) habe er auf grun-
dierte Leinwand gemalt; deshalb konnte es auch abspringen,
indem beim Abwaschen Feuchtigkeit zwischen Grund und
Malerei drang. Am besten wäre Gipsgrund oder ungrundierte
Leinwand. —
Das Verhältnis vom Weihrauch und Sandrog läfst sich
nicht bestimmen und hängt von der Malweise eines Jeden ab.
Der Sandrog macht die Farben härter, ist also gut, wo man
oft übermalen mufs.
Schliefslich Wachsüberzug, wie beschrieben. Pinsel: Borst
und Marderpinsel, je nach Gewohnheit und Grad der Durch-
führung.
17. August 66.
Böcklin hat heute seinen Goldrahmen zum Petrarka
erhalten und dadurch einen frischen Blick für sein Bild be-
kommen. Jetzt erst konnte er die Sachen, die gegen den
Rand zu stehen, mit Sicherheit stimmen, und konnte links
unten grofse Wurzeln herausgehen lassen, was er vorher nicht
gewagt hätte.
Besuch von Maler Schweinfurt bei Böcklin, der sich
mit seinen Erfahrungen in Temperamalerei sehr breit that,
obwohl er sie von Böcklin erst gelernt hatte. Böcklin sagte
bei der Gelegenheit, sie finde sich ausführlich im Cennino
Cennini beschrieben. (Ich glaube, eine Malerei mit Eiweifs,
Essig und dgl., die später mit einem harten Firnifs bedeckt
wird.) Um die Farbe länger biegsam zu halten und besser
modellieren zu können, nahm Böcklin Glycerin darunter,
welches Verfahren (englisches) er bei Passini gesehen, der
unter seine Aquarellfarben (im Sommer mehr, im Winter
weniger) Glycerin nimmt. Böcklin hätte mit dieser Technik
1864 sein erstes Oktoberfest gemalt. (Jetzt bei Schack.)
Spät gegen Abend mit Böcklin bei dem Vetter seiner
Frau, dem Goldschmied Augusto Fratelli, der ein herrliches
Bild von Böcklin aus seiner Weimarschen Zeit besitzt:
„Venus und Amor". (Vermut-
lich nach Eindrücken der Dresdener
Venezianer). Der beschattete Kopf
hat in diesem Helldunkel einen
grofsen Reiz; der Körper ist als ein-
fache Lichtmasse zusammengehal-
ten. Amor setzt sich teils hell teils
dunkel ab. lieber der Venus ist ein roter Vorhang, rechts
blühende Oleanderzweige; fern eine Stadt. Amor mit Bogen
und Köcher, wird wohl mit Aufträgen in die Stadt geschickt.
Himmel dämmerig gebrochen blau. Das Tageslicht ent-
schwindet hinter der Stadt. Vorn ein warmes poetisches
Licht über Vorgrund und Venus.
Späterer Zusatz: Augusto verkaufte 1869 das Bild,
als er in Not war, an Maler Penther aus Ungarn (Wien)
für ein Weniges, man sagt für 50 Frcs.
Eine Zeichnung dieses Bildes (mit lithographischer Kreide),
die er ebenfalls besafs, erwarb ich von ihm für sein Porträt
(1867). Augustostarb 1869.
18. August 66.
Böcklin rät, wie schon bemerkt, für Harzmalerei ent-
weder Gipsgrund, oder ihn so herzustellen, wie er ihn sich
auch zum Petrarkabild bereitet hat. Erst einen leichten Leim-
überzug, dann darüber Leim mit Schlämmkreide (bianco
santo) und endlich mit dem Spatel abkratzen; dadurch wer-
den alle Poren der Leinwand ausgefüllt.
Für Oelmalerei sei es aber viel praktischer, sich eine
fertig präparierte Leinwand zu kaufen.
C 175 B
23
Böcklin, dafs das Miserere ihm immer im Sinn wäre und dafs
das nächste Bild, was er malen wolle, diesen Inhalt haben
solle. Er erinnerte sich dabei der Grabausstellungen in den
Kirchen, und alter Bilder, wo der tote Christus dargestellt
ist, und gedenkt das Bild in diesem kämpfenden Zwielicht
zu malen: Vorn verlöschende Lichter, deren Dampf lang hin-
zieht.
Neulich äufserte ich, gehört zu haben, dafs die hohen
Sätze im Miserere die klagenden Frauenstimmen am Grabe
bedeuten sollen. Böcklin tadelte, dafs ich auslegen und
erklären wolle. Ein Künstler müsse sich nichts dabei denken.
Allegri habe eben nur einen gefühlten Eindruck heraus-
bilden wollen. Der Text sei nur ein Klaggesang.
Seinem Dichter hat Böcklin dunkelviolette Beine gemalt
und schwarze Schuhe. Er sagte dazu, „wenn man im Vor-
grund dunkle Lokalfarben hat, kann man in landschaft-
lichen Tiefen (oder solchen in Interieurs) ziemlich dunkel
gehen, ohne Schwarz zu erscheinen."
Das Violett neben Rot ist eine unvollständige Har-
monie (Sekunde), die nur durch nebenstehende oder gegen-
überstehende andere Farben zur Harmonie gebracht werden
kann, natürlich gehören dazu entfernter liegende Farben
(mehr entgegengesetzte), hier Grün oder Gelb (Petrarka).
Böcklin hat daneben grauen Boden, kaltgrünen Lattig, Fels
mit gelben Moosen und auf dem nahen Wasser schwim-
mende gelbe Blätter.
Härten im Bilde. Solche sollen den Blick auf sich
ziehen; wenn sie aber auf uninteressanten Stellen liegen, so
wird der Blick nur einen Augenblick darauf ruhen und dann
mit gröfserem Wohlgefallen auf die Gesichtsformen, Figuren
oder auf eine weiche Ferne, ein sanftes gemütliches Dunkel
übergehen und dort gröfsere Erquickung finden.
Böcklin erklärt sich entschieden dagegen, wie Schmidson,
die Farben aussaugen zu lassen, weil sie damit alle Bindekraft
verlieren. Ebenso schädlich sei Gipsgrund. Ruths habe in
Rom einmal ein Bild auf einen unpräparierten Leinwandgrund
gemalt, der hinten, um das Oel aufzusaugen, mit Gipsgrund
bedeckt war, welcher nach Vollendung des Bildes herunter
genommen und gewaschen wurde. Ganz kurze Zeit darauf
in der Ausstellung an P. del Popolo fielen aber infolgedessen
grofse Stücke Luft ab.
Als Ergänzung zu dem, was Böcklin über die Harz-
malerei mit Weihrauch und Sandrog gesagt hatte, erwähnte
er noch Folgendes:
Jenes Bild (die erste Villa am Meer) habe er auf grun-
dierte Leinwand gemalt; deshalb konnte es auch abspringen,
indem beim Abwaschen Feuchtigkeit zwischen Grund und
Malerei drang. Am besten wäre Gipsgrund oder ungrundierte
Leinwand. —
Das Verhältnis vom Weihrauch und Sandrog läfst sich
nicht bestimmen und hängt von der Malweise eines Jeden ab.
Der Sandrog macht die Farben härter, ist also gut, wo man
oft übermalen mufs.
Schliefslich Wachsüberzug, wie beschrieben. Pinsel: Borst
und Marderpinsel, je nach Gewohnheit und Grad der Durch-
führung.
17. August 66.
Böcklin hat heute seinen Goldrahmen zum Petrarka
erhalten und dadurch einen frischen Blick für sein Bild be-
kommen. Jetzt erst konnte er die Sachen, die gegen den
Rand zu stehen, mit Sicherheit stimmen, und konnte links
unten grofse Wurzeln herausgehen lassen, was er vorher nicht
gewagt hätte.
Besuch von Maler Schweinfurt bei Böcklin, der sich
mit seinen Erfahrungen in Temperamalerei sehr breit that,
obwohl er sie von Böcklin erst gelernt hatte. Böcklin sagte
bei der Gelegenheit, sie finde sich ausführlich im Cennino
Cennini beschrieben. (Ich glaube, eine Malerei mit Eiweifs,
Essig und dgl., die später mit einem harten Firnifs bedeckt
wird.) Um die Farbe länger biegsam zu halten und besser
modellieren zu können, nahm Böcklin Glycerin darunter,
welches Verfahren (englisches) er bei Passini gesehen, der
unter seine Aquarellfarben (im Sommer mehr, im Winter
weniger) Glycerin nimmt. Böcklin hätte mit dieser Technik
1864 sein erstes Oktoberfest gemalt. (Jetzt bei Schack.)
Spät gegen Abend mit Böcklin bei dem Vetter seiner
Frau, dem Goldschmied Augusto Fratelli, der ein herrliches
Bild von Böcklin aus seiner Weimarschen Zeit besitzt:
„Venus und Amor". (Vermut-
lich nach Eindrücken der Dresdener
Venezianer). Der beschattete Kopf
hat in diesem Helldunkel einen
grofsen Reiz; der Körper ist als ein-
fache Lichtmasse zusammengehal-
ten. Amor setzt sich teils hell teils
dunkel ab. lieber der Venus ist ein roter Vorhang, rechts
blühende Oleanderzweige; fern eine Stadt. Amor mit Bogen
und Köcher, wird wohl mit Aufträgen in die Stadt geschickt.
Himmel dämmerig gebrochen blau. Das Tageslicht ent-
schwindet hinter der Stadt. Vorn ein warmes poetisches
Licht über Vorgrund und Venus.
Späterer Zusatz: Augusto verkaufte 1869 das Bild,
als er in Not war, an Maler Penther aus Ungarn (Wien)
für ein Weniges, man sagt für 50 Frcs.
Eine Zeichnung dieses Bildes (mit lithographischer Kreide),
die er ebenfalls besafs, erwarb ich von ihm für sein Porträt
(1867). Augustostarb 1869.
18. August 66.
Böcklin rät, wie schon bemerkt, für Harzmalerei ent-
weder Gipsgrund, oder ihn so herzustellen, wie er ihn sich
auch zum Petrarkabild bereitet hat. Erst einen leichten Leim-
überzug, dann darüber Leim mit Schlämmkreide (bianco
santo) und endlich mit dem Spatel abkratzen; dadurch wer-
den alle Poren der Leinwand ausgefüllt.
Für Oelmalerei sei es aber viel praktischer, sich eine
fertig präparierte Leinwand zu kaufen.
C 175 B
23