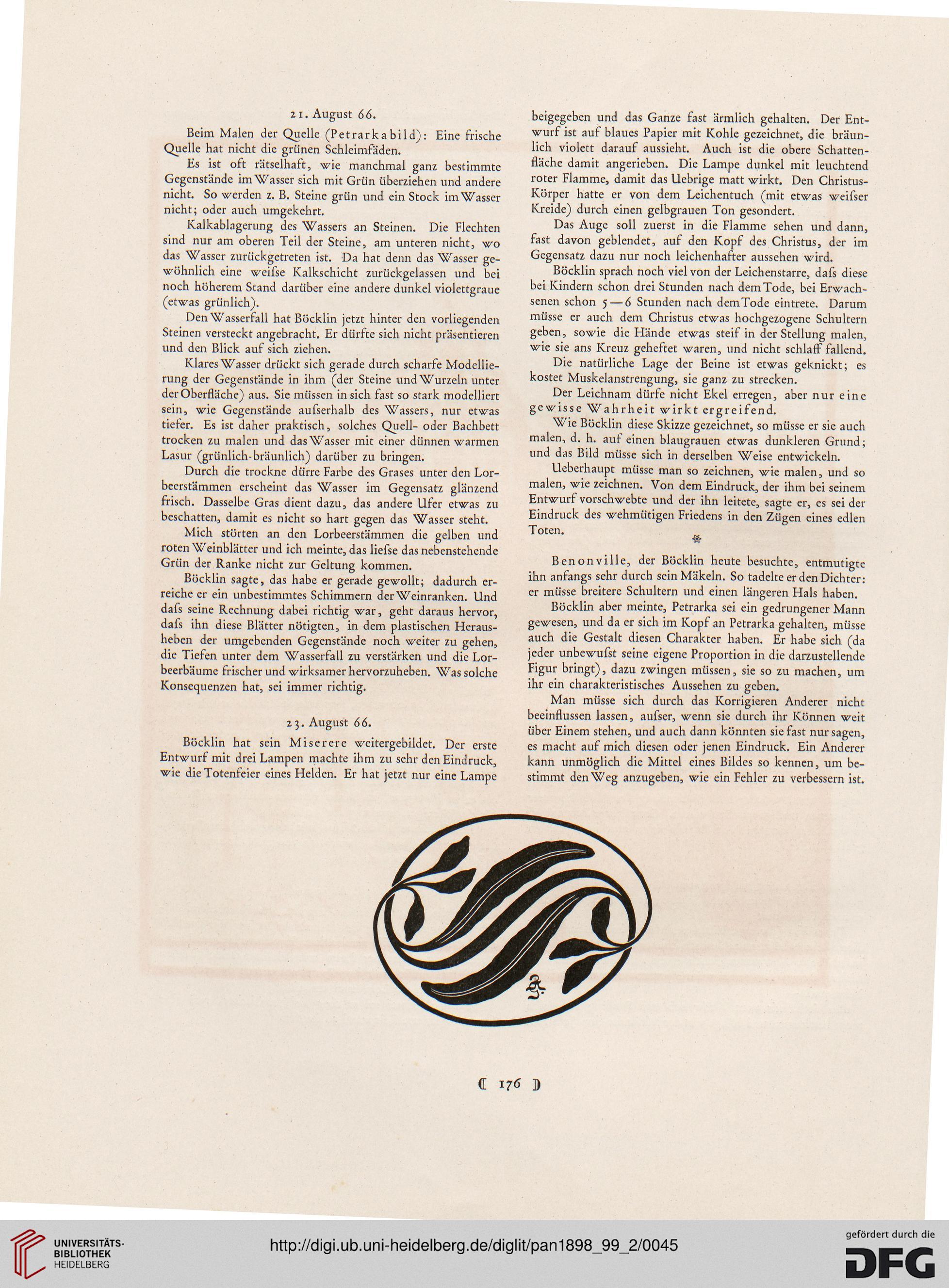2i. August 66.
Beim Malen der Quelle (Petrarkabild): Eine frische
Quelle hat nicht die grünen Schleimfäden.
Es ist oft rätselhaft, wie manchmal ganz bestimmte
Gegenstände im Wasser sich mit Grün überziehen und andere
nicht. So werden z. B. Steine grün und ein Stock im Wasser
nicht; oder auch umgekehrt.
Kalkablagerung des Wassers an Steinen. Die Flechten
sind nur am oberen Teil der Steine, am unteren nicht, wo
das Wasser zurückgetreten ist. Da hat denn das Wasser ge-
wöhnlich eine weifse Kalkschicht zurückgelassen und bei
noch höherem Stand darüber eine andere dunkel violettgraue
(etwas grünlich).
Den Wasserfall hat Bücklin jetzt hinter den vorliegenden
Steinen versteckt angebracht. Er dürfte sich nicht präsentieren
und den Blick auf sich ziehen.
Klares Wasser drückt sich gerade durch scharfe Modellie-
rung der Gegenstände in ihm (der Steine und Wurzeln unter
der Oberfläche) aus. Sie müssen in sich fast so stark modelliert
sein, wie Gegenstände aufserhalb des Wassers, nur etwas
tiefer. Es ist daher praktisch, solches Quell- oder Bachbett
trocken zu malen und das Wasser mit einer dünnen warmen
Lasur (grünlich-bräunlich) darüber zu bringen.
Durch die trockne dürre Farbe des Grases unter den Lor-
beerstämmen erscheint das Wasser im Gegensatz glänzend
frisch. Dasselbe Gras dient dazu, das andere Ufer etwas zu
beschatten, damit es nicht so hart gegen das Wasser steht.
Mich störten an den Lorbeerstämmen die gelben und
roten Weinblätter und ich meinte, das liefse das nebenstehende
Grün der Ranke nicht zur Geltung kommen.
Bücklin sagte, das habe er gerade gewollt; dadurch er-
reiche er ein unbestimmtes Schimmern der Weinranken. Und
dafs seine Rechnung dabei richtig war, geht daraus hervor,
dafs ihn diese Blätter nötigten, in dem plastischen Heraus-
heben der umgebenden Gegenstände noch weiter zu gehen,
die Tiefen unter dem Wasserfall zu verstärken und die Lor-
beerbäume frischer und wirksamer hervorzuheben. Was solche
Konsequenzen hat, sei immer richtig.
23. August 66.
Böcklin hat sein Miserere weitergebildet. Der erste
Entwurf mit drei Lampen machte ihm zu sehr den Eindruck,
wie die Totenfeier eines Helden. Er hat jetzt nur eine Lampe
beigegeben und das Ganze fast ärmlich gehalten. Der Ent-
wurf ist auf blaues Papier mit Kohle gezeichnet, die bräun-
lich violett darauf aussieht. Auch ist die obere Schatten-
fläche damit angerieben. Die Lampe dunkel mit leuchtend
roter Flamme, damit das Uebrige matt wirkt. Den Christus-
Körper hatte er von dem Leichentuch (mit etwas weifser
Kreide) durch einen gelbgrauen Ton gesondert.
Das Auge soll zuerst in die Flamme sehen und dann,
fast davon geblendet, auf den Kopf des Christus, der im
Gegensatz dazu nur noch leichenhafter aussehen wird.
Böcklin sprach noch viel von der Leichenstarre, dafs diese
bei Kindern schon drei Stunden nach dem Tode, bei Erwach-
senen schon 5 — 6 Stunden nach dem Tode eintrete. Darum
müsse er auch dem Christus etwas hochgezogene Schultern
geben, sowie die Hände etwas steif in der Stellung malen,
wie sie ans Kreuz geheftet waren, und nicht schlaff fallend.
Die natürliche Lage der Beine ist etwas geknickt; es
kostet Muskelanstrengung, sie ganz zu strecken.
Der Leichnam dürfe nicht Ekel erregen, aber nur eine
gewisse Wahrheit wirkt ergreifend.
Wie Böcklin diese Skizze gezeichnet, so müsse er sie auch
malen, d. h. auf einen blaugrauen etwas dunkleren Grund;
und das Bild müsse sich in derselben Weise entwickeln.
Ueberhaupt müsse man so zeichnen, wie malen, und so
malen, wie zeichnen. Von dem Eindruck, der ihm bei seinem
Entwurf vorschwebte und der ihn leitete, sagte er, es sei der
Eindruck des wehmütigen Friedens in den Zügen eines edlen
Toten. ^
Benonville, der Böcklin heute besuchte, entmutigte
ihn anfangs sehr durch sein Mäkeln. So tadelte er den Dichter:
er müsse breitere Schultern und einen längeren Hals haben.
Böcklin aber meinte, Petrarka sei ein gedrungener Mann
gewesen, und da er sich im Kopf an Petrarka gehalten, müsse
auch die Gestalt diesen Charakter haben. Er habe sich (da
jeder unbewufst seine eigene Proportion in die darzustellende
Figur bringt), dazu zwingen müssen, sie so zu machen, um
ihr ein charakteristisches Aussehen zu geben.
Man müsse sich durch das Korrigieren Anderer nicht
beeinflussen lassen, aufser, wenn sie durch ihr Können weit
über Einem stehen, und auch dann könnten sie fast nur sagen,
es macht auf mich diesen oder jenen Eindruck. Ein Anderer
kann unmöglich die Mittel eines Bildes so kennen, um be-
stimmt den Weg anzugeben, wie ein Fehler zu verbessern ist.
C 176 3
Beim Malen der Quelle (Petrarkabild): Eine frische
Quelle hat nicht die grünen Schleimfäden.
Es ist oft rätselhaft, wie manchmal ganz bestimmte
Gegenstände im Wasser sich mit Grün überziehen und andere
nicht. So werden z. B. Steine grün und ein Stock im Wasser
nicht; oder auch umgekehrt.
Kalkablagerung des Wassers an Steinen. Die Flechten
sind nur am oberen Teil der Steine, am unteren nicht, wo
das Wasser zurückgetreten ist. Da hat denn das Wasser ge-
wöhnlich eine weifse Kalkschicht zurückgelassen und bei
noch höherem Stand darüber eine andere dunkel violettgraue
(etwas grünlich).
Den Wasserfall hat Bücklin jetzt hinter den vorliegenden
Steinen versteckt angebracht. Er dürfte sich nicht präsentieren
und den Blick auf sich ziehen.
Klares Wasser drückt sich gerade durch scharfe Modellie-
rung der Gegenstände in ihm (der Steine und Wurzeln unter
der Oberfläche) aus. Sie müssen in sich fast so stark modelliert
sein, wie Gegenstände aufserhalb des Wassers, nur etwas
tiefer. Es ist daher praktisch, solches Quell- oder Bachbett
trocken zu malen und das Wasser mit einer dünnen warmen
Lasur (grünlich-bräunlich) darüber zu bringen.
Durch die trockne dürre Farbe des Grases unter den Lor-
beerstämmen erscheint das Wasser im Gegensatz glänzend
frisch. Dasselbe Gras dient dazu, das andere Ufer etwas zu
beschatten, damit es nicht so hart gegen das Wasser steht.
Mich störten an den Lorbeerstämmen die gelben und
roten Weinblätter und ich meinte, das liefse das nebenstehende
Grün der Ranke nicht zur Geltung kommen.
Bücklin sagte, das habe er gerade gewollt; dadurch er-
reiche er ein unbestimmtes Schimmern der Weinranken. Und
dafs seine Rechnung dabei richtig war, geht daraus hervor,
dafs ihn diese Blätter nötigten, in dem plastischen Heraus-
heben der umgebenden Gegenstände noch weiter zu gehen,
die Tiefen unter dem Wasserfall zu verstärken und die Lor-
beerbäume frischer und wirksamer hervorzuheben. Was solche
Konsequenzen hat, sei immer richtig.
23. August 66.
Böcklin hat sein Miserere weitergebildet. Der erste
Entwurf mit drei Lampen machte ihm zu sehr den Eindruck,
wie die Totenfeier eines Helden. Er hat jetzt nur eine Lampe
beigegeben und das Ganze fast ärmlich gehalten. Der Ent-
wurf ist auf blaues Papier mit Kohle gezeichnet, die bräun-
lich violett darauf aussieht. Auch ist die obere Schatten-
fläche damit angerieben. Die Lampe dunkel mit leuchtend
roter Flamme, damit das Uebrige matt wirkt. Den Christus-
Körper hatte er von dem Leichentuch (mit etwas weifser
Kreide) durch einen gelbgrauen Ton gesondert.
Das Auge soll zuerst in die Flamme sehen und dann,
fast davon geblendet, auf den Kopf des Christus, der im
Gegensatz dazu nur noch leichenhafter aussehen wird.
Böcklin sprach noch viel von der Leichenstarre, dafs diese
bei Kindern schon drei Stunden nach dem Tode, bei Erwach-
senen schon 5 — 6 Stunden nach dem Tode eintrete. Darum
müsse er auch dem Christus etwas hochgezogene Schultern
geben, sowie die Hände etwas steif in der Stellung malen,
wie sie ans Kreuz geheftet waren, und nicht schlaff fallend.
Die natürliche Lage der Beine ist etwas geknickt; es
kostet Muskelanstrengung, sie ganz zu strecken.
Der Leichnam dürfe nicht Ekel erregen, aber nur eine
gewisse Wahrheit wirkt ergreifend.
Wie Böcklin diese Skizze gezeichnet, so müsse er sie auch
malen, d. h. auf einen blaugrauen etwas dunkleren Grund;
und das Bild müsse sich in derselben Weise entwickeln.
Ueberhaupt müsse man so zeichnen, wie malen, und so
malen, wie zeichnen. Von dem Eindruck, der ihm bei seinem
Entwurf vorschwebte und der ihn leitete, sagte er, es sei der
Eindruck des wehmütigen Friedens in den Zügen eines edlen
Toten. ^
Benonville, der Böcklin heute besuchte, entmutigte
ihn anfangs sehr durch sein Mäkeln. So tadelte er den Dichter:
er müsse breitere Schultern und einen längeren Hals haben.
Böcklin aber meinte, Petrarka sei ein gedrungener Mann
gewesen, und da er sich im Kopf an Petrarka gehalten, müsse
auch die Gestalt diesen Charakter haben. Er habe sich (da
jeder unbewufst seine eigene Proportion in die darzustellende
Figur bringt), dazu zwingen müssen, sie so zu machen, um
ihr ein charakteristisches Aussehen zu geben.
Man müsse sich durch das Korrigieren Anderer nicht
beeinflussen lassen, aufser, wenn sie durch ihr Können weit
über Einem stehen, und auch dann könnten sie fast nur sagen,
es macht auf mich diesen oder jenen Eindruck. Ein Anderer
kann unmöglich die Mittel eines Bildes so kennen, um be-
stimmt den Weg anzugeben, wie ein Fehler zu verbessern ist.
C 176 3