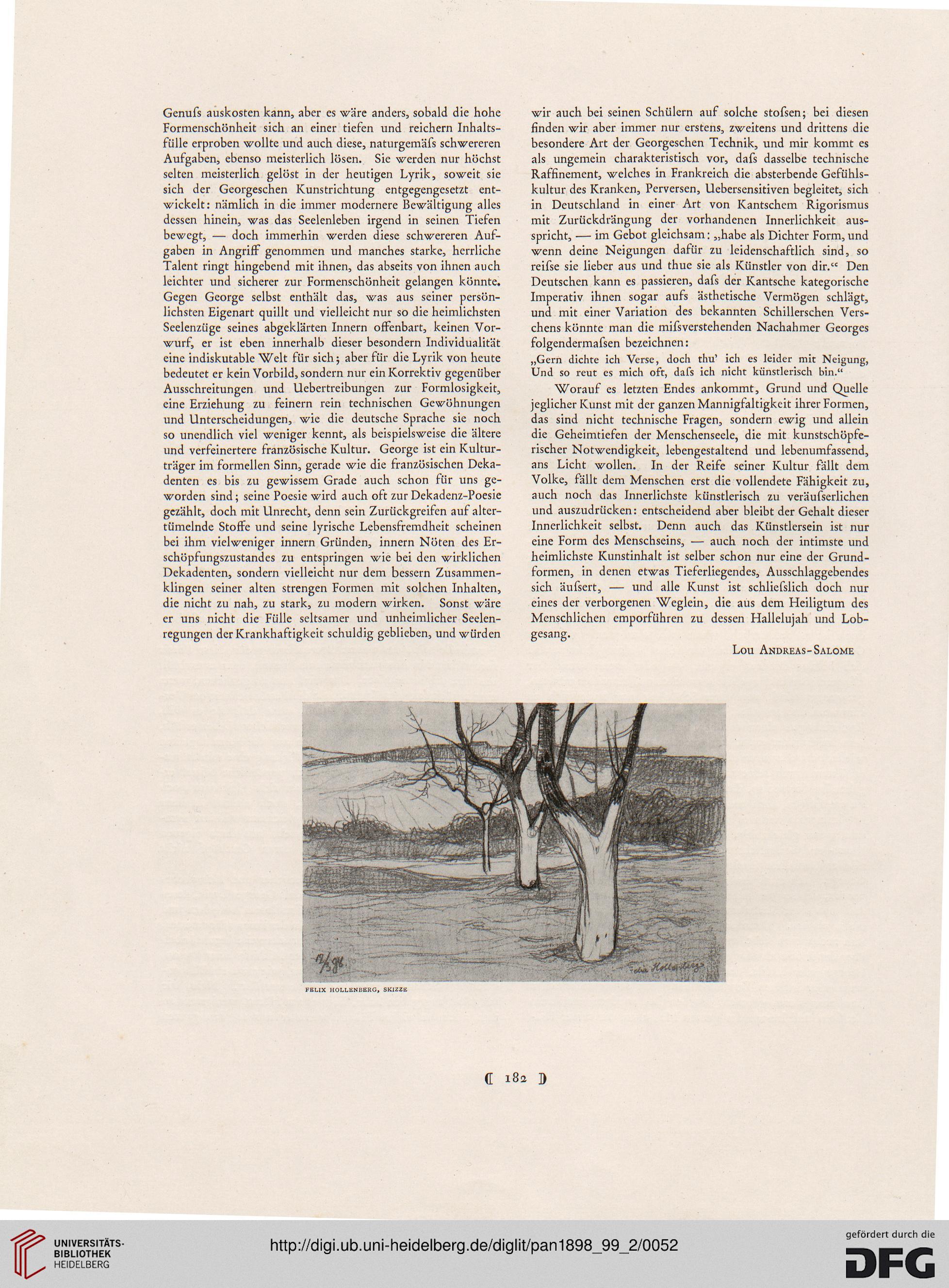Genufs auskosten kann, aber es wäre anders, sobald die hohe
Formenschönheit sich an einer tiefen und reichern Inhalts-
fülle erproben wollte und auch diese, naturgemäfs schwereren
Aufgaben, ebenso meisterlich lösen. Sie werden nur höchst
selten meisterlich gelöst in der heutigen Lyrik, soweit sie
sich der Georgeschen Kunstrichtung entgegengesetzt ent-
wickelt: nämlich in die immer modernere Bewältigung alles
dessen hinein, was das Seelenleben irgend in seinen Tiefen
bewegt, — doch immerhin werden diese schwereren Auf-
gaben in Angriff genommen und manches starke, herrliche
Talent ringt hingebend mit ihnen, das abseits von ihnen auch
leichter und sicherer zur Formenschönheit gelangen könnte.
Gegen George selbst enthält das, was aus seiner persön-
lichsten Eigenart quillt und vielleicht nur so die heimlichsten
Seelenzüge seines abgeklärten Innern offenbart, keinen Vor-
wurf, er ist eben innerhalb dieser besondern Individualität
eine indiskutable Welt für sich; aber für die Lyrik von heute
bedeutet er kein Vorbild, sondern nur ein Korrektiv gegenüber
Ausschreitungen und Uebertreibungen zur Formlosigkeit,
eine Erziehung zu feinern rein technischen Gewöhnungen
und Unterscheidungen, wie die deutsche Sprache sie noch
so unendlich viel weniger kennt, als beispielsweise die ältere
und verfeinertere französische Kultur. George ist ein Kultur-
träger im formellen Sinn, gerade wie die französischen Deka-
denten es bis zu gewissem Grade auch schon für uns ge-
worden sind; seine Poesie wird auch oft zur Dekadenz-Poesie
gezählt, doch mit Unrecht, denn sein Zurückgreifen auf alter-
tümelnde Stoffe und seine lyrische Lebensfremdheit scheinen
bei ihm viel weniger innern Gründen, innern Nöten des Er-
schöpfungszustandes zu entspringen wie bei den wirklichen
Dekadenten, sondern vielleicht nur dem bessern Zusammen-
klingen seiner alten strengen Formen mit solchen Inhalten,
die nicht zu nah, zu stark, zu modern wirken. Sonst wäre
er uns nicht die Fülle seltsamer und unheimlicher Seelen-
regungen der Krankhaftigkeit schuldig geblieben, und würden
wir auch bei seinen Schülern auf solche stofsen; bei diesen
finden wir aber immer nur erstens, zweitens und drittens die
besondere Art der Georgeschen Technik, und mir kommt es
als ungemein charakteristisch vor, dafs dasselbe technische
Raffinement, welches in Frankreich die absterbende Gefühls-
kultur des Kranken, Perversen, Uebersensitiven begleitet, sich
in Deutschland in einer Art von Kantschem Rigorismus
mit Zurückdrängung der vorhandenen Innerlichkeit aus-
spricht, — im Gebot gleichsam: „habe als Dichter Form, und
wenn deine Neigungen dafür zu leidenschaftlich sind, so
reifse sie lieber aus und thue sie als Künstler von dir." Den
Deutschen kann es passieren, dafs der Kantsche kategorische
Imperativ ihnen sogar aufs ästhetische Vermögen schlägt,
und mit einer Variation des bekannten Schillerschen Vers-
chens könnte man die mifsverstehenden Nachahmer Georges
folgendermafsen bezeichnen:
„Gern dichte ich Verse, doch thu' ich es leider mit Neigung,
Und so reut es mich oft, dafs ich nicht künstlerisch bin."
Worauf es letzten Endes ankommt, Grund und Quelle
jeglicher Kunst mit der ganzen Mannigfaltigkeit ihrer Formen,
das sind nicht technische Fragen, sondern ewig und allein
die Geheimtiefen der Menschenseele, die mit kunstschöpfe-
rischer Notwendigkeit, lebengestaltend und lebenumfassend,
ans Licht wollen. In der Reife seiner Kultur fällt dem
Volke, fällt dem Menschen erst die vollendete Fähigkeit zu,
auch noch das Innerlichste künstlerisch zu veräufserlichen
und auszudrücken: entscheidend aber bleibt der Gehalt dieser
Innerlichkeit selbst. Denn auch das Künstlersein ist nur
eine Form des Menschseins, — auch noch der intimste und
heimlichste Kunstinhalt ist selber schon nur eine der Grund-
formen, in denen etwas Tieferliegendes, Ausschlaggebendes
sich äufsert, — und alle Kunst ist schliefslich doch nur
eines der verborgenen Weglein, die aus dem Heiligtum des
Menschlichen emporführen zu dessen Hallelujah und Lob-
gesang.
Lou Andreas-Salome
FELIX HOLLENBERG, SKIZZE
C 18a D
Formenschönheit sich an einer tiefen und reichern Inhalts-
fülle erproben wollte und auch diese, naturgemäfs schwereren
Aufgaben, ebenso meisterlich lösen. Sie werden nur höchst
selten meisterlich gelöst in der heutigen Lyrik, soweit sie
sich der Georgeschen Kunstrichtung entgegengesetzt ent-
wickelt: nämlich in die immer modernere Bewältigung alles
dessen hinein, was das Seelenleben irgend in seinen Tiefen
bewegt, — doch immerhin werden diese schwereren Auf-
gaben in Angriff genommen und manches starke, herrliche
Talent ringt hingebend mit ihnen, das abseits von ihnen auch
leichter und sicherer zur Formenschönheit gelangen könnte.
Gegen George selbst enthält das, was aus seiner persön-
lichsten Eigenart quillt und vielleicht nur so die heimlichsten
Seelenzüge seines abgeklärten Innern offenbart, keinen Vor-
wurf, er ist eben innerhalb dieser besondern Individualität
eine indiskutable Welt für sich; aber für die Lyrik von heute
bedeutet er kein Vorbild, sondern nur ein Korrektiv gegenüber
Ausschreitungen und Uebertreibungen zur Formlosigkeit,
eine Erziehung zu feinern rein technischen Gewöhnungen
und Unterscheidungen, wie die deutsche Sprache sie noch
so unendlich viel weniger kennt, als beispielsweise die ältere
und verfeinertere französische Kultur. George ist ein Kultur-
träger im formellen Sinn, gerade wie die französischen Deka-
denten es bis zu gewissem Grade auch schon für uns ge-
worden sind; seine Poesie wird auch oft zur Dekadenz-Poesie
gezählt, doch mit Unrecht, denn sein Zurückgreifen auf alter-
tümelnde Stoffe und seine lyrische Lebensfremdheit scheinen
bei ihm viel weniger innern Gründen, innern Nöten des Er-
schöpfungszustandes zu entspringen wie bei den wirklichen
Dekadenten, sondern vielleicht nur dem bessern Zusammen-
klingen seiner alten strengen Formen mit solchen Inhalten,
die nicht zu nah, zu stark, zu modern wirken. Sonst wäre
er uns nicht die Fülle seltsamer und unheimlicher Seelen-
regungen der Krankhaftigkeit schuldig geblieben, und würden
wir auch bei seinen Schülern auf solche stofsen; bei diesen
finden wir aber immer nur erstens, zweitens und drittens die
besondere Art der Georgeschen Technik, und mir kommt es
als ungemein charakteristisch vor, dafs dasselbe technische
Raffinement, welches in Frankreich die absterbende Gefühls-
kultur des Kranken, Perversen, Uebersensitiven begleitet, sich
in Deutschland in einer Art von Kantschem Rigorismus
mit Zurückdrängung der vorhandenen Innerlichkeit aus-
spricht, — im Gebot gleichsam: „habe als Dichter Form, und
wenn deine Neigungen dafür zu leidenschaftlich sind, so
reifse sie lieber aus und thue sie als Künstler von dir." Den
Deutschen kann es passieren, dafs der Kantsche kategorische
Imperativ ihnen sogar aufs ästhetische Vermögen schlägt,
und mit einer Variation des bekannten Schillerschen Vers-
chens könnte man die mifsverstehenden Nachahmer Georges
folgendermafsen bezeichnen:
„Gern dichte ich Verse, doch thu' ich es leider mit Neigung,
Und so reut es mich oft, dafs ich nicht künstlerisch bin."
Worauf es letzten Endes ankommt, Grund und Quelle
jeglicher Kunst mit der ganzen Mannigfaltigkeit ihrer Formen,
das sind nicht technische Fragen, sondern ewig und allein
die Geheimtiefen der Menschenseele, die mit kunstschöpfe-
rischer Notwendigkeit, lebengestaltend und lebenumfassend,
ans Licht wollen. In der Reife seiner Kultur fällt dem
Volke, fällt dem Menschen erst die vollendete Fähigkeit zu,
auch noch das Innerlichste künstlerisch zu veräufserlichen
und auszudrücken: entscheidend aber bleibt der Gehalt dieser
Innerlichkeit selbst. Denn auch das Künstlersein ist nur
eine Form des Menschseins, — auch noch der intimste und
heimlichste Kunstinhalt ist selber schon nur eine der Grund-
formen, in denen etwas Tieferliegendes, Ausschlaggebendes
sich äufsert, — und alle Kunst ist schliefslich doch nur
eines der verborgenen Weglein, die aus dem Heiligtum des
Menschlichen emporführen zu dessen Hallelujah und Lob-
gesang.
Lou Andreas-Salome
FELIX HOLLENBERG, SKIZZE
C 18a D