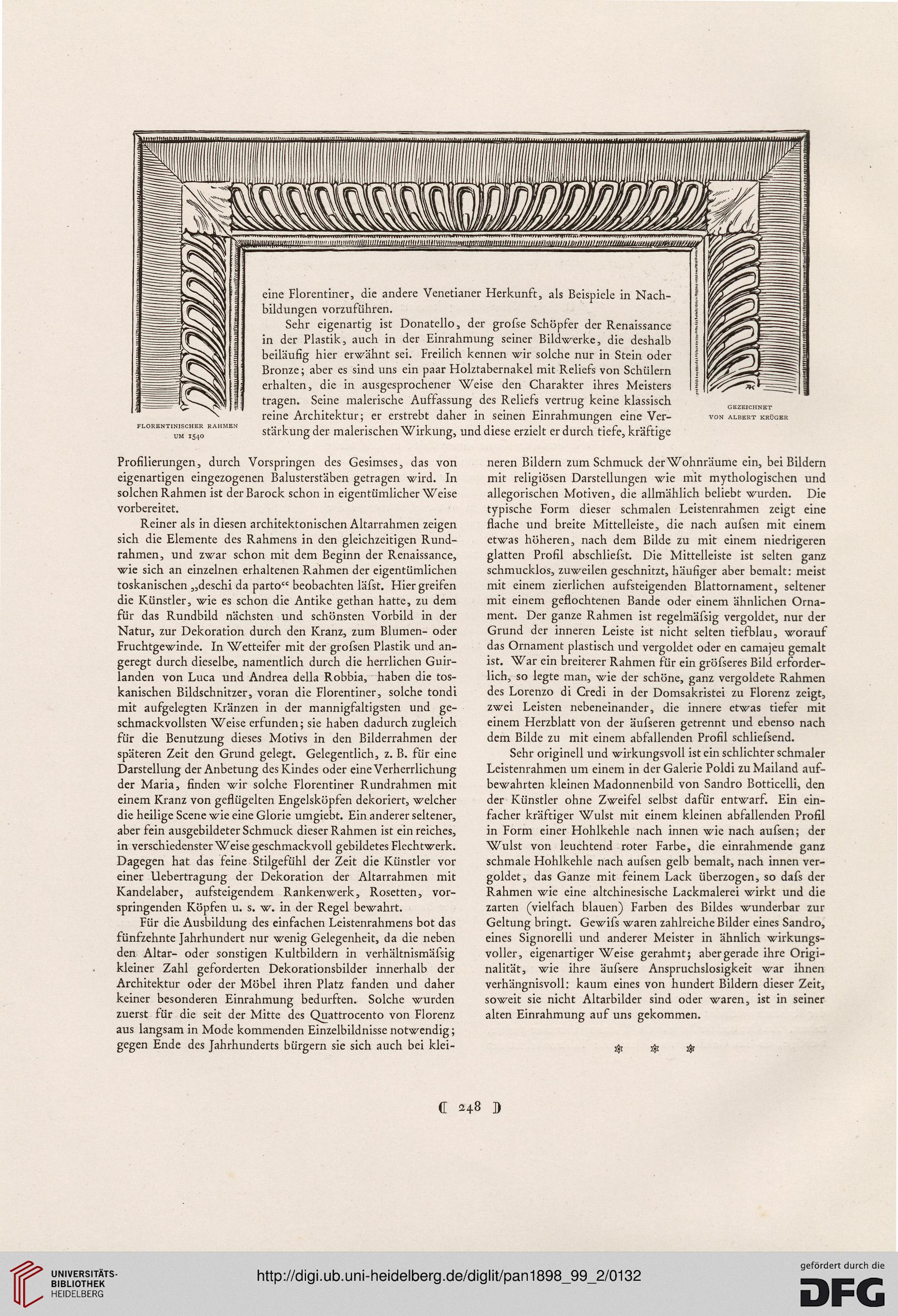'.......■......mm......inmmminmw>unnmn»mMmi'»'immwimimin'iuin«iiHin.........minimumi.....fniinwtffifjiH^.jiii.....tmwinin„nwwmniinH)im/lMn
FLORENTINISCHER RAHMEN
UM 1540
eine Florentiner, die andere Venetianer Herkunft, als Beispiele in Nach-
bildungen vorzuführen.
Sehr eigenartig ist Donatello, der grofse Schöpfer der Renaissance
in der Plastik, auch in der Einrahmung seiner Bildwerke, die deshalb
beiläufig hier erwähnt sei. Freilich kennen wir solche nur in Stein oder
Bronze; aber es sind uns ein paar Holztabernakel mit Reliefs von Schülern
erhalten, die in ausgesprochener Weise den Charakter ihres Meisters
tragen. Seine malerische Auffassung des Reliefs vertrug keine klassisch
reine Architektur; er erstrebt daher in seinen Einrahmungen eine Ver-
stärkung der malerischen Wirkung, und diese erzielt er durch tiefe, kräftige
GEZEICHNET
VON ALBERT KRÜGER
Profilierungen, durch Vorspringen des Gesimses, das von
eigenartigen eingezogenen Balusterstäben getragen wird. In
solchen Rahmen ist der Barock schon in eigentümlicher Weise
vorbereitet.
Reiner als in diesen architektonischen Altarrahmen zeigen
sich die Elemente des Rahmens in den gleichzeitigen Rund-
rahmen, und zwar schon mit dem Beginn der Renaissance,
wie sich an einzelnen erhaltenen Rahmen der eigentümlichen
toskanischen „deschi da parto" beobachten läfst. Hier greifen
die Künstler, wie es schon die Antike gethan hatte, zu dem
für das Rundbild nächsten und schönsten Vorbild in der
Natur, zur Dekoration durch den Kranz, zum Blumen- oder
Fruchtgewinde. In Wetteifer mit der grofsen Plastik und an-
geregt durch dieselbe, namentlich durch die herrlichen Guir-
landen von Luca und Andrea della Robbia, haben die tos-
kanischen Bildschnitzer, voran die Florentiner, solche tondi
mit aufgelegten Kränzen in der mannigfaltigsten und ge-
schmackvollsten Weise erfunden; sie haben dadurch zugleich
für die Benutzung dieses Motivs in den Bilderrahmen der
späteren Zeit den Grund gelegt. Gelegentlich, z. B. für eine
Darstellung der Anbetung des Kindes oder eine Verherrlichung
der Maria, finden wir solche Florentiner Rundrahmen mit
einem Kranz von geflügelten Engelsköpfen dekoriert, welcher
die heilige Scene wie eine Glorie umgiebt. Ein anderer seltener,
aber fein ausgebildeter Schmuck dieser Rahmen ist ein reiches,
in verschiedensterWeise geschmackvoll gebildetes Flechtwerk.
Dagegen hat das feine Stilgefühl der Zeit die Künstler vor
einer Uebertragung der Dekoration der Altarrahmen mit
Kandelaber, aufsteigendem Rankenwerk, Rosetten, vor-
springenden Köpfen u. s. w. in der Regel bewahrt.
Für die Ausbildung des einfachen Leistenrahmens bot das
fünfzehnte Jahrhundert nur wenig Gelegenheit, da die neben
den Altar- oder sonstigen Kultbildern in verhältnismäfsig
kleiner Zahl geforderten Dekorationsbilder innerhalb der
Architektur oder der Möbel ihren Platz fanden und daher
keiner besonderen Einrahmung bedurften. Solche wurden
zuerst für die seit der Mitte des Quattrocento von Florenz
aus langsam in Mode kommenden Einzelbildnisse notwendig;
gegen Ende des Jahrhunderts bürgern sie sich auch bei klei-
neren Bildern zum Schmuck der Wohnräume ein, bei Bildern
mit religiösen Darstellungen wie mit mythologischen und
allegorischen Motiven, die allmählich beliebt wurden. Die
typische Form dieser schmalen Leistenrahmen zeigt eine
flache und breite Mittelleiste, die nach aufsen mit einem
etwas höheren, nach dem Bilde zu mit einem niedrigeren
glatten Profil abschliefst. Die Mittelleiste ist selten ganz
schmucklos, zuweilen geschnitzt, häufiger aber bemalt: meist
mit einem zierlichen aufsteigenden Blattornament, seltener
mit einem geflochtenen Bande oder einem ähnlichen Orna-
ment. Der ganze Rahmen ist regelmäfsig vergoldet, nur der
Grund der inneren Leiste ist nicht selten tiefblau, worauf
das Ornament plastisch und vergoldet oder en camajeu gemalt
ist. War ein breiterer Rahmen für ein gröfseres Bild erforder-
lich, so legte man, wie der schöne, ganz vergoldete Rahmen
des Lorenzo di Credi in der Domsakristei zu Florenz zeigt,
zwei Leisten nebeneinander, die innere etwas tiefer mit
einem Herzblatt von der äufseren getrennt und ebenso nach
dem Bilde zu mit einem abfallenden Profil schliefsend.
Sehr originell und wirkungsvoll ist ein schlichter schmaler
Leistenrahmen um einem in der Galerie Poldi zu Mailand auf-
bewahrten kleinen Madonnenbild von Sandro Botticelli, den
der Künstler ohne Zweifel selbst dafür entwarf. Ein ein-
facher kräftiger Wulst mit einem kleinen abfallenden Profil
in Form einer Hohlkehle nach innen wie nach aufsen; der
Wulst von leuchtend roter Farbe, die einrahmende ganz
schmale Hohlkehle nach aufsen gelb bemalt, nach innen ver-
goldet, das Ganze mit feinem Lack überzogen, so dafs der
Rahmen wie eine altchinesische Lackmalerei wirkt und die
zarten (vielfach blauen) Farben des Bildes wunderbar zur
Geltung bringt. Gewifs waren zahlreiche Bilder eines Sandro,
eines Signorelli und anderer Meister in ähnlich wirkungs-
voller, eigenartiger Weise gerahmt; aber gerade ihre Origi-
nalität, wie ihre äufsere Anspruchslosigkeit war ihnen
verhängnisvoll: kaum eines von hundert Bildern dieser Zeit,
soweit sie nicht Altarbilder sind oder waren, ist in seiner
alten Einrahmung auf uns gekommen.
C 248 D
FLORENTINISCHER RAHMEN
UM 1540
eine Florentiner, die andere Venetianer Herkunft, als Beispiele in Nach-
bildungen vorzuführen.
Sehr eigenartig ist Donatello, der grofse Schöpfer der Renaissance
in der Plastik, auch in der Einrahmung seiner Bildwerke, die deshalb
beiläufig hier erwähnt sei. Freilich kennen wir solche nur in Stein oder
Bronze; aber es sind uns ein paar Holztabernakel mit Reliefs von Schülern
erhalten, die in ausgesprochener Weise den Charakter ihres Meisters
tragen. Seine malerische Auffassung des Reliefs vertrug keine klassisch
reine Architektur; er erstrebt daher in seinen Einrahmungen eine Ver-
stärkung der malerischen Wirkung, und diese erzielt er durch tiefe, kräftige
GEZEICHNET
VON ALBERT KRÜGER
Profilierungen, durch Vorspringen des Gesimses, das von
eigenartigen eingezogenen Balusterstäben getragen wird. In
solchen Rahmen ist der Barock schon in eigentümlicher Weise
vorbereitet.
Reiner als in diesen architektonischen Altarrahmen zeigen
sich die Elemente des Rahmens in den gleichzeitigen Rund-
rahmen, und zwar schon mit dem Beginn der Renaissance,
wie sich an einzelnen erhaltenen Rahmen der eigentümlichen
toskanischen „deschi da parto" beobachten läfst. Hier greifen
die Künstler, wie es schon die Antike gethan hatte, zu dem
für das Rundbild nächsten und schönsten Vorbild in der
Natur, zur Dekoration durch den Kranz, zum Blumen- oder
Fruchtgewinde. In Wetteifer mit der grofsen Plastik und an-
geregt durch dieselbe, namentlich durch die herrlichen Guir-
landen von Luca und Andrea della Robbia, haben die tos-
kanischen Bildschnitzer, voran die Florentiner, solche tondi
mit aufgelegten Kränzen in der mannigfaltigsten und ge-
schmackvollsten Weise erfunden; sie haben dadurch zugleich
für die Benutzung dieses Motivs in den Bilderrahmen der
späteren Zeit den Grund gelegt. Gelegentlich, z. B. für eine
Darstellung der Anbetung des Kindes oder eine Verherrlichung
der Maria, finden wir solche Florentiner Rundrahmen mit
einem Kranz von geflügelten Engelsköpfen dekoriert, welcher
die heilige Scene wie eine Glorie umgiebt. Ein anderer seltener,
aber fein ausgebildeter Schmuck dieser Rahmen ist ein reiches,
in verschiedensterWeise geschmackvoll gebildetes Flechtwerk.
Dagegen hat das feine Stilgefühl der Zeit die Künstler vor
einer Uebertragung der Dekoration der Altarrahmen mit
Kandelaber, aufsteigendem Rankenwerk, Rosetten, vor-
springenden Köpfen u. s. w. in der Regel bewahrt.
Für die Ausbildung des einfachen Leistenrahmens bot das
fünfzehnte Jahrhundert nur wenig Gelegenheit, da die neben
den Altar- oder sonstigen Kultbildern in verhältnismäfsig
kleiner Zahl geforderten Dekorationsbilder innerhalb der
Architektur oder der Möbel ihren Platz fanden und daher
keiner besonderen Einrahmung bedurften. Solche wurden
zuerst für die seit der Mitte des Quattrocento von Florenz
aus langsam in Mode kommenden Einzelbildnisse notwendig;
gegen Ende des Jahrhunderts bürgern sie sich auch bei klei-
neren Bildern zum Schmuck der Wohnräume ein, bei Bildern
mit religiösen Darstellungen wie mit mythologischen und
allegorischen Motiven, die allmählich beliebt wurden. Die
typische Form dieser schmalen Leistenrahmen zeigt eine
flache und breite Mittelleiste, die nach aufsen mit einem
etwas höheren, nach dem Bilde zu mit einem niedrigeren
glatten Profil abschliefst. Die Mittelleiste ist selten ganz
schmucklos, zuweilen geschnitzt, häufiger aber bemalt: meist
mit einem zierlichen aufsteigenden Blattornament, seltener
mit einem geflochtenen Bande oder einem ähnlichen Orna-
ment. Der ganze Rahmen ist regelmäfsig vergoldet, nur der
Grund der inneren Leiste ist nicht selten tiefblau, worauf
das Ornament plastisch und vergoldet oder en camajeu gemalt
ist. War ein breiterer Rahmen für ein gröfseres Bild erforder-
lich, so legte man, wie der schöne, ganz vergoldete Rahmen
des Lorenzo di Credi in der Domsakristei zu Florenz zeigt,
zwei Leisten nebeneinander, die innere etwas tiefer mit
einem Herzblatt von der äufseren getrennt und ebenso nach
dem Bilde zu mit einem abfallenden Profil schliefsend.
Sehr originell und wirkungsvoll ist ein schlichter schmaler
Leistenrahmen um einem in der Galerie Poldi zu Mailand auf-
bewahrten kleinen Madonnenbild von Sandro Botticelli, den
der Künstler ohne Zweifel selbst dafür entwarf. Ein ein-
facher kräftiger Wulst mit einem kleinen abfallenden Profil
in Form einer Hohlkehle nach innen wie nach aufsen; der
Wulst von leuchtend roter Farbe, die einrahmende ganz
schmale Hohlkehle nach aufsen gelb bemalt, nach innen ver-
goldet, das Ganze mit feinem Lack überzogen, so dafs der
Rahmen wie eine altchinesische Lackmalerei wirkt und die
zarten (vielfach blauen) Farben des Bildes wunderbar zur
Geltung bringt. Gewifs waren zahlreiche Bilder eines Sandro,
eines Signorelli und anderer Meister in ähnlich wirkungs-
voller, eigenartiger Weise gerahmt; aber gerade ihre Origi-
nalität, wie ihre äufsere Anspruchslosigkeit war ihnen
verhängnisvoll: kaum eines von hundert Bildern dieser Zeit,
soweit sie nicht Altarbilder sind oder waren, ist in seiner
alten Einrahmung auf uns gekommen.
C 248 D