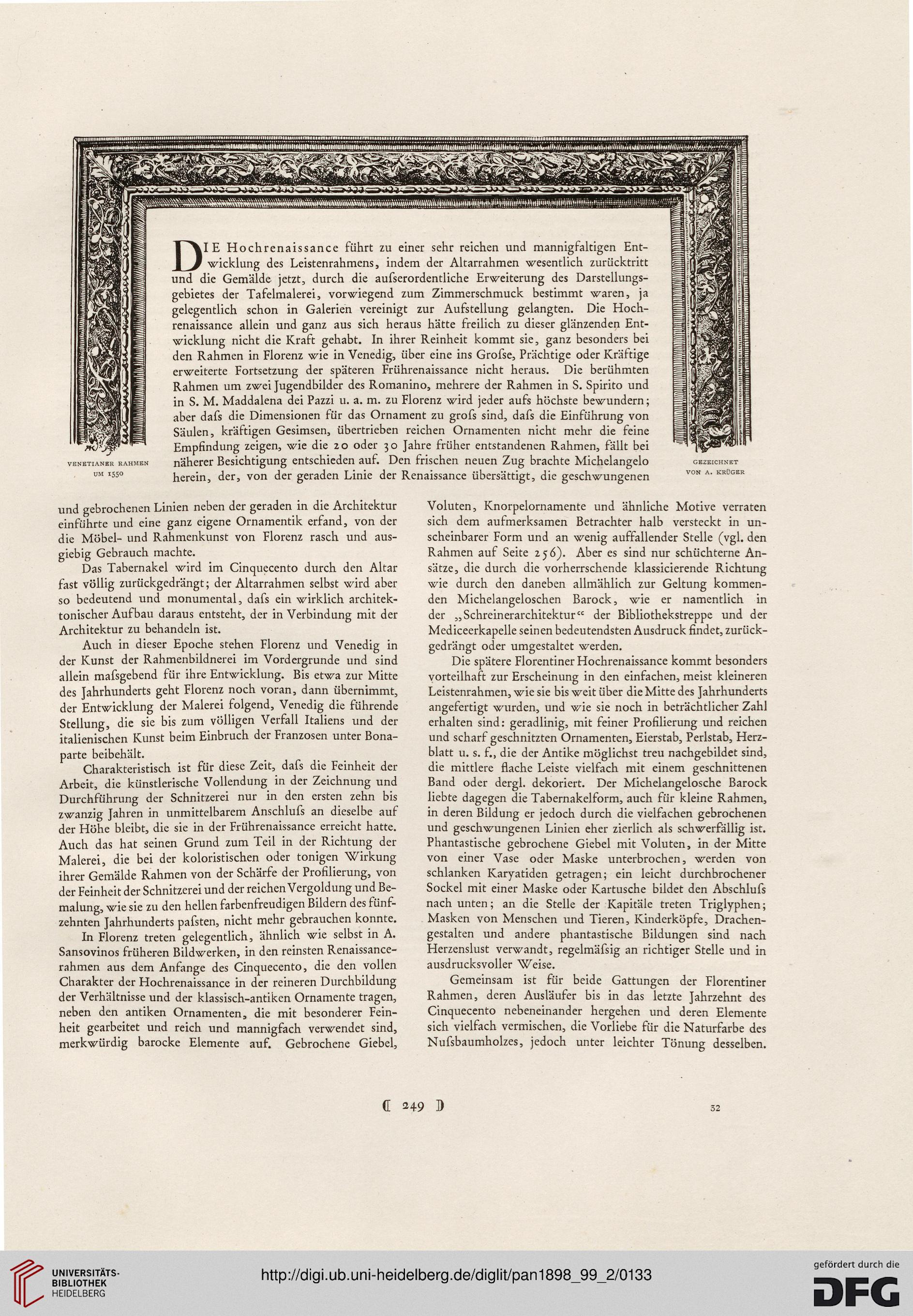mÄ'M'Ä,;'««
VENETIANHR RAHMEN
UM 1550
DIE Hochrenaissance führt zu einer sehr reichen und mannigfaltigen Ent-
wicklung des Leistenrahmens, indem der Altarrahmen wesentlich zurücktritt
und die Gemälde jetzt, durch die aufserordentliche Erweiterung des Darstellungs-
gebietes der Tafelmalerei, vorwiegend zum Zimmerschmuck bestimmt waren, ja
gelegentlich schon in Galerien vereinigt zur Aufstellung gelangten. Die Hoch-
renaissance allein und ganz aus sich heraus hätte freilich zu dieser glänzenden Ent-
wicklung nicht die Kraft gehabt. In ihrer Reinheit kommt sie, ganz besonders bei
den Rahmen in Florenz wie in Venedig, über eine ins Grofse, Prächtige oder Kräftige
erweiterte Fortsetzung der späteren Frührenaissance nicht heraus. Die berühmten
Rahmen um zwei Jugendbilder des Romanino, mehrere der Rahmen in S. Spirito und
in S. M. Maddalena dei Pazzi u. a. m. zu Florenz wird jeder aufs höchste bewundern;
aber dafs die Dimensionen für das Ornament zu grofs sind, dafs die Einführung von
Säulen, kräftigen Gesimsen, übertrieben reichen Ornamenten nicht mehr die feine
Empfindung zeigen, wie die 20 oder 30 Jahre früher entstandenen Rahmen, fällt bei
näherer Besichtigung entschieden auf. Den frischen neuen Zug brachte Michelangelo
herein, der, von der geraden Linie der Renaissance übersättigt, die geschwungenen
GEZEICHNET
VON A. KRÜGER
und gebrochenen Linien neben der geraden in die Architektur
einführte und eine ganz eigene Ornamentik erfand, von der
die Möbel- und Rahmenkunst von Florenz rasch und aus-
giebig Gebrauch machte.
Das Tabernakel wird im Cinquecento durch den Altar
fast völlig zurückgedrängt; der Altarrahmen selbst wird aber
so bedeutend und monumental, dafs ein wirklich architek-
tonischer Aufbau daraus entsteht, der in Verbindung mit der
Architektur zu behandeln ist.
Auch in dieser Epoche stehen Florenz und Venedig in
der Kunst der Rahmenbildnerei im Vordergrunde und sind
allein mafsgebend für ihre Entwicklung. Bis etwa zur Mitte
des Jahrhunderts geht Florenz noch voran, dann übernimmt,
der Entwicklung der Malerei folgend, Venedig die führende
Stellung, die sie bis zum völligen Verfall Italiens und der
italienischen Kunst beim Einbruch der Franzosen unter Bona-
parte beibehält.
Charakteristisch ist für diese Zeit, dafs die Feinheit der
Arbeit, die künstlerische Vollendung in der Zeichnung und
Durchführung der Schnitzerei nur in den ersten zehn bis
zwanzig Jahren in unmittelbarem Anschlufs an dieselbe auf
der Höhe bleibt, die sie in der Frührenaissance erreicht hatte.
Auch das hat seinen Grund zum Teil in der Richtung der
Malerei, die bei der koloristischen oder tonigen Wirkung
ihrer Gemälde Rahmen von der Schärfe der Profilierung, von
der Feinheit der Schnitzerei und der reichen Vergoldung und Be-
malung, wie sie zu den hellen farbenfreudigen Bildern des fünf-
zehnten Jahrhunderts pafsten, nicht mehr gebrauchen konnte.
In Florenz treten gelegentlich, ähnlich wie selbst in A.
Sansovinos früheren Bildwerken, in den reinsten Renaissance-
rahmen aus dem Anfange des Cinquecento, die den vollen
Charakter der Hochrenaissance in der reineren Durchbildung
der Verhältnisse und der klassisch-antiken Ornamente tragen,
neben den antiken Ornamenten, die mit besonderer Fein-
heit gearbeitet und reich und mannigfach verwendet sind,
merkwürdig barocke Elemente auf. Gebrochene Giebel,
Voluten, Knorpelornamente und ähnliche Motive verraten
sich dem aufmerksamen Betrachter halb versteckt in un-
scheinbarer Form und an wenig auffallender Stelle (vgl. den
Rahmen auf Seite 256). Aber es sind nur schüchterne An-
sätze, die durch die vorherrschende klassicierende Richtung
wie durch den daneben allmählich zur Geltung kommen-
den Michelangeloschen Barock, wie er namentlich in
der „Schreinerarchitektur" der Bibliothekstreppe und der
Mediceerkapelle seinen bedeutendsten Ausdruck findet, zurück-
gedrängt oder umgestaltet werden.
Die spätere Florentiner Hochrenaissance kommt besonders
vorteilhaft zur Erscheinung in den einfachen, meist kleineren
Leistenrahmen, wie sie bis weit über die Mitte des Jahrhunderts
angefertigt wurden, und wie sie noch in beträchtlicher Zahl
erhalten sind: geradlinig, mit feiner Profilierung und reichen
und scharf geschnitzten Ornamenten, Eierstab, Perlstab, Herz-
blatt u. s. f., die der Antike möglichst treu nachgebildet sind,
die mittlere flache Leiste vielfach mit einem geschnittenen
Band oder dergl. dekoriert. Der Michelangelosche Barock
liebte dagegen die Tabernakelform, auch für kleine Rahmen,
in deren Bildung er jedoch durch die vielfachen gebrochenen
und geschwungenen Linien eher zierlich als schwerfällig ist.
Phantastische gebrochene Giebel mit Voluten, in der Mitte
von einer Vase oder Maske unterbrochen, werden von
schlanken Karyatiden getragen; ein leicht durchbrochener
Sockel mit einer Maske oder Kartusche bildet den Abschlufs
nach unten; an die Stelle der Kapitale treten Triglyphen;
Masken von Menschen und Tieren, Kinderköpfe, Drachen-
gestalten und andere phantastische Bildungen sind nach
Herzenslust verwandt, regelmäfsig an richtiger Stelle und in
ausdrucksvoller Weise.
Gemeinsam ist für beide Gattungen der Florentiner
Rahmen, deren Ausläufer bis in das letzte Jahrzehnt des
Cinquecento nebeneinander hergehen und deren Elemente
sich vielfach vermischen, die Vorliebe für die Naturfarbe des
Nufsbaumholzes, jedoch unter leichter Tönung desselben.
C 249 ])
32
VENETIANHR RAHMEN
UM 1550
DIE Hochrenaissance führt zu einer sehr reichen und mannigfaltigen Ent-
wicklung des Leistenrahmens, indem der Altarrahmen wesentlich zurücktritt
und die Gemälde jetzt, durch die aufserordentliche Erweiterung des Darstellungs-
gebietes der Tafelmalerei, vorwiegend zum Zimmerschmuck bestimmt waren, ja
gelegentlich schon in Galerien vereinigt zur Aufstellung gelangten. Die Hoch-
renaissance allein und ganz aus sich heraus hätte freilich zu dieser glänzenden Ent-
wicklung nicht die Kraft gehabt. In ihrer Reinheit kommt sie, ganz besonders bei
den Rahmen in Florenz wie in Venedig, über eine ins Grofse, Prächtige oder Kräftige
erweiterte Fortsetzung der späteren Frührenaissance nicht heraus. Die berühmten
Rahmen um zwei Jugendbilder des Romanino, mehrere der Rahmen in S. Spirito und
in S. M. Maddalena dei Pazzi u. a. m. zu Florenz wird jeder aufs höchste bewundern;
aber dafs die Dimensionen für das Ornament zu grofs sind, dafs die Einführung von
Säulen, kräftigen Gesimsen, übertrieben reichen Ornamenten nicht mehr die feine
Empfindung zeigen, wie die 20 oder 30 Jahre früher entstandenen Rahmen, fällt bei
näherer Besichtigung entschieden auf. Den frischen neuen Zug brachte Michelangelo
herein, der, von der geraden Linie der Renaissance übersättigt, die geschwungenen
GEZEICHNET
VON A. KRÜGER
und gebrochenen Linien neben der geraden in die Architektur
einführte und eine ganz eigene Ornamentik erfand, von der
die Möbel- und Rahmenkunst von Florenz rasch und aus-
giebig Gebrauch machte.
Das Tabernakel wird im Cinquecento durch den Altar
fast völlig zurückgedrängt; der Altarrahmen selbst wird aber
so bedeutend und monumental, dafs ein wirklich architek-
tonischer Aufbau daraus entsteht, der in Verbindung mit der
Architektur zu behandeln ist.
Auch in dieser Epoche stehen Florenz und Venedig in
der Kunst der Rahmenbildnerei im Vordergrunde und sind
allein mafsgebend für ihre Entwicklung. Bis etwa zur Mitte
des Jahrhunderts geht Florenz noch voran, dann übernimmt,
der Entwicklung der Malerei folgend, Venedig die führende
Stellung, die sie bis zum völligen Verfall Italiens und der
italienischen Kunst beim Einbruch der Franzosen unter Bona-
parte beibehält.
Charakteristisch ist für diese Zeit, dafs die Feinheit der
Arbeit, die künstlerische Vollendung in der Zeichnung und
Durchführung der Schnitzerei nur in den ersten zehn bis
zwanzig Jahren in unmittelbarem Anschlufs an dieselbe auf
der Höhe bleibt, die sie in der Frührenaissance erreicht hatte.
Auch das hat seinen Grund zum Teil in der Richtung der
Malerei, die bei der koloristischen oder tonigen Wirkung
ihrer Gemälde Rahmen von der Schärfe der Profilierung, von
der Feinheit der Schnitzerei und der reichen Vergoldung und Be-
malung, wie sie zu den hellen farbenfreudigen Bildern des fünf-
zehnten Jahrhunderts pafsten, nicht mehr gebrauchen konnte.
In Florenz treten gelegentlich, ähnlich wie selbst in A.
Sansovinos früheren Bildwerken, in den reinsten Renaissance-
rahmen aus dem Anfange des Cinquecento, die den vollen
Charakter der Hochrenaissance in der reineren Durchbildung
der Verhältnisse und der klassisch-antiken Ornamente tragen,
neben den antiken Ornamenten, die mit besonderer Fein-
heit gearbeitet und reich und mannigfach verwendet sind,
merkwürdig barocke Elemente auf. Gebrochene Giebel,
Voluten, Knorpelornamente und ähnliche Motive verraten
sich dem aufmerksamen Betrachter halb versteckt in un-
scheinbarer Form und an wenig auffallender Stelle (vgl. den
Rahmen auf Seite 256). Aber es sind nur schüchterne An-
sätze, die durch die vorherrschende klassicierende Richtung
wie durch den daneben allmählich zur Geltung kommen-
den Michelangeloschen Barock, wie er namentlich in
der „Schreinerarchitektur" der Bibliothekstreppe und der
Mediceerkapelle seinen bedeutendsten Ausdruck findet, zurück-
gedrängt oder umgestaltet werden.
Die spätere Florentiner Hochrenaissance kommt besonders
vorteilhaft zur Erscheinung in den einfachen, meist kleineren
Leistenrahmen, wie sie bis weit über die Mitte des Jahrhunderts
angefertigt wurden, und wie sie noch in beträchtlicher Zahl
erhalten sind: geradlinig, mit feiner Profilierung und reichen
und scharf geschnitzten Ornamenten, Eierstab, Perlstab, Herz-
blatt u. s. f., die der Antike möglichst treu nachgebildet sind,
die mittlere flache Leiste vielfach mit einem geschnittenen
Band oder dergl. dekoriert. Der Michelangelosche Barock
liebte dagegen die Tabernakelform, auch für kleine Rahmen,
in deren Bildung er jedoch durch die vielfachen gebrochenen
und geschwungenen Linien eher zierlich als schwerfällig ist.
Phantastische gebrochene Giebel mit Voluten, in der Mitte
von einer Vase oder Maske unterbrochen, werden von
schlanken Karyatiden getragen; ein leicht durchbrochener
Sockel mit einer Maske oder Kartusche bildet den Abschlufs
nach unten; an die Stelle der Kapitale treten Triglyphen;
Masken von Menschen und Tieren, Kinderköpfe, Drachen-
gestalten und andere phantastische Bildungen sind nach
Herzenslust verwandt, regelmäfsig an richtiger Stelle und in
ausdrucksvoller Weise.
Gemeinsam ist für beide Gattungen der Florentiner
Rahmen, deren Ausläufer bis in das letzte Jahrzehnt des
Cinquecento nebeneinander hergehen und deren Elemente
sich vielfach vermischen, die Vorliebe für die Naturfarbe des
Nufsbaumholzes, jedoch unter leichter Tönung desselben.
C 249 ])
32