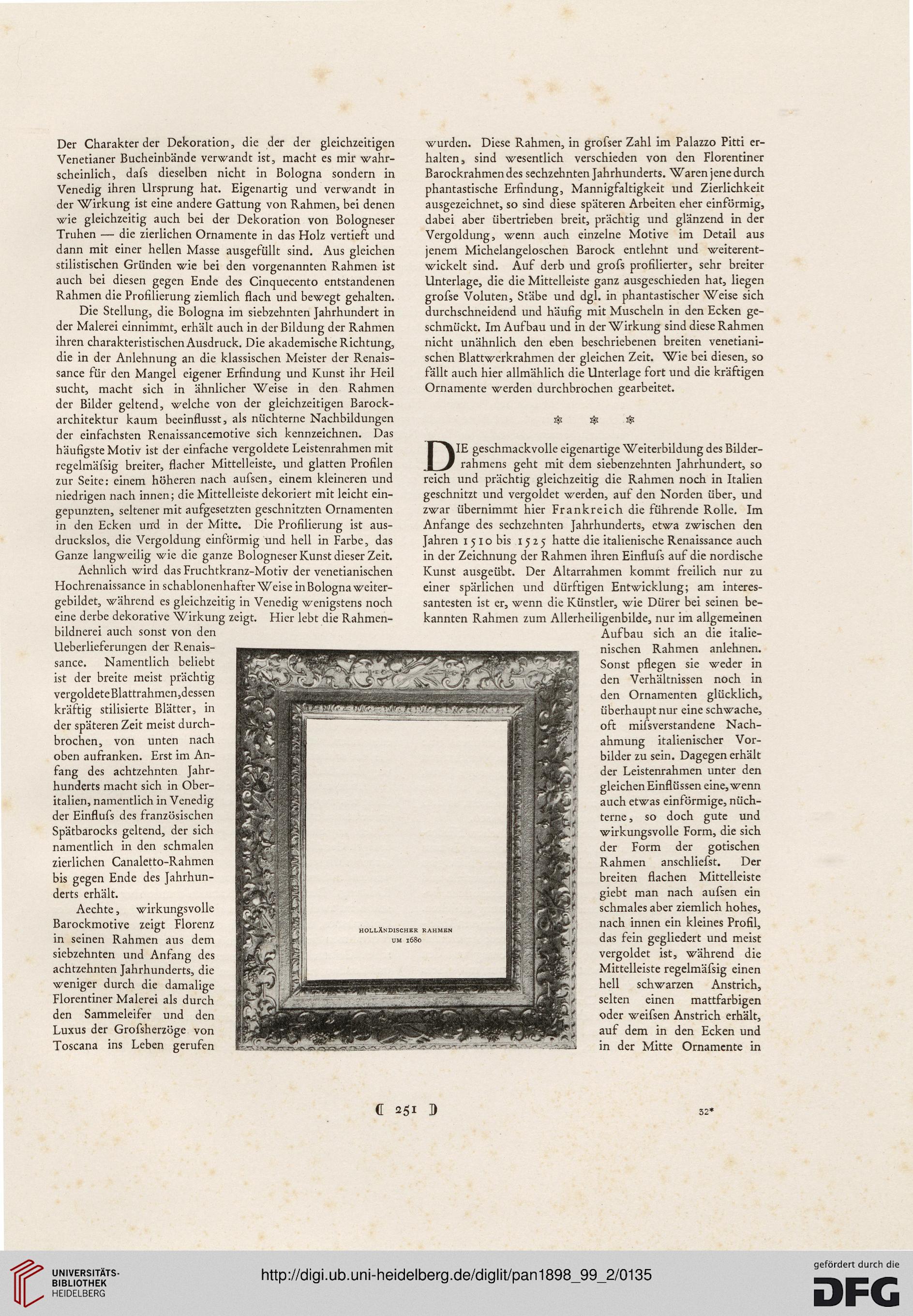Der Charakter der Dekoration, die der der gleichzeitigen
Venetianer Bucheinbände verwandt ist, macht es mir wahr-
scheinlich, dafs dieselben nicht in Bologna sondern in
Venedig ihren Ursprung hat. Eigenartig und verwandt in
der Wirkung ist eine andere Gattung von Rahmen, bei denen
wie gleichzeitig auch bei der Dekoration von Bologneser
Truhen — die zierlichen Ornamente in das Holz vertieft und
dann mit einer hellen Masse ausgefüllt sind. Aus gleichen
stilistischen Gründen wie bei den vorgenannten Rahmen ist
auch bei diesen gegen Ende des Cinquecento entstandenen
Rahmen die Profilierung ziemlich flach und bewegt gehalten.
Die Stellung, die Bologna im siebzehnten Jahrhundert in
der Malerei einnimmt, erhält auch in der Bildung der Rahmen
ihren charakteristischen Ausdruck. Die akademische Richtung,
die in der Anlehnung an die klassischen Meister der Renais-
sance für den Mangel eigener Erfindung und Kunst ihr Heil
sucht, macht sich in ähnlicher Weise in den Rahmen
der Bilder geltend, welche von der gleichzeitigen Barock-
architektur kaum beeinflusst, als nüchterne Nachbildungen
der einfachsten Renaissancemotive sich kennzeichnen. Das
häufigste Motiv ist der einfache vergoldete Leistenrahmen mit
regelmäfsig breiter, flacher Mittelleiste, und glatten Profilen
zur Seite: einem höheren nach aufsen, einem kleineren und
niedrigen nach innen; die Mittelleiste dekoriert mit leicht ein-
gepunzten, seltener mit aufgesetzten geschnitzten Ornamenten
in den Ecken und in der Mitte. Die Profilierung ist aus-
druckslos, die Vergoldung einförmig und hell in Farbe, das
Ganze langweilig wie die ganze Bologneser Kunst dieser Zeit.
Aehnlich wird das Fruchtkranz-Motiv der venetianischen
Hochrenaissance in schablonenhafter Weise in Bologna weiter-
gebildet, während es gleichzeitig in Venedig wenigstens noch
eine derbe dekorative Wirkung zeigt. Hier lebt die Rahmen-
bildnerei auch sonst von den
Ueberlieferungen der Renais-
sance. Namentlich beliebt
ist der breite meist prächtig
vergoldete Blattrahmen,dessen
kräftig stilisierte Blätter, in
der späteren Zeit meist durch-
brochen, von unten nach
oben aufranken. Erst im An-
fang des achtzehnten Jahr-
hunderts macht sich in Ober-
italien, namentlich in Venedig
der Einflufs des französischen
Spätbarocks geltend, der sich
namentlich in den schmalen
zierlichen Canaletto-Rahmen
bis gegen Ende des Jahrhun-
derts erhält.
Aechte, wirkungsvolle
Barockmotive zeigt Florenz
in seinen Rahmen aus dem
siebzehnten und Anfang des
achtzehnten Jahrhunderts, die
weniger durch die damalige
Florentiner Malerei als durch
den Sammeleifer und den
Luxus der Grofsherzöge von
Toscana ins Leben gerufen
wurden. Diese Rahmen, in grofser Zahl im Palazzo Pitti er-
halten, sind wesentlich verschieden von den Florentiner
Barockrahmendes sechzehnten Jahrhunderts. Waren jene durch
phantastische Erfindung, Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit
ausgezeichnet, so sind diese späteren Arbeiten eher einförmig,
dabei aber übertrieben breit, prächtig und glänzend in der
Vergoldung, wenn auch einzelne Motive im Detail aus
jenem Michelangeloschen Barock entlehnt und weiterent-
wickelt sind. Auf derb und grofs profilierter, sehr breiter
Unterlage, die die Mittelleiste ganz ausgeschieden hat, liegen
grofse Voluten, Stäbe und dgl. in phantastischer Weise sich
durchschneidend und häufig mit Muscheln in den Ecken ge-
schmückt. Im Aufbau und in der Wirkung sind diese Rahmen
nicht unähnlich den eben beschriebenen breiten venetiani-
schen Blattwerkrahmen der gleichen Zeit. Wie bei diesen, so
fällt auch hier allmählich die Unterlage fort und die kräftigen
Ornamente werden durchbrochen gearbeitet.
#
*
nischen Rahmen
Sonst pflegen
- :vrs«^-;rt,<5SJS5 CViC3,<sr;-V.
DIE geschmackvolle eigenartige Weiterbildung des Bilder-
rahmens geht mit dem siebenzehnten Jahrhundert, so
reich und prächtig gleichzeitig die Rahmen noch in Italien
geschnitzt und vergoldet werden, auf den Norden über, und
zwar übernimmt hier Frankreich die führende Rolle. Im
Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, etwa zwischen den
Jahren 151 o bis 1525 hatte die italienische Renaissance auch
in der Zeichnung der Rahmen ihren Einflufs auf die nordische
Kunst ausgeübt. Der Altarrahmen kommt freilich nur zu
einer spärlichen und dürftigen Entwicklung; am interes-
santesten ist er, wenn die Künstler, wie Dürer bei seinen be-
kannten Rahmen zum Allerheiligenbilde, nur im allgemeinen
Aufbau sich an die italie-
anlehnen.
sie weder in
den Verhältnissen noch in
den Ornamenten glücklich,
überhaupt nur eine schwache,
oft mifsverstandene Nach-
ahmung italienischer Vor-
bilder zu sein. Dagegen erhält
der Leistenrahmen unter den
gleichen Einflüssen eine, wenn
auch etwas einförmige, nüch-
terne , so doch gute und
wirkungsvolle Form, die sich
der Form der gotischen
Rahmen anschliefst. Der
breiten flachen Mittelleiste
giebt man nach aufsen ein
schmales aber ziemlich hohes,
nach innen ein kleines Profil,
das fein gegliedert und meist
vergoldet ist, während die
Mittelleiste regelmäfsig einen
hell schwarzen Anstrich,
selten einen mattfarbigen
oder weifsen Anstrich erhält,
auf dem in den Ecken und
in der Mitte Ornamente
in
t 251 9
32*
Venetianer Bucheinbände verwandt ist, macht es mir wahr-
scheinlich, dafs dieselben nicht in Bologna sondern in
Venedig ihren Ursprung hat. Eigenartig und verwandt in
der Wirkung ist eine andere Gattung von Rahmen, bei denen
wie gleichzeitig auch bei der Dekoration von Bologneser
Truhen — die zierlichen Ornamente in das Holz vertieft und
dann mit einer hellen Masse ausgefüllt sind. Aus gleichen
stilistischen Gründen wie bei den vorgenannten Rahmen ist
auch bei diesen gegen Ende des Cinquecento entstandenen
Rahmen die Profilierung ziemlich flach und bewegt gehalten.
Die Stellung, die Bologna im siebzehnten Jahrhundert in
der Malerei einnimmt, erhält auch in der Bildung der Rahmen
ihren charakteristischen Ausdruck. Die akademische Richtung,
die in der Anlehnung an die klassischen Meister der Renais-
sance für den Mangel eigener Erfindung und Kunst ihr Heil
sucht, macht sich in ähnlicher Weise in den Rahmen
der Bilder geltend, welche von der gleichzeitigen Barock-
architektur kaum beeinflusst, als nüchterne Nachbildungen
der einfachsten Renaissancemotive sich kennzeichnen. Das
häufigste Motiv ist der einfache vergoldete Leistenrahmen mit
regelmäfsig breiter, flacher Mittelleiste, und glatten Profilen
zur Seite: einem höheren nach aufsen, einem kleineren und
niedrigen nach innen; die Mittelleiste dekoriert mit leicht ein-
gepunzten, seltener mit aufgesetzten geschnitzten Ornamenten
in den Ecken und in der Mitte. Die Profilierung ist aus-
druckslos, die Vergoldung einförmig und hell in Farbe, das
Ganze langweilig wie die ganze Bologneser Kunst dieser Zeit.
Aehnlich wird das Fruchtkranz-Motiv der venetianischen
Hochrenaissance in schablonenhafter Weise in Bologna weiter-
gebildet, während es gleichzeitig in Venedig wenigstens noch
eine derbe dekorative Wirkung zeigt. Hier lebt die Rahmen-
bildnerei auch sonst von den
Ueberlieferungen der Renais-
sance. Namentlich beliebt
ist der breite meist prächtig
vergoldete Blattrahmen,dessen
kräftig stilisierte Blätter, in
der späteren Zeit meist durch-
brochen, von unten nach
oben aufranken. Erst im An-
fang des achtzehnten Jahr-
hunderts macht sich in Ober-
italien, namentlich in Venedig
der Einflufs des französischen
Spätbarocks geltend, der sich
namentlich in den schmalen
zierlichen Canaletto-Rahmen
bis gegen Ende des Jahrhun-
derts erhält.
Aechte, wirkungsvolle
Barockmotive zeigt Florenz
in seinen Rahmen aus dem
siebzehnten und Anfang des
achtzehnten Jahrhunderts, die
weniger durch die damalige
Florentiner Malerei als durch
den Sammeleifer und den
Luxus der Grofsherzöge von
Toscana ins Leben gerufen
wurden. Diese Rahmen, in grofser Zahl im Palazzo Pitti er-
halten, sind wesentlich verschieden von den Florentiner
Barockrahmendes sechzehnten Jahrhunderts. Waren jene durch
phantastische Erfindung, Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit
ausgezeichnet, so sind diese späteren Arbeiten eher einförmig,
dabei aber übertrieben breit, prächtig und glänzend in der
Vergoldung, wenn auch einzelne Motive im Detail aus
jenem Michelangeloschen Barock entlehnt und weiterent-
wickelt sind. Auf derb und grofs profilierter, sehr breiter
Unterlage, die die Mittelleiste ganz ausgeschieden hat, liegen
grofse Voluten, Stäbe und dgl. in phantastischer Weise sich
durchschneidend und häufig mit Muscheln in den Ecken ge-
schmückt. Im Aufbau und in der Wirkung sind diese Rahmen
nicht unähnlich den eben beschriebenen breiten venetiani-
schen Blattwerkrahmen der gleichen Zeit. Wie bei diesen, so
fällt auch hier allmählich die Unterlage fort und die kräftigen
Ornamente werden durchbrochen gearbeitet.
#
*
nischen Rahmen
Sonst pflegen
- :vrs«^-;rt,<5SJS5 CViC3,<sr;-V.
DIE geschmackvolle eigenartige Weiterbildung des Bilder-
rahmens geht mit dem siebenzehnten Jahrhundert, so
reich und prächtig gleichzeitig die Rahmen noch in Italien
geschnitzt und vergoldet werden, auf den Norden über, und
zwar übernimmt hier Frankreich die führende Rolle. Im
Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, etwa zwischen den
Jahren 151 o bis 1525 hatte die italienische Renaissance auch
in der Zeichnung der Rahmen ihren Einflufs auf die nordische
Kunst ausgeübt. Der Altarrahmen kommt freilich nur zu
einer spärlichen und dürftigen Entwicklung; am interes-
santesten ist er, wenn die Künstler, wie Dürer bei seinen be-
kannten Rahmen zum Allerheiligenbilde, nur im allgemeinen
Aufbau sich an die italie-
anlehnen.
sie weder in
den Verhältnissen noch in
den Ornamenten glücklich,
überhaupt nur eine schwache,
oft mifsverstandene Nach-
ahmung italienischer Vor-
bilder zu sein. Dagegen erhält
der Leistenrahmen unter den
gleichen Einflüssen eine, wenn
auch etwas einförmige, nüch-
terne , so doch gute und
wirkungsvolle Form, die sich
der Form der gotischen
Rahmen anschliefst. Der
breiten flachen Mittelleiste
giebt man nach aufsen ein
schmales aber ziemlich hohes,
nach innen ein kleines Profil,
das fein gegliedert und meist
vergoldet ist, während die
Mittelleiste regelmäfsig einen
hell schwarzen Anstrich,
selten einen mattfarbigen
oder weifsen Anstrich erhält,
auf dem in den Ecken und
in der Mitte Ornamente
in
t 251 9
32*