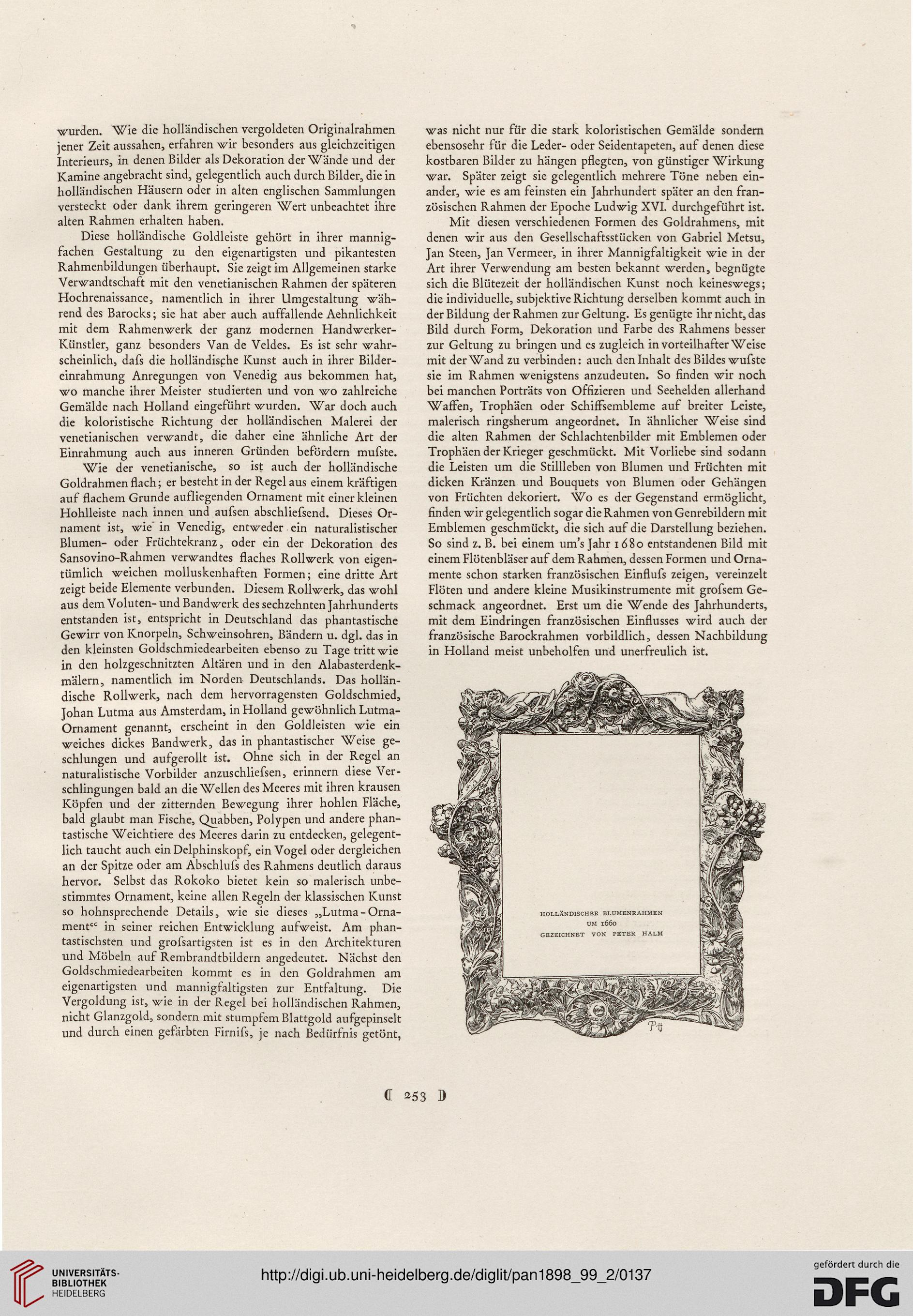wurden. "Wie die holländischen vergoldeten Originalrahmen
jener Zeit aussahen, erfahren wir besonders aus gleichzeitigen
Interieurs, in denen Bilder als Dekoration der Wände und der
Kamine angebracht sind, gelegentlich auch durch Bilder, die in
holländischen Häusern oder in alten englischen Sammlungen
versteckt oder dank ihrem geringeren Wert unbeachtet ihre
alten Rahmen erhalten haben.
Diese holländische Goldleiste gehört in ihrer mannig-
fachen Gestaltung zu den eigenartigsten und pikantesten
Rahmenbildungen überhaupt. Sie zeigt im Allgemeinen starke
Verwandtschaft mit den venetianischen Rahmen der späteren
Hochrenaissance, namentlich in ihrer Umgestaltung wäh-
rend des Barocks; sie hat aber auch auffallende Aehnlichkeit
mit dem Rahmenwerk der ganz modernen Handwerker-
Künstler, ganz besonders Van de Veldes. Es ist sehr -wahr-
scheinlich, dafs die holländische Kunst auch in ihrer Bilder-
einrahmung Anregungen von Venedig aus bekommen hat,
wo manche ihrer Meister studierten und von wo zahlreiche
Gemälde nach Holland eingeführt wurden. War doch auch
die koloristische Richtung der holländischen Malerei der
venetianischen verwandt, die daher eine ähnliche Art der
Einrahmung auch aus inneren Gründen befördern mufste.
Wie der venetianische, so ist auch der holländische
Goldrahmen flach; er besteht in der Regel aus einem kräftigen
auf flachem Grunde aufliegenden Ornament mit einer kleinen
Hohlleiste nach innen und aufsen abschliefsend. Dieses Or-
nament ist, wie' in Venedig, entweder ein naturalistischer
Blumen- oder Früchtekranz, oder ein der Dekoration des
Sansovino-Rahmen verwandtes flaches Rollwerk von eigen-
tümlich weichen molluskenhaften Formen; eine dritte Art
zeigt beide Elemente verbunden. Diesem Rollwerk, das wohl
aus dem Voluten- und Bandwerk des sechzehnten Jahrhunderts
entstanden ist, entspricht in Deutschland das phantastische
Gewirr von Knorpeln, Schweinsohren, Bändern u. dgl. das in
den kleinsten Goldschmiedearbeiten ebenso zu Tage tritt wie
in den holzgeschnitzten Altären und in den Alabasterdenk-
mälern, namentlich im Norden Deutschlands. Das hollän-
dische Rollwerk, nach dem hervorragensten Goldschmied,
Johan Lutma aus Amsterdam, in Holland gewöhnlich Lutma-
Ornament genannt, erscheint in den Goldleisten wie ein
weiches dickes Bandwerk, das in phantastischer Weise ge-
schlungen und aufgerollt ist. Ohne sich in der Regel an
naturalistische Vorbilder anzuschliefsen, erinnern diese Ver-
schlingungen bald an die Wellen des Meeres mit ihren krausen
Köpfen und der zitternden Bewegung ihrer hohlen Fläche,
bald glaubt man Fische, Quabben, Polypen und andere phan-
tastische Weichtiere des Meeres darin zu entdecken, gelegent-
lich taucht auch ein Delphinskopf, ein Vogel oder dergleichen
an der Spitze oder am Abschlufs des Rahmens deutlich daraus
hervor. Selbst das Rokoko bietet kein so malerisch unbe-
stimmtes Ornament, keine allen Regeln der klassischen Kunst
so hohnsprechende Details, wie sie dieses „Lutma-Orna-
ment" in seiner reichen Entwicklung aufweist. Am phan-
tastischsten und grofsartigsten ist es in den Architekturen
und Möbeln auf Rembrandtbildern angedeutet. Nächst den
Goldschmiedearbeiten kommt es in den Goldrahmen am
eigenartigsten und mannigfaltigsten zur Entfaltung. Die
Vergoldung ist, wie in der Regel bei holländischen Rahmen,
nicht Glanzgold, sondern mit stumpfem Blattgold aufgepinselt
und durch einen gefärbten Firnifs, je nach Bedürfnis getönt,
was nicht nur für die stark koloristischen Gemälde sondern
ebensosehr für die Leder- oder Seidentapeten, auf denen diese
kostbaren Bilder zu hängen pflegten, von günstiger Wirkung
war. Später zeigt sie gelegentlich mehrere Töne neben ein-
ander, wie es am feinsten ein Jahrhundert später an den fran-
zösischen Rahmen der Epoche Ludwig XVI. durchgeführt ist.
Mit diesen verschiedenen Formen des Goldrahmens, mit
denen wir aus den Gesellschaftsstücken von Gabriel Metsu,
Jan Steen, Jan Vermeer, in ihrer Mannigfaltigkeit wie in der
Art ihrer Verwendung am besten bekannt werden, begnügte
sich die Blütezeit der holländischen Kunst noch keineswegs;
die individuelle, subjektive Richtung derselben kommt auch in
der Bildung der Rahmen zur Geltung. Es genügte ihr nicht, das
Bild durch Form, Dekoration und Farbe des Rahmens besser
zur Geltung zu bringen und es zugleich in vorteilhafter Weise
mit der Wand zu verbinden: auch den Inhalt des Bildes wufste
sie im Rahmen wenigstens anzudeuten. So finden wir noch
bei manchen Porträts von Offizieren und Seehelden allerhand
Waffen, Trophäen oder Schiffsembleme auf breiter Leiste,
malerisch ringsherum angeordnet. In ähnlicher Weise sind
die alten Rahmen der Schlachtenbilder mit Emblemen oder
Trophäen der Krieger geschmückt. Mit Vorliebe sind sodann
die Leisten um die Stillleben von Blumen und Früchten mit
dicken Kränzen und Bouquets von Blumen oder Gehängen
von Früchten dekoriert. Wo es der Gegenstand ermöglicht,
finden wir gelegentlich sogar die Rahmen von Genrebildern mit
Emblemen geschmückt, die sich auf die Darstellung beziehen.
So sind z. B. bei einem um's Jahr 1680 entstandenen Bild mit
einem Flütenbläser auf dem Rahmen, dessen Formen und Orna-
mente schon starken französischen Einflufs zeigen, vereinzelt
Flöten und andere kleine Musikinstrumente mit grofsem Ge-
schmack angeordnet. Erst um die Wende des Jahrhunderts,
mit dem Eindringen französischen Einflusses wird auch der
französische Barockrahmen vorbildlich, dessen Nachbildung
in Holland meist unbeholfen und unerfreulich ist.
d 253 D
jener Zeit aussahen, erfahren wir besonders aus gleichzeitigen
Interieurs, in denen Bilder als Dekoration der Wände und der
Kamine angebracht sind, gelegentlich auch durch Bilder, die in
holländischen Häusern oder in alten englischen Sammlungen
versteckt oder dank ihrem geringeren Wert unbeachtet ihre
alten Rahmen erhalten haben.
Diese holländische Goldleiste gehört in ihrer mannig-
fachen Gestaltung zu den eigenartigsten und pikantesten
Rahmenbildungen überhaupt. Sie zeigt im Allgemeinen starke
Verwandtschaft mit den venetianischen Rahmen der späteren
Hochrenaissance, namentlich in ihrer Umgestaltung wäh-
rend des Barocks; sie hat aber auch auffallende Aehnlichkeit
mit dem Rahmenwerk der ganz modernen Handwerker-
Künstler, ganz besonders Van de Veldes. Es ist sehr -wahr-
scheinlich, dafs die holländische Kunst auch in ihrer Bilder-
einrahmung Anregungen von Venedig aus bekommen hat,
wo manche ihrer Meister studierten und von wo zahlreiche
Gemälde nach Holland eingeführt wurden. War doch auch
die koloristische Richtung der holländischen Malerei der
venetianischen verwandt, die daher eine ähnliche Art der
Einrahmung auch aus inneren Gründen befördern mufste.
Wie der venetianische, so ist auch der holländische
Goldrahmen flach; er besteht in der Regel aus einem kräftigen
auf flachem Grunde aufliegenden Ornament mit einer kleinen
Hohlleiste nach innen und aufsen abschliefsend. Dieses Or-
nament ist, wie' in Venedig, entweder ein naturalistischer
Blumen- oder Früchtekranz, oder ein der Dekoration des
Sansovino-Rahmen verwandtes flaches Rollwerk von eigen-
tümlich weichen molluskenhaften Formen; eine dritte Art
zeigt beide Elemente verbunden. Diesem Rollwerk, das wohl
aus dem Voluten- und Bandwerk des sechzehnten Jahrhunderts
entstanden ist, entspricht in Deutschland das phantastische
Gewirr von Knorpeln, Schweinsohren, Bändern u. dgl. das in
den kleinsten Goldschmiedearbeiten ebenso zu Tage tritt wie
in den holzgeschnitzten Altären und in den Alabasterdenk-
mälern, namentlich im Norden Deutschlands. Das hollän-
dische Rollwerk, nach dem hervorragensten Goldschmied,
Johan Lutma aus Amsterdam, in Holland gewöhnlich Lutma-
Ornament genannt, erscheint in den Goldleisten wie ein
weiches dickes Bandwerk, das in phantastischer Weise ge-
schlungen und aufgerollt ist. Ohne sich in der Regel an
naturalistische Vorbilder anzuschliefsen, erinnern diese Ver-
schlingungen bald an die Wellen des Meeres mit ihren krausen
Köpfen und der zitternden Bewegung ihrer hohlen Fläche,
bald glaubt man Fische, Quabben, Polypen und andere phan-
tastische Weichtiere des Meeres darin zu entdecken, gelegent-
lich taucht auch ein Delphinskopf, ein Vogel oder dergleichen
an der Spitze oder am Abschlufs des Rahmens deutlich daraus
hervor. Selbst das Rokoko bietet kein so malerisch unbe-
stimmtes Ornament, keine allen Regeln der klassischen Kunst
so hohnsprechende Details, wie sie dieses „Lutma-Orna-
ment" in seiner reichen Entwicklung aufweist. Am phan-
tastischsten und grofsartigsten ist es in den Architekturen
und Möbeln auf Rembrandtbildern angedeutet. Nächst den
Goldschmiedearbeiten kommt es in den Goldrahmen am
eigenartigsten und mannigfaltigsten zur Entfaltung. Die
Vergoldung ist, wie in der Regel bei holländischen Rahmen,
nicht Glanzgold, sondern mit stumpfem Blattgold aufgepinselt
und durch einen gefärbten Firnifs, je nach Bedürfnis getönt,
was nicht nur für die stark koloristischen Gemälde sondern
ebensosehr für die Leder- oder Seidentapeten, auf denen diese
kostbaren Bilder zu hängen pflegten, von günstiger Wirkung
war. Später zeigt sie gelegentlich mehrere Töne neben ein-
ander, wie es am feinsten ein Jahrhundert später an den fran-
zösischen Rahmen der Epoche Ludwig XVI. durchgeführt ist.
Mit diesen verschiedenen Formen des Goldrahmens, mit
denen wir aus den Gesellschaftsstücken von Gabriel Metsu,
Jan Steen, Jan Vermeer, in ihrer Mannigfaltigkeit wie in der
Art ihrer Verwendung am besten bekannt werden, begnügte
sich die Blütezeit der holländischen Kunst noch keineswegs;
die individuelle, subjektive Richtung derselben kommt auch in
der Bildung der Rahmen zur Geltung. Es genügte ihr nicht, das
Bild durch Form, Dekoration und Farbe des Rahmens besser
zur Geltung zu bringen und es zugleich in vorteilhafter Weise
mit der Wand zu verbinden: auch den Inhalt des Bildes wufste
sie im Rahmen wenigstens anzudeuten. So finden wir noch
bei manchen Porträts von Offizieren und Seehelden allerhand
Waffen, Trophäen oder Schiffsembleme auf breiter Leiste,
malerisch ringsherum angeordnet. In ähnlicher Weise sind
die alten Rahmen der Schlachtenbilder mit Emblemen oder
Trophäen der Krieger geschmückt. Mit Vorliebe sind sodann
die Leisten um die Stillleben von Blumen und Früchten mit
dicken Kränzen und Bouquets von Blumen oder Gehängen
von Früchten dekoriert. Wo es der Gegenstand ermöglicht,
finden wir gelegentlich sogar die Rahmen von Genrebildern mit
Emblemen geschmückt, die sich auf die Darstellung beziehen.
So sind z. B. bei einem um's Jahr 1680 entstandenen Bild mit
einem Flütenbläser auf dem Rahmen, dessen Formen und Orna-
mente schon starken französischen Einflufs zeigen, vereinzelt
Flöten und andere kleine Musikinstrumente mit grofsem Ge-
schmack angeordnet. Erst um die Wende des Jahrhunderts,
mit dem Eindringen französischen Einflusses wird auch der
französische Barockrahmen vorbildlich, dessen Nachbildung
in Holland meist unbeholfen und unerfreulich ist.
d 253 D