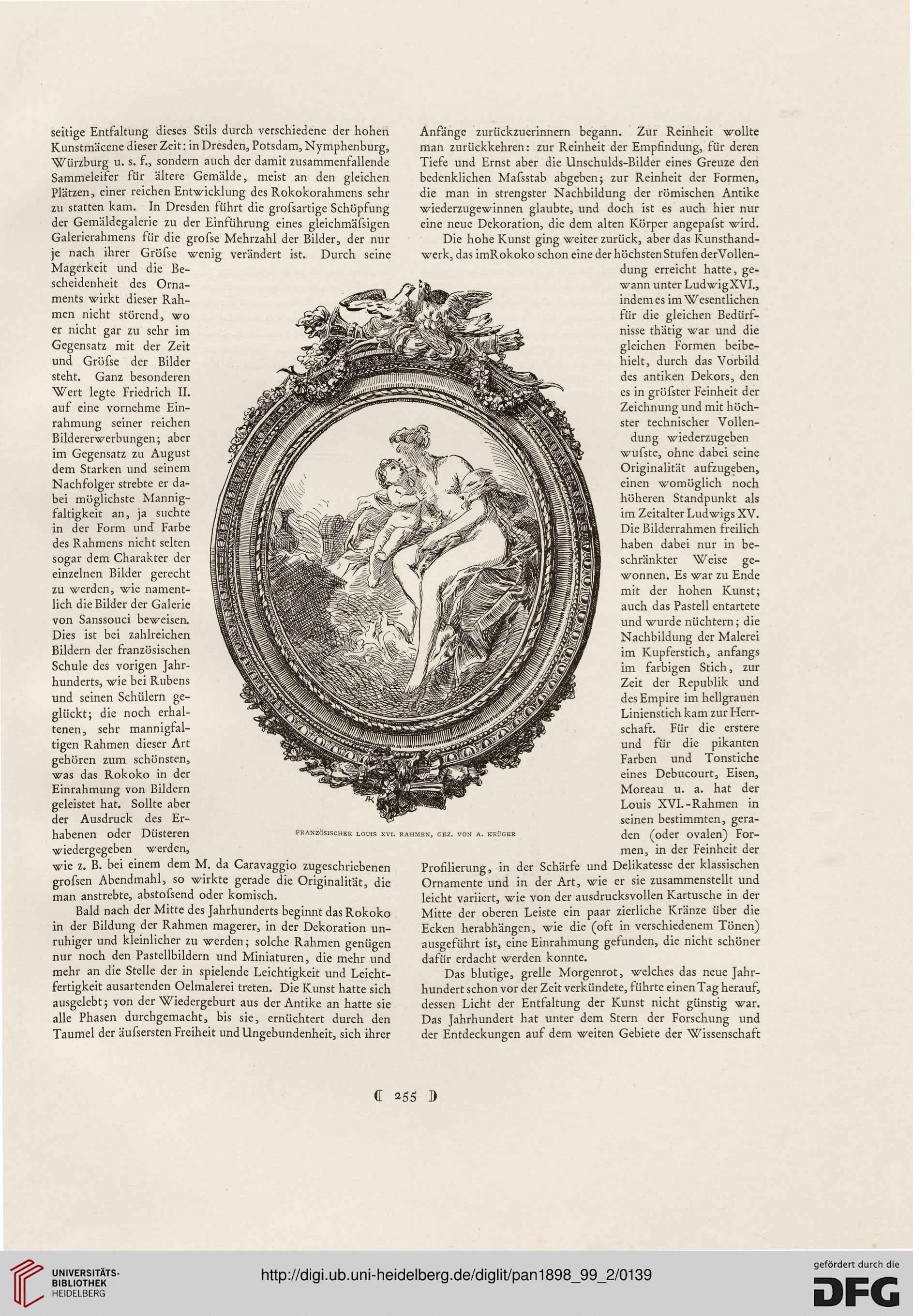seitige Entfaltung dieses Stils durch verschiedene der hohen
Kunstmäcene dieser Zeit: in Dresden, Potsdam, Nymphenburg,
Würzburg u. s. f., sondern auch der damit zusammenfallende
Sammeleifer für ältere Gemälde, meist an den gleichen
Plätzen, einer reichen Entwicklung des Rokokorahmens sehr
zu statten kam. In Dresden führt die grofsartige Schöpfung
der Gemäldegalerie zu der Einführung eines gleichmäfsigen
Galerierahmens für die grofse Mehrzahl der Bilder, der nur
je nach ihrer Gröfse wenig verändert ist. Durch seine
Magerkeit und die Be-
scheidenheit des Orna-
ments wirkt dieser Rah-
men nicht störend, wo
er nicht gar zu sehr im
Gegensatz mit der Zeit
und Gröfse der Bilder
steht. Ganz besonderen
Wert legte Friedrich II.
auf eine vornehme Ein-
rahmung seiner reichen
Bildererwerbungen; aber
im Gegensatz zu August
dem Starken und seinem
Nachfolger strebte er da-
bei möglichste Mannig-
faltigkeit an, ja suchte
in der Form und Farbe
des Rahmens nicht selten
sogar dem Charakter der
einzelnen Bilder gerecht
zu werden, wie nament-
lich die Bilder der Galerie
von Sanssouci beweisen.
Dies ist bei zahlreichen
Bildern der französischen
Schule des vorigen Jahr-
hunderts, wie bei Rubens
und seinen Schülern ge-
glückt; die noch erhal-
tenen, sehr mannigfal-
tigen Rahmen dieser Art
gehören zum schönsten,
was das Rokoko in der
Einrahmung von Bildern
geleistet hat. Sollte aber
der Ausdruck des Er-
habenen oder Düsteren
wiedergegeben werden,
wie z. B. bei einem dem M. da Caravaggio zugeschriebenen
grofsen Abendmahl, so wirkte gerade die Originalität, die
man anstrebte, abstofsend oder komisch.
Bald nach der Mitte des Jahrhunderts beginnt das Rokoko
in der Bildung der Rahmen magerer, in der Dekoration un-
ruhiger und kleinlicher zu werden; solche Rahmen genügen
nur noch den Pastellbildern und Miniaturen, die mehr und
mehr an die Stelle der in spielende Leichtigkeit und Leicht-
fertigkeit ausartenden Oelmalerei treten. Die Kunst hatte sich
ausgelebt; von der Wiedergeburt aus der Antike an hatte sie
alle Phasen durchgemacht, bis sie, ernüchtert durch den
Taumel der äufsersten Freiheit und Ungebundenheit, sich ihrer
FRANZÖSISCHER LOUIS
Anfänge zurückzuerinnern begann. Zur Reinheit wollte
man zurückkehren: zur Reinheit der Empfindung, für deren
Tiefe und Ernst aber die Unschulds-Bilder eines Greuze den
bedenklichen Mafsstab abgeben; zur Reinheit der Formen,
die man in strengster Nachbildung der römischen Antike
wiederzugewinnen glaubte, und doch ist es auch hier nur
eine neue Dekoration, die dem alten Körper angepafst wird.
Die hohe Kunst ging weiter zurück, aber das Kunsthand-
werk, das imRokoko schon eine der höchsten Stufen derVollen-
dung erreicht hatte, ge-
wann unter LudwigXVL,
indem es im Wesentlichen
für die gleichen Bedürf-
nisse thätig war und die
gleichen Formen beibe-
hielt, durch das Vorbild
des antiken Dekors, den
es in gröfster Feinheit der
Zeichnung und mit höch-
ster technischer Vollen-
dung wiederzugeben
wufste, ohne dabei seine
Originalität aufzugeben,
einen womöglich noch
höheren Standpunkt als
im Zeitalter Ludwigs XV.
Die Bilderrahmen freilich
haben dabei nur in be-
schränkter Weise ge-
wonnen. Es war zu Ende
mit der hohen Kunst;
auch das Pastell entartete
und wurde nüchtern; die
Nachbildung der Malerei
im Kupferstich, anfangs
im farbigen Stich, zur
Zeit der Republik und
des Empire im hellgrauen
Linienstich kam zur Herr-
schaft. Für die erstere
und für die pikanten
Farben und Tonstiche
eines Debucourt, Eisen,
Moreau u. a. hat der
Louis XVI.-Rahmen in
seinen bestimmten, gera-
den (oder ovalen) For-
men, in der Feinheit der
Profilierung, in der Schärfe und Delikatesse der klassischen
Ornamente und in der Art, wie er sie zusammenstellt und
leicht variiert, wie von der ausdrucksvollen Kartusche in der
Mitte der oberen Leiste ein paar zierliche Kränze über die
Ecken herabhängen, wie die (oft in verschiedenem Tönen)
ausgeführt ist, eine Einrahmung gefunden, die nicht schöner
dafür erdacht werden konnte.
Das blutige, grelle Morgenrot, welches das neue Jahr-
hundert schon vor der Zeit verkündete, führte einen Tag herauf,
dessen Licht der Entfaltung der Kunst nicht günstig war.
Das Jahrhundert hat unter dem Stern der Forschung und
der Entdeckungen auf dem weiten Gebiete der Wissenschaft
XVI. RAHMEN, GEZ. VON A. KRÜGER
C 255 B
Kunstmäcene dieser Zeit: in Dresden, Potsdam, Nymphenburg,
Würzburg u. s. f., sondern auch der damit zusammenfallende
Sammeleifer für ältere Gemälde, meist an den gleichen
Plätzen, einer reichen Entwicklung des Rokokorahmens sehr
zu statten kam. In Dresden führt die grofsartige Schöpfung
der Gemäldegalerie zu der Einführung eines gleichmäfsigen
Galerierahmens für die grofse Mehrzahl der Bilder, der nur
je nach ihrer Gröfse wenig verändert ist. Durch seine
Magerkeit und die Be-
scheidenheit des Orna-
ments wirkt dieser Rah-
men nicht störend, wo
er nicht gar zu sehr im
Gegensatz mit der Zeit
und Gröfse der Bilder
steht. Ganz besonderen
Wert legte Friedrich II.
auf eine vornehme Ein-
rahmung seiner reichen
Bildererwerbungen; aber
im Gegensatz zu August
dem Starken und seinem
Nachfolger strebte er da-
bei möglichste Mannig-
faltigkeit an, ja suchte
in der Form und Farbe
des Rahmens nicht selten
sogar dem Charakter der
einzelnen Bilder gerecht
zu werden, wie nament-
lich die Bilder der Galerie
von Sanssouci beweisen.
Dies ist bei zahlreichen
Bildern der französischen
Schule des vorigen Jahr-
hunderts, wie bei Rubens
und seinen Schülern ge-
glückt; die noch erhal-
tenen, sehr mannigfal-
tigen Rahmen dieser Art
gehören zum schönsten,
was das Rokoko in der
Einrahmung von Bildern
geleistet hat. Sollte aber
der Ausdruck des Er-
habenen oder Düsteren
wiedergegeben werden,
wie z. B. bei einem dem M. da Caravaggio zugeschriebenen
grofsen Abendmahl, so wirkte gerade die Originalität, die
man anstrebte, abstofsend oder komisch.
Bald nach der Mitte des Jahrhunderts beginnt das Rokoko
in der Bildung der Rahmen magerer, in der Dekoration un-
ruhiger und kleinlicher zu werden; solche Rahmen genügen
nur noch den Pastellbildern und Miniaturen, die mehr und
mehr an die Stelle der in spielende Leichtigkeit und Leicht-
fertigkeit ausartenden Oelmalerei treten. Die Kunst hatte sich
ausgelebt; von der Wiedergeburt aus der Antike an hatte sie
alle Phasen durchgemacht, bis sie, ernüchtert durch den
Taumel der äufsersten Freiheit und Ungebundenheit, sich ihrer
FRANZÖSISCHER LOUIS
Anfänge zurückzuerinnern begann. Zur Reinheit wollte
man zurückkehren: zur Reinheit der Empfindung, für deren
Tiefe und Ernst aber die Unschulds-Bilder eines Greuze den
bedenklichen Mafsstab abgeben; zur Reinheit der Formen,
die man in strengster Nachbildung der römischen Antike
wiederzugewinnen glaubte, und doch ist es auch hier nur
eine neue Dekoration, die dem alten Körper angepafst wird.
Die hohe Kunst ging weiter zurück, aber das Kunsthand-
werk, das imRokoko schon eine der höchsten Stufen derVollen-
dung erreicht hatte, ge-
wann unter LudwigXVL,
indem es im Wesentlichen
für die gleichen Bedürf-
nisse thätig war und die
gleichen Formen beibe-
hielt, durch das Vorbild
des antiken Dekors, den
es in gröfster Feinheit der
Zeichnung und mit höch-
ster technischer Vollen-
dung wiederzugeben
wufste, ohne dabei seine
Originalität aufzugeben,
einen womöglich noch
höheren Standpunkt als
im Zeitalter Ludwigs XV.
Die Bilderrahmen freilich
haben dabei nur in be-
schränkter Weise ge-
wonnen. Es war zu Ende
mit der hohen Kunst;
auch das Pastell entartete
und wurde nüchtern; die
Nachbildung der Malerei
im Kupferstich, anfangs
im farbigen Stich, zur
Zeit der Republik und
des Empire im hellgrauen
Linienstich kam zur Herr-
schaft. Für die erstere
und für die pikanten
Farben und Tonstiche
eines Debucourt, Eisen,
Moreau u. a. hat der
Louis XVI.-Rahmen in
seinen bestimmten, gera-
den (oder ovalen) For-
men, in der Feinheit der
Profilierung, in der Schärfe und Delikatesse der klassischen
Ornamente und in der Art, wie er sie zusammenstellt und
leicht variiert, wie von der ausdrucksvollen Kartusche in der
Mitte der oberen Leiste ein paar zierliche Kränze über die
Ecken herabhängen, wie die (oft in verschiedenem Tönen)
ausgeführt ist, eine Einrahmung gefunden, die nicht schöner
dafür erdacht werden konnte.
Das blutige, grelle Morgenrot, welches das neue Jahr-
hundert schon vor der Zeit verkündete, führte einen Tag herauf,
dessen Licht der Entfaltung der Kunst nicht günstig war.
Das Jahrhundert hat unter dem Stern der Forschung und
der Entdeckungen auf dem weiten Gebiete der Wissenschaft
XVI. RAHMEN, GEZ. VON A. KRÜGER
C 255 B