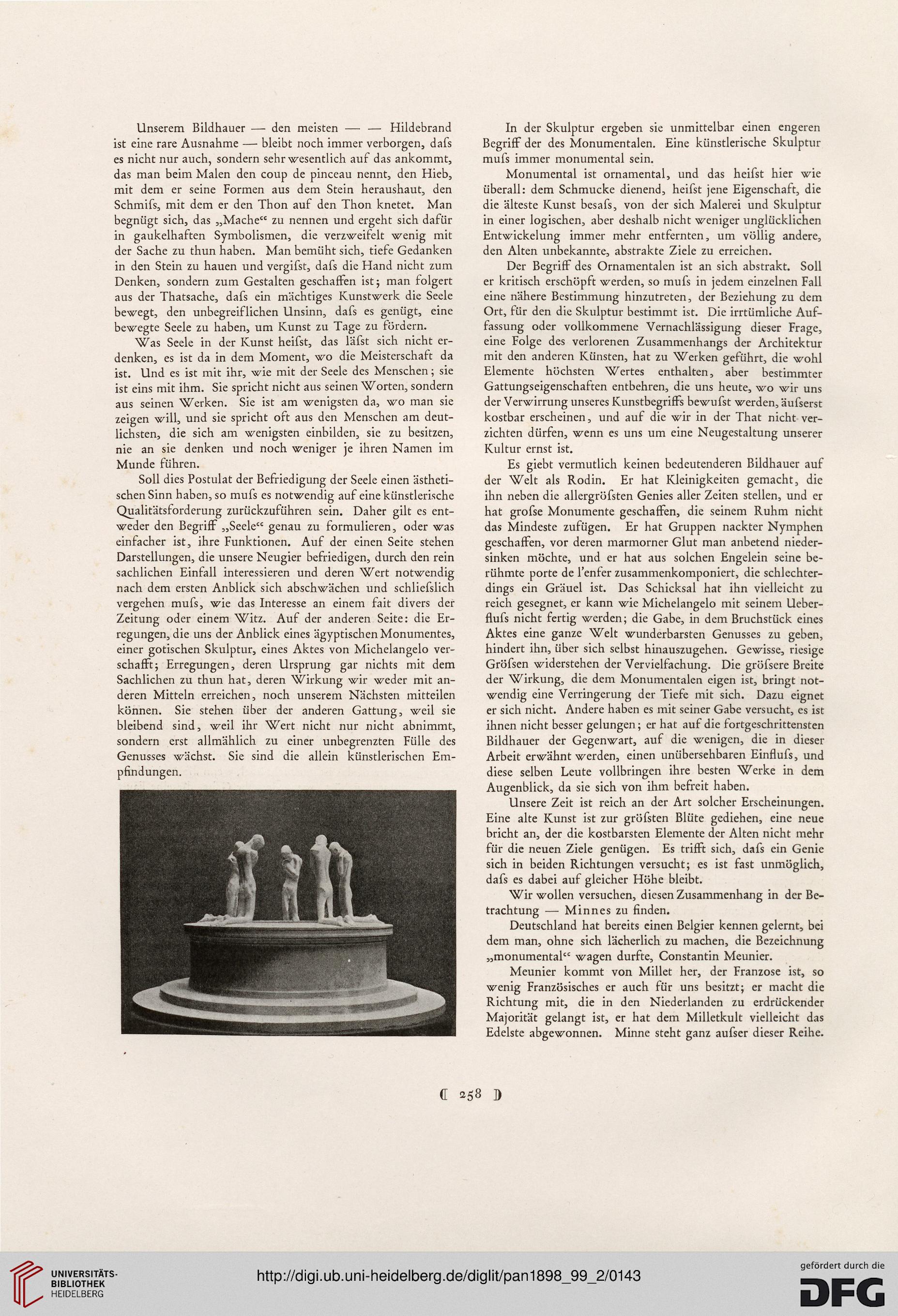Unserem Bildhauer —- den meisten — — Hildebrand
ist eine rare Ausnahme —- bleibt noch immer verborgen, dafs
es nicht nur auch, sondern sehr wesentlich auf das ankommt,
das man beim Malen den coup de pinceau nennt, den Hieb,
mit dem er seine Formen aus dem Stein heraushaut, den
Schmifs, mit dem er den Thon auf den Thon knetet. Man
begnügt sich, das „Mache" zu nennen und ergeht sich dafür
in gaukelhaften Symbolismen, die verzweifelt wenig mit
der Sache zu thun haben. Man bemüht sich, tiefe Gedanken
in den Stein zu hauen und vergifst, dafs die Hand nicht zum
Denken, sondern zum Gestalten geschaffen ist; man folgert
aus der Thatsache, dafs ein mächtiges Kunstwerk die Seele
bewegt, den unbegreiflichen Unsinn, dafs es genügt, eine
bewegte Seele zu haben, um Kunst zu Tage zu fördern.
Was Seele in der Kunst heifst, das läfst sich nicht er-
denken, es ist da in dem Moment, wo die Meisterschaft da
ist. Und es ist mit ihr, wie mit der Seele des Menschen; sie
ist eins mit ihm. Sie spricht nicht aus seinen "Worten, sondern
aus seinen Werken. Sie ist am wenigsten da, wo man sie
zeigen will, und sie spricht oft aus den Menschen am deut-
lichsten, die sich am wenigsten einbilden, sie zu besitzen,
nie an sie denken und noch weniger je ihren Namen im
Munde führen.
Soll dies Postulat der Befriedigung der Seele einen ästheti-
schen Sinn haben, so mufs es notwendig auf eine künstlerische
Qualitätsforderung zurückzuführen sein. Daher gilt es ent-
weder den Begriff „Seele" genau zu formulieren, oder was
einfacher ist, ihre Funktionen. Auf der einen Seite stehen
Darstellungen, die unsere Neugier befriedigen, durch den rein
sachlichen Einfall interessieren und deren Wert notwendig
nach dem ersten Anblick sich abschwächen und schliefslich
vergehen mufs, wie das Interesse an einem fait divers der
Zeitung oder einem Witz. Auf der anderen Seite: die Er-
regungen, die uns der Anblick eines ägyptischen Monumentes,
einer gotischen Skulptur, eines Aktes von Michelangelo ver-
schafft; Erregungen, deren Ursprung gar nichts mit dem
Sachlichen zu thun hat, deren Wirkung wir weder mit an-
deren Mitteln erreichen, noch unserem Nächsten mitteilen
können. Sie stehen über der anderen Gattung, weil sie
bleibend sind, weil ihr Wert nicht nur nicht abnimmt,
sondern erst allmählich zu einer unbegrenzten Fülle des
Genusses wächst. Sie sind die allein künstlerischen Em-
pfindungen.
In der Skulptur ergeben sie unmittelbar einen engeren
Begriff der des Monumentalen. Eine künstlerische Skulptur
mufs immer monumental sein.
Monumental ist ornamental, und das heifst hier wie
überall: dem Schmucke dienend, heifst jene Eigenschaft, die
die älteste Kunst besafs, von der sich Malerei und Skulptur
in einer logischen, aber deshalb nicht weniger unglücklichen
Entwickelung immer mehr entfernten, um völlig andere,
den Alten unbekannte, abstrakte Ziele zu erreichen.
Der Begriff des Ornamentalen ist an sich abstrakt. Soll
er kritisch erschöpft werden, so mufs in jedem einzelnen Fall
eine nähere Bestimmung hinzutreten, der Beziehung zu dem
Ort, für den die Skulptur bestimmt ist. Die irrtümliche Auf-
fassung oder vollkommene Vernachlässigung dieser Frage,
eine Folge des verlorenen Zusammenhangs der Architektur
mit den anderen Künsten, hat zu Werken geführt, die wohl
Elemente höchsten Wertes enthalten, aber bestimmter
Gattungseigenschaften entbehren, die uns heute, wo wir uns
der Verwirrung unseres Kunstbegriffs bewufst werden, äufserst
kostbar erscheinen, und auf die wir in der That nicht ver-
zichten dürfen, wenn es uns um eine Neugestaltung unserer
Kultur ernst ist.
Es giebt vermutlich keinen bedeutenderen Bildhauer auf
der Welt als Rodin. Er hat Kleinigkeiten gemacht, die
ihn neben die allergröfsten Genies aller Zeiten stellen, und er
hat grofse Monumente geschaffen, die seinem Ruhm nicht
das Mindeste zufügen. Er hat Gruppen nackter Nymphen
geschaffen, vor deren marmorner Glut man anbetend nieder-
sinken möchte, und er hat aus solchen Engelein seine be-
rühmte porte de l'enfer zusammenkomponiert, die schlechter-
dings ein Gräuel ist. Das Schicksal hat ihn vielleicht zu
reich gesegnet, er kann wie Michelangelo mit seinem Ueber-
flufs nicht fertig werden; die Gabe, in dem Bruchstück eines
Aktes eine ganze Welt wunderbarsten Genusses zu geben,
hindert ihn, über sich selbst hinauszugehen. Gewisse, riesige
Gröfsen widerstehen der Vervielfachung. Die gröfsere Breite
der Wirkung, die dem Monumentalen eigen ist, bringt not-
wendig eine Verringerung der Tiefe mit sich. Dazu eignet
er sich nicht. Andere haben es mit seiner Gabe versucht, es ist
ihnen nicht besser gelungen; er hat auf die fortgeschrittensten
Bildhauer der Gegenwart, auf die wenigen, die in dieser
Arbeit erwähnt werden, einen unübersehbaren Einflufs, und
diese selben Leute vollbringen ihre besten Werke in dem
Augenblick, da sie sich von ihm befreit haben.
Unsere Zeit ist reich an der Art solcher Erscheinungen.
Eine alte Kunst ist zur gröfsten Blüte gediehen, eine neue
bricht an, der die kostbarsten Elemente der Alten nicht mehr
für die neuen Ziele genügen. Es trifft sich, dafs ein Genie
sich in beiden Richtungen versucht; es ist fast unmöglich,
dafs es dabei auf gleicher Höhe bleibt.
Wir wollen versuchen, diesen Zusammenhang in der Be-
trachtung — Minnes zu finden.
Deutschland hat bereits einen Belgier kennen gelernt, bei
dem man, ohne sich lächerlich zu machen, die Bezeichnung
„monumental" wagen durfte, Constantin Meunier.
Meunier kommt von Millet her, der Franzose ist, so
wenig Französisches er auch für uns besitzt; er macht die
Richtung mit, die in den Niederlanden zu erdrückender
Majorität gelangt ist, er hat dem Milletkult vielleicht das
Edelste abgewonnen. Minne steht ganz aufser dieser Reihe.
C 258 B
ist eine rare Ausnahme —- bleibt noch immer verborgen, dafs
es nicht nur auch, sondern sehr wesentlich auf das ankommt,
das man beim Malen den coup de pinceau nennt, den Hieb,
mit dem er seine Formen aus dem Stein heraushaut, den
Schmifs, mit dem er den Thon auf den Thon knetet. Man
begnügt sich, das „Mache" zu nennen und ergeht sich dafür
in gaukelhaften Symbolismen, die verzweifelt wenig mit
der Sache zu thun haben. Man bemüht sich, tiefe Gedanken
in den Stein zu hauen und vergifst, dafs die Hand nicht zum
Denken, sondern zum Gestalten geschaffen ist; man folgert
aus der Thatsache, dafs ein mächtiges Kunstwerk die Seele
bewegt, den unbegreiflichen Unsinn, dafs es genügt, eine
bewegte Seele zu haben, um Kunst zu Tage zu fördern.
Was Seele in der Kunst heifst, das läfst sich nicht er-
denken, es ist da in dem Moment, wo die Meisterschaft da
ist. Und es ist mit ihr, wie mit der Seele des Menschen; sie
ist eins mit ihm. Sie spricht nicht aus seinen "Worten, sondern
aus seinen Werken. Sie ist am wenigsten da, wo man sie
zeigen will, und sie spricht oft aus den Menschen am deut-
lichsten, die sich am wenigsten einbilden, sie zu besitzen,
nie an sie denken und noch weniger je ihren Namen im
Munde führen.
Soll dies Postulat der Befriedigung der Seele einen ästheti-
schen Sinn haben, so mufs es notwendig auf eine künstlerische
Qualitätsforderung zurückzuführen sein. Daher gilt es ent-
weder den Begriff „Seele" genau zu formulieren, oder was
einfacher ist, ihre Funktionen. Auf der einen Seite stehen
Darstellungen, die unsere Neugier befriedigen, durch den rein
sachlichen Einfall interessieren und deren Wert notwendig
nach dem ersten Anblick sich abschwächen und schliefslich
vergehen mufs, wie das Interesse an einem fait divers der
Zeitung oder einem Witz. Auf der anderen Seite: die Er-
regungen, die uns der Anblick eines ägyptischen Monumentes,
einer gotischen Skulptur, eines Aktes von Michelangelo ver-
schafft; Erregungen, deren Ursprung gar nichts mit dem
Sachlichen zu thun hat, deren Wirkung wir weder mit an-
deren Mitteln erreichen, noch unserem Nächsten mitteilen
können. Sie stehen über der anderen Gattung, weil sie
bleibend sind, weil ihr Wert nicht nur nicht abnimmt,
sondern erst allmählich zu einer unbegrenzten Fülle des
Genusses wächst. Sie sind die allein künstlerischen Em-
pfindungen.
In der Skulptur ergeben sie unmittelbar einen engeren
Begriff der des Monumentalen. Eine künstlerische Skulptur
mufs immer monumental sein.
Monumental ist ornamental, und das heifst hier wie
überall: dem Schmucke dienend, heifst jene Eigenschaft, die
die älteste Kunst besafs, von der sich Malerei und Skulptur
in einer logischen, aber deshalb nicht weniger unglücklichen
Entwickelung immer mehr entfernten, um völlig andere,
den Alten unbekannte, abstrakte Ziele zu erreichen.
Der Begriff des Ornamentalen ist an sich abstrakt. Soll
er kritisch erschöpft werden, so mufs in jedem einzelnen Fall
eine nähere Bestimmung hinzutreten, der Beziehung zu dem
Ort, für den die Skulptur bestimmt ist. Die irrtümliche Auf-
fassung oder vollkommene Vernachlässigung dieser Frage,
eine Folge des verlorenen Zusammenhangs der Architektur
mit den anderen Künsten, hat zu Werken geführt, die wohl
Elemente höchsten Wertes enthalten, aber bestimmter
Gattungseigenschaften entbehren, die uns heute, wo wir uns
der Verwirrung unseres Kunstbegriffs bewufst werden, äufserst
kostbar erscheinen, und auf die wir in der That nicht ver-
zichten dürfen, wenn es uns um eine Neugestaltung unserer
Kultur ernst ist.
Es giebt vermutlich keinen bedeutenderen Bildhauer auf
der Welt als Rodin. Er hat Kleinigkeiten gemacht, die
ihn neben die allergröfsten Genies aller Zeiten stellen, und er
hat grofse Monumente geschaffen, die seinem Ruhm nicht
das Mindeste zufügen. Er hat Gruppen nackter Nymphen
geschaffen, vor deren marmorner Glut man anbetend nieder-
sinken möchte, und er hat aus solchen Engelein seine be-
rühmte porte de l'enfer zusammenkomponiert, die schlechter-
dings ein Gräuel ist. Das Schicksal hat ihn vielleicht zu
reich gesegnet, er kann wie Michelangelo mit seinem Ueber-
flufs nicht fertig werden; die Gabe, in dem Bruchstück eines
Aktes eine ganze Welt wunderbarsten Genusses zu geben,
hindert ihn, über sich selbst hinauszugehen. Gewisse, riesige
Gröfsen widerstehen der Vervielfachung. Die gröfsere Breite
der Wirkung, die dem Monumentalen eigen ist, bringt not-
wendig eine Verringerung der Tiefe mit sich. Dazu eignet
er sich nicht. Andere haben es mit seiner Gabe versucht, es ist
ihnen nicht besser gelungen; er hat auf die fortgeschrittensten
Bildhauer der Gegenwart, auf die wenigen, die in dieser
Arbeit erwähnt werden, einen unübersehbaren Einflufs, und
diese selben Leute vollbringen ihre besten Werke in dem
Augenblick, da sie sich von ihm befreit haben.
Unsere Zeit ist reich an der Art solcher Erscheinungen.
Eine alte Kunst ist zur gröfsten Blüte gediehen, eine neue
bricht an, der die kostbarsten Elemente der Alten nicht mehr
für die neuen Ziele genügen. Es trifft sich, dafs ein Genie
sich in beiden Richtungen versucht; es ist fast unmöglich,
dafs es dabei auf gleicher Höhe bleibt.
Wir wollen versuchen, diesen Zusammenhang in der Be-
trachtung — Minnes zu finden.
Deutschland hat bereits einen Belgier kennen gelernt, bei
dem man, ohne sich lächerlich zu machen, die Bezeichnung
„monumental" wagen durfte, Constantin Meunier.
Meunier kommt von Millet her, der Franzose ist, so
wenig Französisches er auch für uns besitzt; er macht die
Richtung mit, die in den Niederlanden zu erdrückender
Majorität gelangt ist, er hat dem Milletkult vielleicht das
Edelste abgewonnen. Minne steht ganz aufser dieser Reihe.
C 258 B