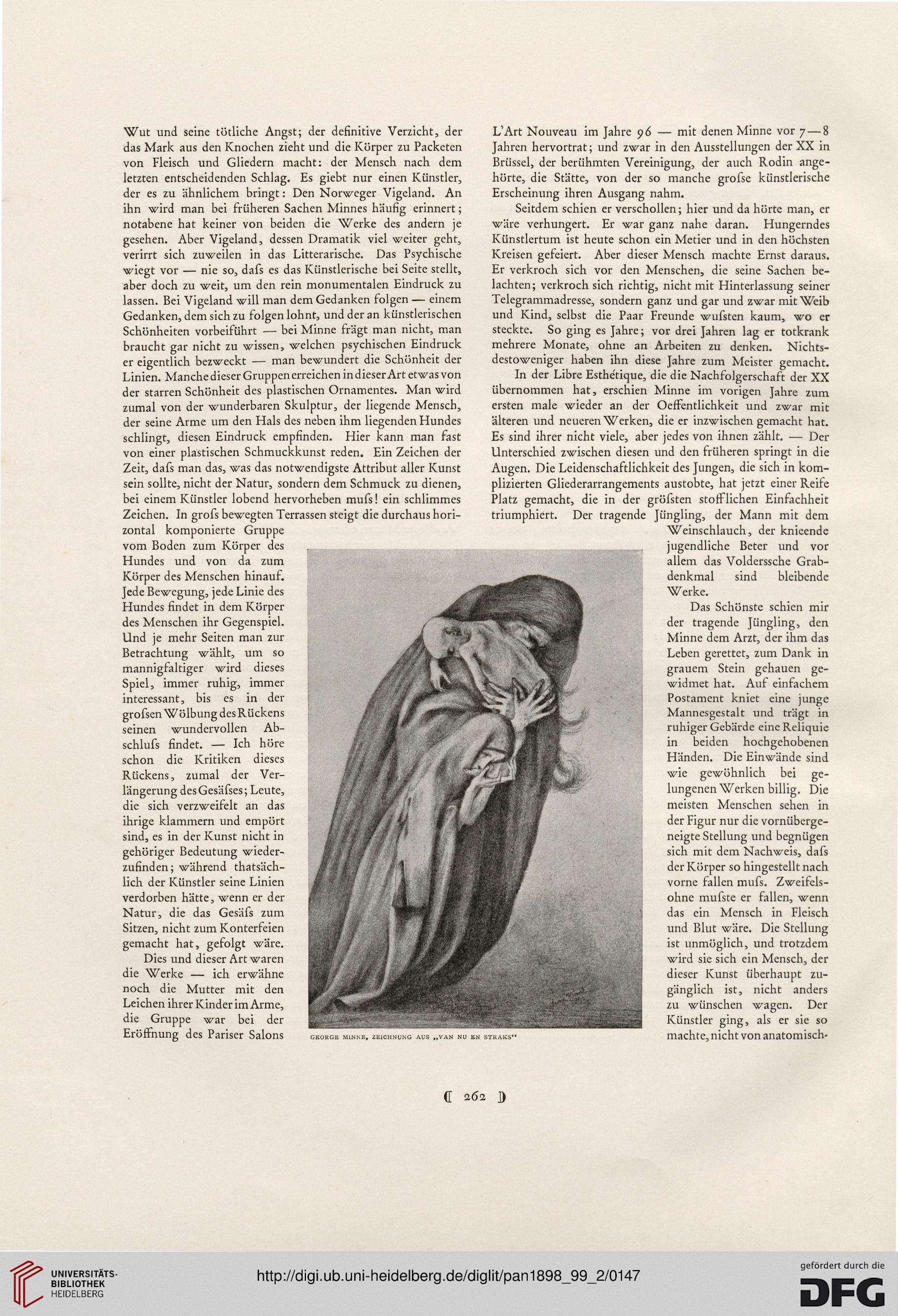Wut und seine tötliche Angst; der definitive Verzicht, der
das Mark aus den Knochen zieht und die Körper zu Packeten
von Fleisch und Gliedern macht: der Mensch nach dem
letzten entscheidenden Schlag. Es giebt nur einen Künstler,
der es zu ähnlichem bringt: Den Norweger Vigeland. An
ihn wird man bei früheren Sachen Minnes häufig erinnert;
notabene hat keiner von beiden die Werke des andern je
gesehen. Aber Vigeland, dessen Dramatik viel weiter geht,
verirrt sich zuweilen in das Litterarische. Das Psychische
wiegt vor — nie so, dafs es das Künstlerische bei Seite stellt,
aber doch zu weit, um den rein monumentalen Eindruck zu
lassen. Bei Vigeland will man dem Gedanken folgen — einem
Gedanken, dem sich zu folgen lohnt, und der an künstlerischen
Schönheiten vorbeiführt — bei Minne fragt man nicht, man
braucht gar nicht zu wissen, welchen psychischen Eindruck
er eigentlich bezweckt — man bewundert die Schönheit der
Linien. Manche dieser Gruppen erreichen in dieser Art etwas von
der starren Schönheit des plastischen Ornamentes. Man wird
zumal von der wunderbaren Skulptur, der liegende Mensch,
der seine Arme um den Hals des neben ihm liegenden Hundes
schlingt, diesen Eindruck empfinden. Hier kann man fast
von einer plastischen Schmuckkunst reden. Ein Zeichen der
Zeit, dafs man das, was das notwendigste Attribut aller Kunst
sein sollte, nicht der Natur, sondern dem Schmuck zu dienen,
bei einem Künstler lobend hervorheben mufs! ein schlimmes
Zeichen. In grofs bewegten Terrassen steigt die durchaus hori-
zontal komponierte Gruppe
vom Boden zum Körper des
Hundes und von da zum
Körper des Menschen hinauf.
Jede Bewegung, jede Linie des
Hundes findet in dem Körper
des Menschen ihr Gegenspiel.
Und je mehr Seiten man zur
Betrachtung wählt, um so
mannigfaltiger wird dieses
Spiel, immer ruhig, immer
interessant, bis es in der
grofsen Wölbung des Rückens
seinen wundervollen Ab-
schlufs findet. — Ich höre
schon die Kritiken dieses
Rückens, zumal der Ver-
längerung des Gesäfses; Leute,
die sich verzweifelt an das
ihrige klammern und empört
sind, es in der Kunst nicht in
gehöriger Bedeutung wieder-
zufinden; während thatsäch-
lich der Künstler seine Linien
verdorben hätte, wenn er der
Natur, die das Gesäfs zum
Sitzen, nicht zum Konterfeien
gemacht hat, gefolgt wäre.
Dies und dieser Art waren
die Werke — ich erwähne
noch die Mutter mit den
Leichen ihrer Kinder im Arme,
die Gruppe war bei der
Eröffnung des Pariser Salons
GEORGE MINNE, ZEICHNUNG AUS „VAN NU EN STRAKS"
L'Art Nouveau im Jahre 06 — mit denen Minne vor 7—8
Jahren hervortrat; und zwar in den Ausstellungen der XX in
Brüssel, der berühmten Vereinigung, der auch Rodin ange-
hörte, die Stätte, von der so manche grofse künstlerische
Erscheinung ihren Ausgang nahm.
Seitdem schien er verschollen; hier und da hörte man, er
wäre verhungert. Er war ganz nahe daran. Hungerndes
Künstlertum ist heute schon ein Metier und in den höchsten
Kreisen gefeiert. Aber dieser Mensch machte Ernst daraus.
Er verkroch sich vor den Menschen, die seine Sachen be-
lachten; verkroch sich richtig, nicht mit Hinterlassung seiner
Telegrammadresse, sondern ganz und gar und zwar mit Weib
und Kind, selbst die Paar Freunde wufsten kaum, wo er
steckte. So ging es Jahre; vor drei Jahren lag er totkrank
mehrere Monate, ohne an Arbeiten zu denken. Nichts-
destoweniger haben ihn diese Jahre zum Meister gemacht.
In der Libre Esthe'tique, die die Nachfolgerschaft der XX
übernommen hat, erschien Minne im vorigen Jahre zum
ersten male wieder an der Oeffentlichkeit und zwar mit
älteren und neueren Werken, die er inzwischen gemacht hat.
Es sind ihrer nicht viele, aber jedes von ihnen zählt. — Der
Unterschied zwischen diesen und den früheren springt in die
Augen. Die Leidenschaftlichkeit des Jungen, die sich in kom-
plizierten Gliederarrangements austobte, hat jetzt einer Reife
Platz gemacht, die in der gröfsten stofflichen Einfachheit
triumphiert. Der tragende Jüngling, der Mann mit dem
Weinschlauch, der knieende
jugendliche Beter und vor
allem das Volderssche Grab-
denkmal sind bleibende
Werke.
Das Schönste schien mir
der tragende Jüngling, den
Minne dem Arzt, der ihm das
Leben gerettet, zum Dank in
grauem Stein gehauen ge-
widmet hat. Auf einfachem
Postament kniet eine junge
Mannesgestalt und trägt in
ruhiger Gebärde eine Reliquie
in beiden hochgehobenen
Händen. Die Einwände sind
wie gewöhnlich bei ge-
lungenen Werken billig. Die
meisten Menschen sehen in
der Figur nur die vornüberge-
neigte Stellung und begnügen
sich mit dem Nachweis, dafs
der Körper so hingestellt nach
vorne fallen mufs. Zweifels-
ohne mufste er fallen, wenn
das ein Mensch in Fleisch
und Blut wäre. Die Stellung
ist unmöglich, und trotzdem
wird sie sich ein Mensch, der
dieser Kunst überhaupt zu-
gänglich ist, nicht anders
zu wünschen wagen. Der
Künstler ging, als er sie so
machte, nicht von anatomisch-
C 262 3
das Mark aus den Knochen zieht und die Körper zu Packeten
von Fleisch und Gliedern macht: der Mensch nach dem
letzten entscheidenden Schlag. Es giebt nur einen Künstler,
der es zu ähnlichem bringt: Den Norweger Vigeland. An
ihn wird man bei früheren Sachen Minnes häufig erinnert;
notabene hat keiner von beiden die Werke des andern je
gesehen. Aber Vigeland, dessen Dramatik viel weiter geht,
verirrt sich zuweilen in das Litterarische. Das Psychische
wiegt vor — nie so, dafs es das Künstlerische bei Seite stellt,
aber doch zu weit, um den rein monumentalen Eindruck zu
lassen. Bei Vigeland will man dem Gedanken folgen — einem
Gedanken, dem sich zu folgen lohnt, und der an künstlerischen
Schönheiten vorbeiführt — bei Minne fragt man nicht, man
braucht gar nicht zu wissen, welchen psychischen Eindruck
er eigentlich bezweckt — man bewundert die Schönheit der
Linien. Manche dieser Gruppen erreichen in dieser Art etwas von
der starren Schönheit des plastischen Ornamentes. Man wird
zumal von der wunderbaren Skulptur, der liegende Mensch,
der seine Arme um den Hals des neben ihm liegenden Hundes
schlingt, diesen Eindruck empfinden. Hier kann man fast
von einer plastischen Schmuckkunst reden. Ein Zeichen der
Zeit, dafs man das, was das notwendigste Attribut aller Kunst
sein sollte, nicht der Natur, sondern dem Schmuck zu dienen,
bei einem Künstler lobend hervorheben mufs! ein schlimmes
Zeichen. In grofs bewegten Terrassen steigt die durchaus hori-
zontal komponierte Gruppe
vom Boden zum Körper des
Hundes und von da zum
Körper des Menschen hinauf.
Jede Bewegung, jede Linie des
Hundes findet in dem Körper
des Menschen ihr Gegenspiel.
Und je mehr Seiten man zur
Betrachtung wählt, um so
mannigfaltiger wird dieses
Spiel, immer ruhig, immer
interessant, bis es in der
grofsen Wölbung des Rückens
seinen wundervollen Ab-
schlufs findet. — Ich höre
schon die Kritiken dieses
Rückens, zumal der Ver-
längerung des Gesäfses; Leute,
die sich verzweifelt an das
ihrige klammern und empört
sind, es in der Kunst nicht in
gehöriger Bedeutung wieder-
zufinden; während thatsäch-
lich der Künstler seine Linien
verdorben hätte, wenn er der
Natur, die das Gesäfs zum
Sitzen, nicht zum Konterfeien
gemacht hat, gefolgt wäre.
Dies und dieser Art waren
die Werke — ich erwähne
noch die Mutter mit den
Leichen ihrer Kinder im Arme,
die Gruppe war bei der
Eröffnung des Pariser Salons
GEORGE MINNE, ZEICHNUNG AUS „VAN NU EN STRAKS"
L'Art Nouveau im Jahre 06 — mit denen Minne vor 7—8
Jahren hervortrat; und zwar in den Ausstellungen der XX in
Brüssel, der berühmten Vereinigung, der auch Rodin ange-
hörte, die Stätte, von der so manche grofse künstlerische
Erscheinung ihren Ausgang nahm.
Seitdem schien er verschollen; hier und da hörte man, er
wäre verhungert. Er war ganz nahe daran. Hungerndes
Künstlertum ist heute schon ein Metier und in den höchsten
Kreisen gefeiert. Aber dieser Mensch machte Ernst daraus.
Er verkroch sich vor den Menschen, die seine Sachen be-
lachten; verkroch sich richtig, nicht mit Hinterlassung seiner
Telegrammadresse, sondern ganz und gar und zwar mit Weib
und Kind, selbst die Paar Freunde wufsten kaum, wo er
steckte. So ging es Jahre; vor drei Jahren lag er totkrank
mehrere Monate, ohne an Arbeiten zu denken. Nichts-
destoweniger haben ihn diese Jahre zum Meister gemacht.
In der Libre Esthe'tique, die die Nachfolgerschaft der XX
übernommen hat, erschien Minne im vorigen Jahre zum
ersten male wieder an der Oeffentlichkeit und zwar mit
älteren und neueren Werken, die er inzwischen gemacht hat.
Es sind ihrer nicht viele, aber jedes von ihnen zählt. — Der
Unterschied zwischen diesen und den früheren springt in die
Augen. Die Leidenschaftlichkeit des Jungen, die sich in kom-
plizierten Gliederarrangements austobte, hat jetzt einer Reife
Platz gemacht, die in der gröfsten stofflichen Einfachheit
triumphiert. Der tragende Jüngling, der Mann mit dem
Weinschlauch, der knieende
jugendliche Beter und vor
allem das Volderssche Grab-
denkmal sind bleibende
Werke.
Das Schönste schien mir
der tragende Jüngling, den
Minne dem Arzt, der ihm das
Leben gerettet, zum Dank in
grauem Stein gehauen ge-
widmet hat. Auf einfachem
Postament kniet eine junge
Mannesgestalt und trägt in
ruhiger Gebärde eine Reliquie
in beiden hochgehobenen
Händen. Die Einwände sind
wie gewöhnlich bei ge-
lungenen Werken billig. Die
meisten Menschen sehen in
der Figur nur die vornüberge-
neigte Stellung und begnügen
sich mit dem Nachweis, dafs
der Körper so hingestellt nach
vorne fallen mufs. Zweifels-
ohne mufste er fallen, wenn
das ein Mensch in Fleisch
und Blut wäre. Die Stellung
ist unmöglich, und trotzdem
wird sie sich ein Mensch, der
dieser Kunst überhaupt zu-
gänglich ist, nicht anders
zu wünschen wagen. Der
Künstler ging, als er sie so
machte, nicht von anatomisch-
C 262 3