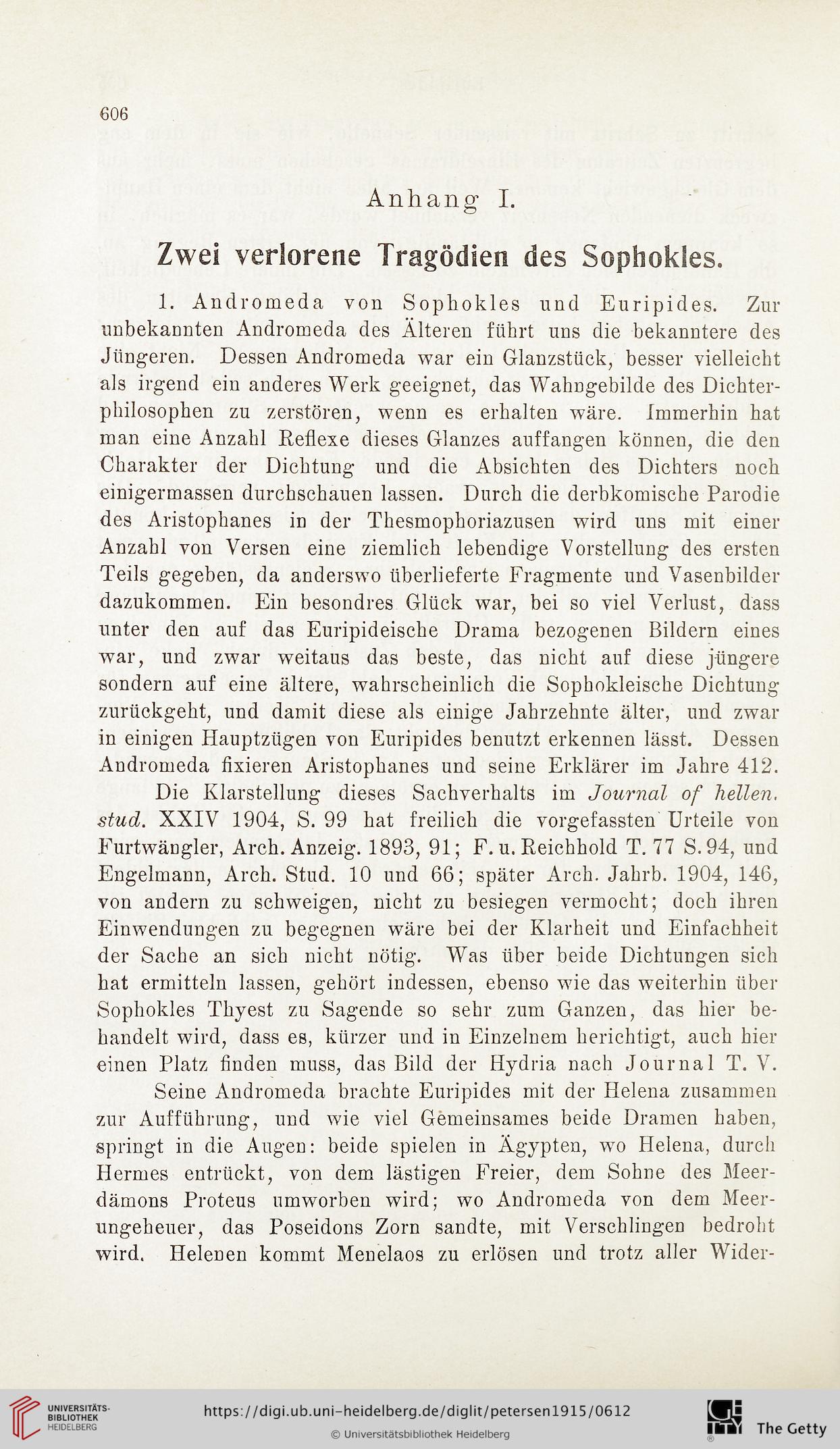606
Anhang I.
Zwei verlorene Tragödien des Sophokles.
1. Andromeda von Sophokles und Euripides. Zur
unbekannten Andromeda des Älteren führt uns die bekanntere des
Jüngeren. Dessen Andromeda war ein Glanzstück, besser vielleicht
als irgend ein anderes Werk geeignet, das Wahngebilde des Dichter-
philosophen zu zerstören, wenn es erhalten wäre. Immerhin hat
man eine Anzahl Reflexe dieses Glanzes auffangen können, die den
Charakter der Dichtung und die Absichten des Dichters noch
einigermassen durchschauen lassen. Durch die derbkomische Parodie
des Aristophanes in der Thesmophoriazusen wird uns mit einer
Anzahl von Versen eine ziemlich lebendige Vorstellung des ersten
Teils gegeben, da anderswo überlieferte Fragmente und Vasenbilder
dazukommen. Ein besondres Glück war, bei so viel Verlust, dass
unter den auf das Euripideische Drama bezogenen Bildern eines
war, und zwar weitaus das beste, das nicht auf diese jüngere
sondern auf eine ältere, wahrscheinlich die Sophokleische Dichtung
zurückgeht, und damit diese als einige Jahrzehnte älter, und zwar
in einigen Hauptzügen von Euripides benutzt erkennen lässt. Dessen
Andromeda fixieren Aristophanes und seine Erklärer im Jahre 412.
Die Klarstellung dieses Sachverhalts im Journal of hellen,
stud. XXIV 1904, S. 99 hat freilich die vorgefassten Urteile von
Furtwängler, Arch. Anzeig. 1893, 91; F. u. Reichhold T. 77 S. 94, und
Engelmann, Arch. Stud. 10 und 66; später Arch. Jahrb. 1904, 146,
von andern zu schweigen, nicht zu besiegen vermocht; doch ihren
Einwendungen zu begegnen wäre bei der Klarheit und Einfachheit
der Sache an sich nicht nötig. Was über beide Dichtungen sich
hat ermitteln lassen, gehört indessen, ebenso wie das weiterhin über
Sophokles Thyest zu Sagende so sehr zum Ganzen, das hier be-
handelt wird, dass es, kürzer und in Einzelnem berichtigt, auch hier
einen Platz finden muss, das Bild der Hydria nach Journal T. V.
Seine Andromeda brachte Euripides mit der Helena zusammen
zur Aufführung, und wie viel Gemeinsames beide Dramen haben,
springt in die Augen: beide spielen in Ägypten, wo Helena, durch
Hermes entrückt, von dem lästigen Freier, dem Sohne des Meer-
dämons Proteus umworben wird; wo Andromeda von dem Meer-
ungeheuer, das Poseidons Zorn sandte, mit Verschlingen bedroht
wird. Helenen kommt Menelaos zu erlösen und trotz aller Wider-
Anhang I.
Zwei verlorene Tragödien des Sophokles.
1. Andromeda von Sophokles und Euripides. Zur
unbekannten Andromeda des Älteren führt uns die bekanntere des
Jüngeren. Dessen Andromeda war ein Glanzstück, besser vielleicht
als irgend ein anderes Werk geeignet, das Wahngebilde des Dichter-
philosophen zu zerstören, wenn es erhalten wäre. Immerhin hat
man eine Anzahl Reflexe dieses Glanzes auffangen können, die den
Charakter der Dichtung und die Absichten des Dichters noch
einigermassen durchschauen lassen. Durch die derbkomische Parodie
des Aristophanes in der Thesmophoriazusen wird uns mit einer
Anzahl von Versen eine ziemlich lebendige Vorstellung des ersten
Teils gegeben, da anderswo überlieferte Fragmente und Vasenbilder
dazukommen. Ein besondres Glück war, bei so viel Verlust, dass
unter den auf das Euripideische Drama bezogenen Bildern eines
war, und zwar weitaus das beste, das nicht auf diese jüngere
sondern auf eine ältere, wahrscheinlich die Sophokleische Dichtung
zurückgeht, und damit diese als einige Jahrzehnte älter, und zwar
in einigen Hauptzügen von Euripides benutzt erkennen lässt. Dessen
Andromeda fixieren Aristophanes und seine Erklärer im Jahre 412.
Die Klarstellung dieses Sachverhalts im Journal of hellen,
stud. XXIV 1904, S. 99 hat freilich die vorgefassten Urteile von
Furtwängler, Arch. Anzeig. 1893, 91; F. u. Reichhold T. 77 S. 94, und
Engelmann, Arch. Stud. 10 und 66; später Arch. Jahrb. 1904, 146,
von andern zu schweigen, nicht zu besiegen vermocht; doch ihren
Einwendungen zu begegnen wäre bei der Klarheit und Einfachheit
der Sache an sich nicht nötig. Was über beide Dichtungen sich
hat ermitteln lassen, gehört indessen, ebenso wie das weiterhin über
Sophokles Thyest zu Sagende so sehr zum Ganzen, das hier be-
handelt wird, dass es, kürzer und in Einzelnem berichtigt, auch hier
einen Platz finden muss, das Bild der Hydria nach Journal T. V.
Seine Andromeda brachte Euripides mit der Helena zusammen
zur Aufführung, und wie viel Gemeinsames beide Dramen haben,
springt in die Augen: beide spielen in Ägypten, wo Helena, durch
Hermes entrückt, von dem lästigen Freier, dem Sohne des Meer-
dämons Proteus umworben wird; wo Andromeda von dem Meer-
ungeheuer, das Poseidons Zorn sandte, mit Verschlingen bedroht
wird. Helenen kommt Menelaos zu erlösen und trotz aller Wider-