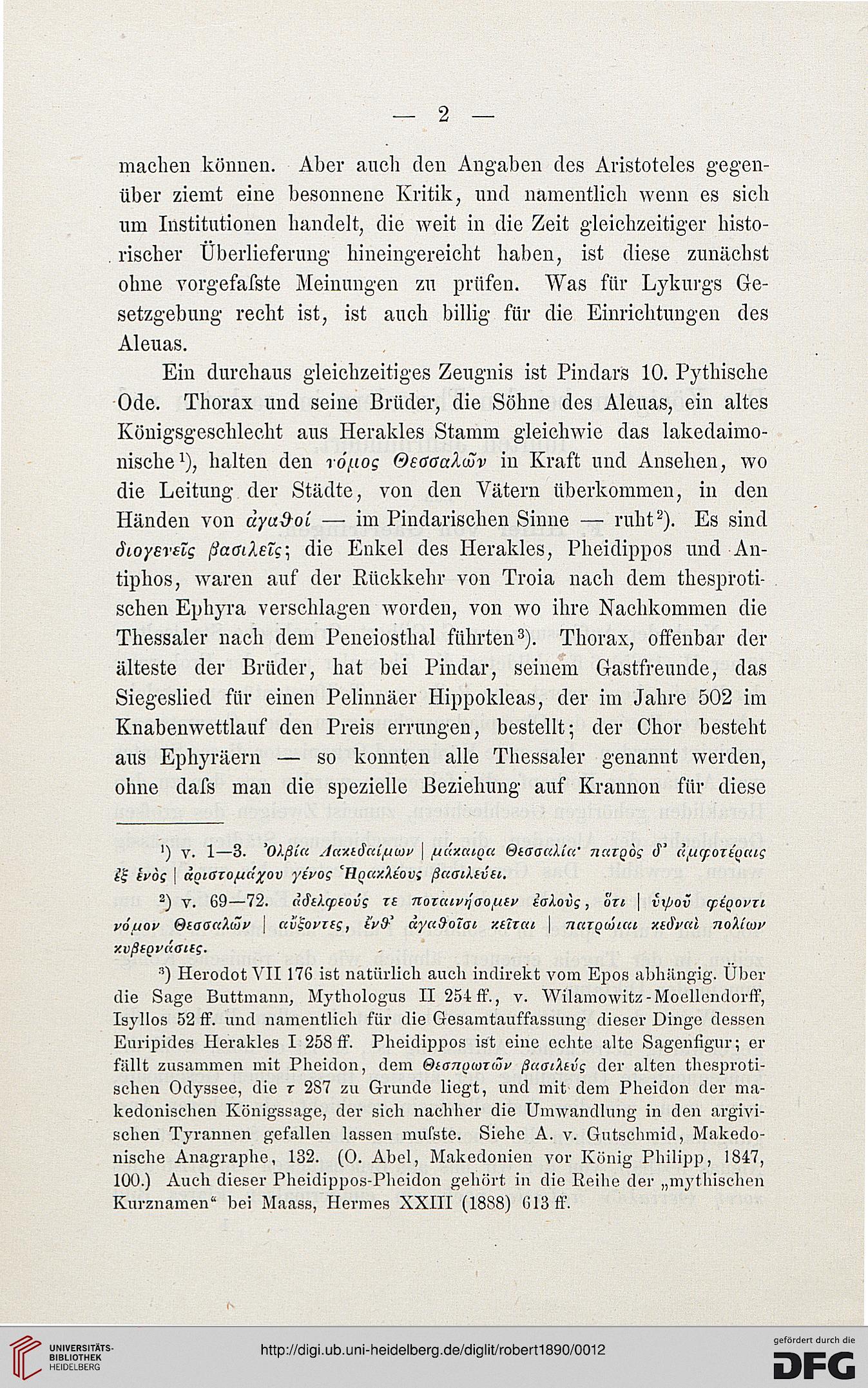— 2 —
machen können. Aber auch den Angaben des Aristoteles gegen-
über ziemt eine besonnene Kritik, und namentlich wenn es sich
um Institutionen handelt, die weit in die Zeit gleichzeitiger histo-
. rischer Überlieferung hineingereicht haben, ist diese zunächst
ohne vorgefafste Meinungen zu prüfen. Was für Lykurgs Ge-
setzgebung recht ist, ist auch billig für die Einrichtungen des
Aleuas.
Ein durchaus gleichzeitiges Zeugnis ist Pindars 10. Pythische
Ode. Thorax und seine Brüder, die Söhne des Aleuas, ein altes
Königsgeschlecht aus Herakles Stamm gleichwie das lakcdaimo-
nische1), halten den ro',aoc QeaaaXuv in Kraft und Ansehen, wo
die Leitung der Städte, von den Vätern überkommen, in den
Händen von uyad-oi — im Pindarischen Sinne — ruht2). Es sind
6ioysvslg ßaaiXeic; die Enkel des Herakles, Pheidippos und An-
tiphos, waren auf der Rückkehr von Troia nach dem thesproti-
schen Ephyra verschlagen worden, von wo ihre Nachkommen die
Thessaler nach dem Peneiosthal führten3). Thorax, offenbar der
älteste der Brüder, hat bei Pindar, seinem Gastfreunde, das
Siegeslied für einen Pelinnäer Hippokleas, der im Jahre 502 im
Knabenwettlauf den Preis errungen, bestellt; der Chor besteht
aus Ephyräern — so konnten alle Thessaler genannt werden,
ohne dafs man die spezielle Beziehung auf Krannon für diese
') v. 1—3. '0).ßi(c ÄttMättifimv \ ftaxatga QtaaaXia' nctTQog d" tt/itpoxigaig
i'| iv6g | aoiazofii'tyov yivog 'Hncix'Aiovg ficceü.ivet.
2) v. 69—72. aSO.cpiovg xt noTttiv>iao/Att> tolovg, ort | vi/jov cpioovxi
vouov QiaattXiäv i avioviig, tvfr' dycc!)oTai xelxai j naXQiuiai xsöueil nolimi'
v.vßiQvüaug.
s) Herodot VII 176 ist natürlich auch indirekt vom Epos abhängig. Uber
die Sage Buttmann, Mythologus II 254 ff., v. Wilamowitz-Moellendorff,
Isyllos 52 ff. und namentlich für die Gesamtauffassung dieser Dinge dessen
Euripides Herakles I 258 ff. Pheidippos ist eine echte alte Sagenfigur; er
füllt zusammen mit Pheidon, dem QtanoMXtöi' ßaailtvg der alten thesproti-
schen Odyssee, die r 287 zu Grunde liegt, und mit dem Pheidon der ma-
kedonischen Königssage, der sich nachher die Umwandlung in den argivi-
schen Tyrannen gefallen lassen mufstc. Siehe A. v. Gutschmid, Makedo-
nische Anagraphe, 132. (0. Abel, Makedonien vor König Philipp, 1847,
100.) Auch dieser Pheidippos-Pheidon gehört in die Reihe der „mythischen
Kurznamen" bei Maass, Hermes XXIII (1888) 613 ff.
machen können. Aber auch den Angaben des Aristoteles gegen-
über ziemt eine besonnene Kritik, und namentlich wenn es sich
um Institutionen handelt, die weit in die Zeit gleichzeitiger histo-
. rischer Überlieferung hineingereicht haben, ist diese zunächst
ohne vorgefafste Meinungen zu prüfen. Was für Lykurgs Ge-
setzgebung recht ist, ist auch billig für die Einrichtungen des
Aleuas.
Ein durchaus gleichzeitiges Zeugnis ist Pindars 10. Pythische
Ode. Thorax und seine Brüder, die Söhne des Aleuas, ein altes
Königsgeschlecht aus Herakles Stamm gleichwie das lakcdaimo-
nische1), halten den ro',aoc QeaaaXuv in Kraft und Ansehen, wo
die Leitung der Städte, von den Vätern überkommen, in den
Händen von uyad-oi — im Pindarischen Sinne — ruht2). Es sind
6ioysvslg ßaaiXeic; die Enkel des Herakles, Pheidippos und An-
tiphos, waren auf der Rückkehr von Troia nach dem thesproti-
schen Ephyra verschlagen worden, von wo ihre Nachkommen die
Thessaler nach dem Peneiosthal führten3). Thorax, offenbar der
älteste der Brüder, hat bei Pindar, seinem Gastfreunde, das
Siegeslied für einen Pelinnäer Hippokleas, der im Jahre 502 im
Knabenwettlauf den Preis errungen, bestellt; der Chor besteht
aus Ephyräern — so konnten alle Thessaler genannt werden,
ohne dafs man die spezielle Beziehung auf Krannon für diese
') v. 1—3. '0).ßi(c ÄttMättifimv \ ftaxatga QtaaaXia' nctTQog d" tt/itpoxigaig
i'| iv6g | aoiazofii'tyov yivog 'Hncix'Aiovg ficceü.ivet.
2) v. 69—72. aSO.cpiovg xt noTttiv>iao/Att> tolovg, ort | vi/jov cpioovxi
vouov QiaattXiäv i avioviig, tvfr' dycc!)oTai xelxai j naXQiuiai xsöueil nolimi'
v.vßiQvüaug.
s) Herodot VII 176 ist natürlich auch indirekt vom Epos abhängig. Uber
die Sage Buttmann, Mythologus II 254 ff., v. Wilamowitz-Moellendorff,
Isyllos 52 ff. und namentlich für die Gesamtauffassung dieser Dinge dessen
Euripides Herakles I 258 ff. Pheidippos ist eine echte alte Sagenfigur; er
füllt zusammen mit Pheidon, dem QtanoMXtöi' ßaailtvg der alten thesproti-
schen Odyssee, die r 287 zu Grunde liegt, und mit dem Pheidon der ma-
kedonischen Königssage, der sich nachher die Umwandlung in den argivi-
schen Tyrannen gefallen lassen mufstc. Siehe A. v. Gutschmid, Makedo-
nische Anagraphe, 132. (0. Abel, Makedonien vor König Philipp, 1847,
100.) Auch dieser Pheidippos-Pheidon gehört in die Reihe der „mythischen
Kurznamen" bei Maass, Hermes XXIII (1888) 613 ff.