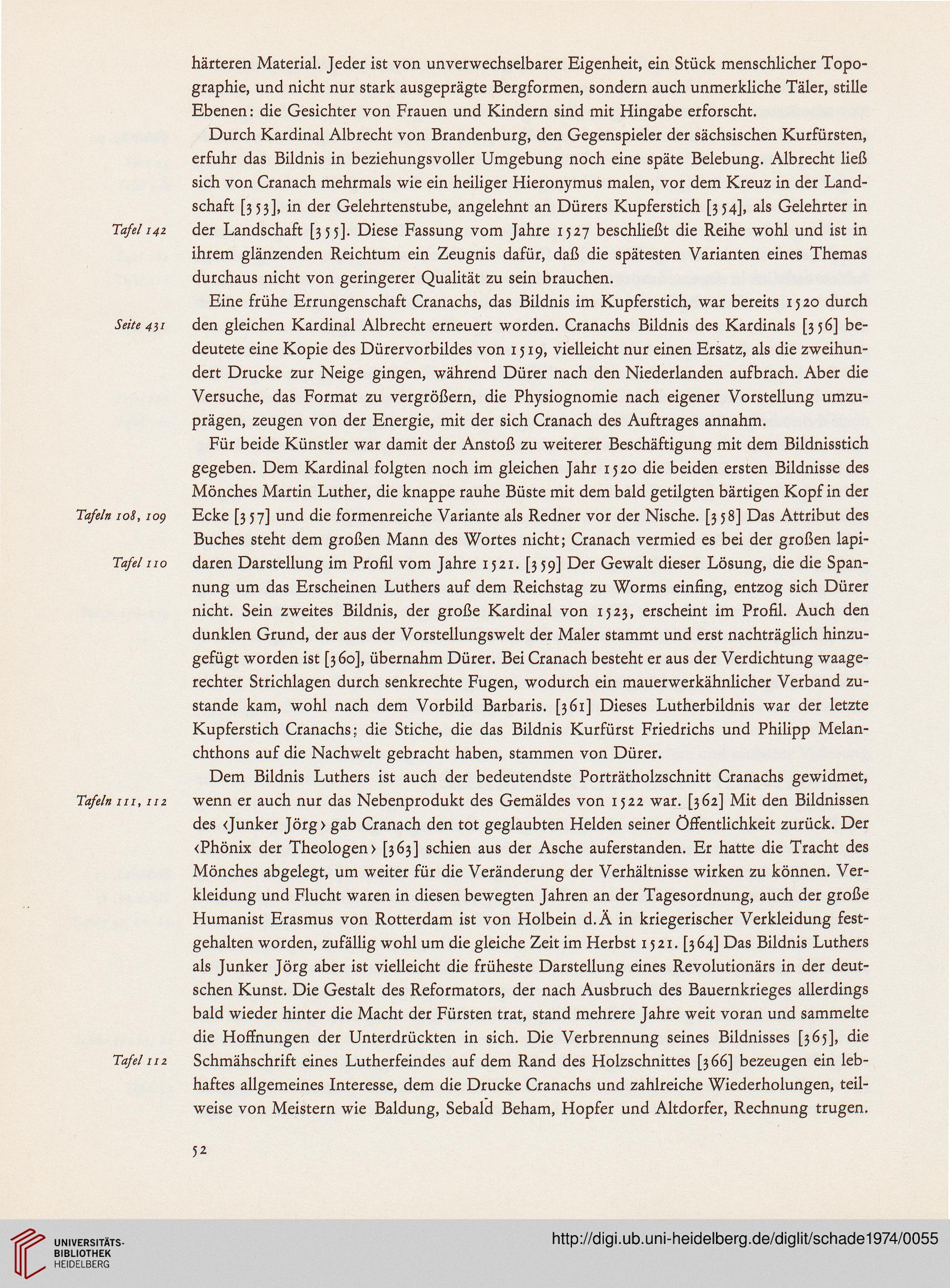härteren Material. Jeder ist von unverwechselbarer Eigenheit, ein Stück menschlicher Topo-
graphie, und nicht nur stark ausgeprägte Bergformen, sondern auch unmerkliche Täler, stille
Ebenen: die Gesichter von Frauen und Kindern sind mit Hingabe erforscht.
Durch Kardinal Albrecht von Brandenburg, den Gegenspieler der sächsischen Kurfürsten,
erfuhr das Bildnis in beziehungsvoller Umgebung noch eine späte Belebung. Albrecht ließ
sich von Cranach mehrmals wie ein heiliger Hieronymus malen, vor dem Kreuz in der Land-
schaft [353], in der Gelehrtenstube, angelehnt an Dürers Kupferstich [354], als Gelehrter in
Tafel 142 der Landschaft [355]. Diese Fassung vom Jahre 1527 beschließt die Reihe wohl und ist in
ihrem glänzenden Reichtum ein Zeugnis dafür, daß die spätesten Varianten eines Themas
durchaus nicht von geringerer Qualität zu sein brauchen.
Eine frühe Errungenschaft Cranachs, das Bildnis im Kupferstich, war bereits 1520 durch
Seite 4)1 den gleichen Kardinal Albrecht erneuert worden. Cranachs Bildnis des Kardinals [356] be-
deutete eine Kopie des Dürervorbildes von 1519, vielleicht nur einen Ersatz, als die zweihun-
dert Drucke zur Neige gingen, während Dürer nach den Niederlanden aufbrach. Aber die
Versuche, das Format zu vergrößern, die Physiognomie nach eigener Vorstellung umzu-
prägen, zeugen von der Energie, mit der sich Cranach des Auftrages annahm.
Für beide Künstler war damit der Anstoß zu weiterer Beschäftigung mit dem Bildnisstich
gegeben. Dem Kardinal folgten noch im gleichen Jahr 15 20 die beiden ersten Bildnisse des
Mönches Martin Luther, die knappe rauhe Büste mit dem bald getilgten bärtigen Kopf in der
Tafeln 10S, 109 Ecke [357] und die formenreiche Variante als Redner vor der Nische. [3 58] Das Attribut des
Buches steht dem großen Mann des Wortes nicht; Cranach vermied es bei der großen lapi-
Tafel 110 daren Darstellung im Profil vom Jahre 1521. [359] Der Gewalt dieser Lösung, die die Span-
nung um das Erscheinen Luthers auf dem Reichstag zu Worms einfing, entzog sich Dürer
nicht. Sein zweites Bildnis, der große Kardinal von 1523, erscheint im Profil. Auch den
dunklen Grund, der aus der Vorstellungswelt der Maler stammt und erst nachträglich hinzu-
gefügt worden ist [360], übernahm Dürer. Bei Cranach besteht er aus der Verdichtung waage-
rechter Strichlagen durch senkrechte Fugen, wodurch ein mauerwerkähnlicher Verband zu-
stande kam, wohl nach dem Vorbild Barbaris. [361] Dieses Lutherbildnis war der letzte
Kupferstich Cranachs; die Stiche, die das Bildnis Kurfürst Friedrichs und Philipp Melan-
chthons auf die Nachwelt gebracht haben, stammen von Dürer.
Dem Bildnis Luthers ist auch der bedeutendste Porträtholzschnitt Cranachs gewidmet,
Tafeln 111,112 wenn er auch nur das Nebenprodukt des Gemäldes von 1522 war. [362] Mit den Bildnissen
des <Junker Jörg> gab Cranach den tot geglaubten Helden seiner Öffentlichkeit zurück. Der
<Phönix der Theologen) [363] schien aus der Asche auferstanden. Er hatte die Tracht des
Mönches abgelegt, um weiter für die Veränderung der Verhältnisse wirken zu können. Ver-
kleidung und Flucht waren in diesen bewegten Jahren an der Tagesordnung, auch der große
Humanist Erasmus von Rotterdam ist von Holbein d.Ä in kriegerischer Verkleidung fest-
gehalten worden, zufällig wohl um die gleiche Zeit im Herbst 1521. [364] Das Bildnis Luthers
als Junker Jörg aber ist vielleicht die früheste Darstellung eines Revolutionärs in der deut-
schen Kunst. Die Gestalt des Reformators, der nach Ausbruch des Bauernkrieges allerdings
bald wieder hinter die Macht der Fürsten trat, stand mehrere Jahre weit voran und sammelte
die Hoffnungen der Unterdrückten in sich. Die Verbrennung seines Bildnisses [365], die
Tafel 112 Schmähschrift eines Lutherfeindes auf dem Rand des Holzschnittes [366] bezeugen ein leb-
haftes allgemeines Interesse, dem die Drucke Cranachs und zahlreiche Wiederholungen, teil-
weise von Meistern wie Baidung, Sebald Beham, Hopfer und Altdorfer, Rechnung trugen.
52
graphie, und nicht nur stark ausgeprägte Bergformen, sondern auch unmerkliche Täler, stille
Ebenen: die Gesichter von Frauen und Kindern sind mit Hingabe erforscht.
Durch Kardinal Albrecht von Brandenburg, den Gegenspieler der sächsischen Kurfürsten,
erfuhr das Bildnis in beziehungsvoller Umgebung noch eine späte Belebung. Albrecht ließ
sich von Cranach mehrmals wie ein heiliger Hieronymus malen, vor dem Kreuz in der Land-
schaft [353], in der Gelehrtenstube, angelehnt an Dürers Kupferstich [354], als Gelehrter in
Tafel 142 der Landschaft [355]. Diese Fassung vom Jahre 1527 beschließt die Reihe wohl und ist in
ihrem glänzenden Reichtum ein Zeugnis dafür, daß die spätesten Varianten eines Themas
durchaus nicht von geringerer Qualität zu sein brauchen.
Eine frühe Errungenschaft Cranachs, das Bildnis im Kupferstich, war bereits 1520 durch
Seite 4)1 den gleichen Kardinal Albrecht erneuert worden. Cranachs Bildnis des Kardinals [356] be-
deutete eine Kopie des Dürervorbildes von 1519, vielleicht nur einen Ersatz, als die zweihun-
dert Drucke zur Neige gingen, während Dürer nach den Niederlanden aufbrach. Aber die
Versuche, das Format zu vergrößern, die Physiognomie nach eigener Vorstellung umzu-
prägen, zeugen von der Energie, mit der sich Cranach des Auftrages annahm.
Für beide Künstler war damit der Anstoß zu weiterer Beschäftigung mit dem Bildnisstich
gegeben. Dem Kardinal folgten noch im gleichen Jahr 15 20 die beiden ersten Bildnisse des
Mönches Martin Luther, die knappe rauhe Büste mit dem bald getilgten bärtigen Kopf in der
Tafeln 10S, 109 Ecke [357] und die formenreiche Variante als Redner vor der Nische. [3 58] Das Attribut des
Buches steht dem großen Mann des Wortes nicht; Cranach vermied es bei der großen lapi-
Tafel 110 daren Darstellung im Profil vom Jahre 1521. [359] Der Gewalt dieser Lösung, die die Span-
nung um das Erscheinen Luthers auf dem Reichstag zu Worms einfing, entzog sich Dürer
nicht. Sein zweites Bildnis, der große Kardinal von 1523, erscheint im Profil. Auch den
dunklen Grund, der aus der Vorstellungswelt der Maler stammt und erst nachträglich hinzu-
gefügt worden ist [360], übernahm Dürer. Bei Cranach besteht er aus der Verdichtung waage-
rechter Strichlagen durch senkrechte Fugen, wodurch ein mauerwerkähnlicher Verband zu-
stande kam, wohl nach dem Vorbild Barbaris. [361] Dieses Lutherbildnis war der letzte
Kupferstich Cranachs; die Stiche, die das Bildnis Kurfürst Friedrichs und Philipp Melan-
chthons auf die Nachwelt gebracht haben, stammen von Dürer.
Dem Bildnis Luthers ist auch der bedeutendste Porträtholzschnitt Cranachs gewidmet,
Tafeln 111,112 wenn er auch nur das Nebenprodukt des Gemäldes von 1522 war. [362] Mit den Bildnissen
des <Junker Jörg> gab Cranach den tot geglaubten Helden seiner Öffentlichkeit zurück. Der
<Phönix der Theologen) [363] schien aus der Asche auferstanden. Er hatte die Tracht des
Mönches abgelegt, um weiter für die Veränderung der Verhältnisse wirken zu können. Ver-
kleidung und Flucht waren in diesen bewegten Jahren an der Tagesordnung, auch der große
Humanist Erasmus von Rotterdam ist von Holbein d.Ä in kriegerischer Verkleidung fest-
gehalten worden, zufällig wohl um die gleiche Zeit im Herbst 1521. [364] Das Bildnis Luthers
als Junker Jörg aber ist vielleicht die früheste Darstellung eines Revolutionärs in der deut-
schen Kunst. Die Gestalt des Reformators, der nach Ausbruch des Bauernkrieges allerdings
bald wieder hinter die Macht der Fürsten trat, stand mehrere Jahre weit voran und sammelte
die Hoffnungen der Unterdrückten in sich. Die Verbrennung seines Bildnisses [365], die
Tafel 112 Schmähschrift eines Lutherfeindes auf dem Rand des Holzschnittes [366] bezeugen ein leb-
haftes allgemeines Interesse, dem die Drucke Cranachs und zahlreiche Wiederholungen, teil-
weise von Meistern wie Baidung, Sebald Beham, Hopfer und Altdorfer, Rechnung trugen.
52