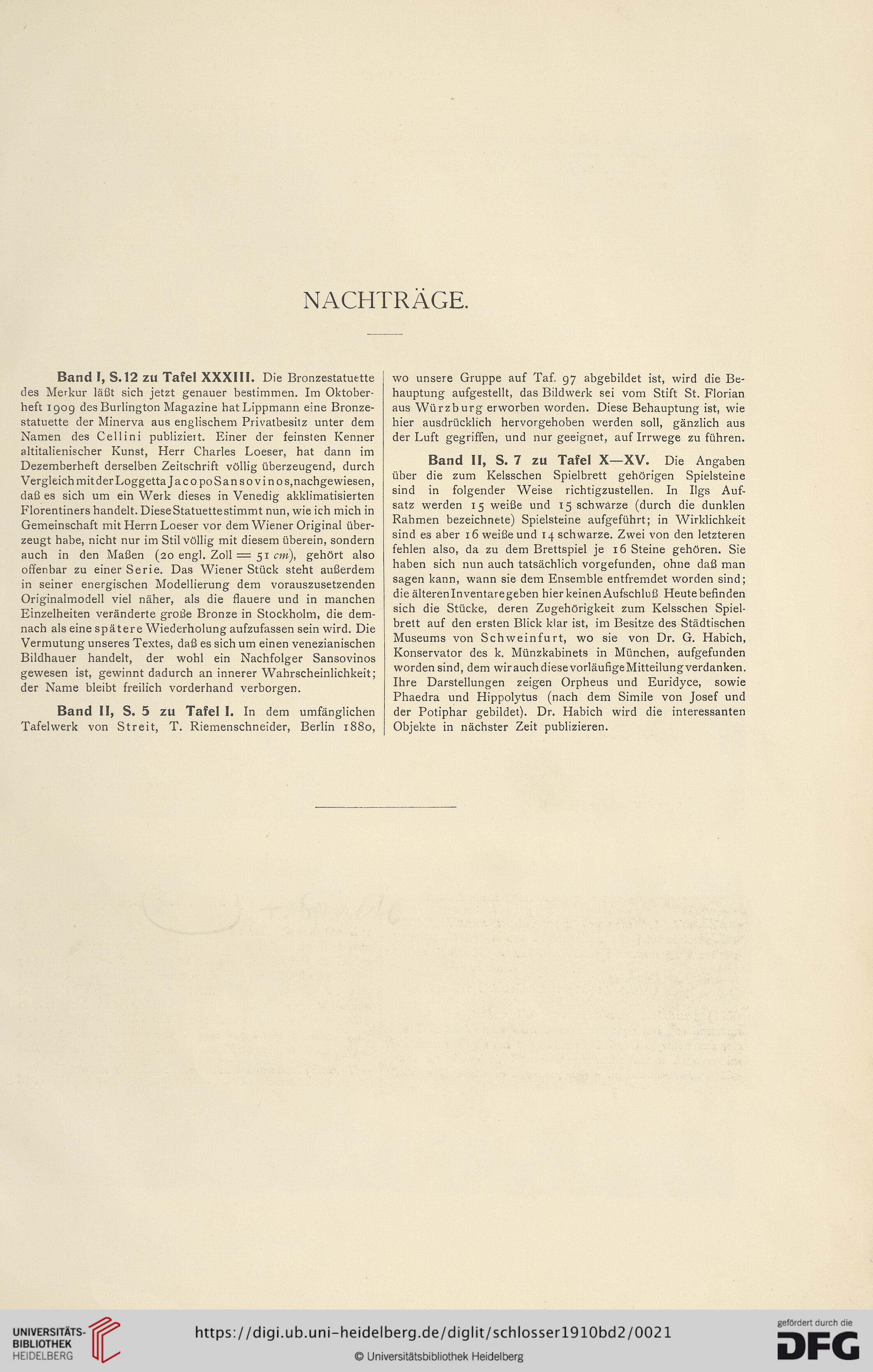NACHTRÄGE.
Band I, S. 12 zu Tafel XXXIII. Die Bronzestatuette
des Merkur läßt sich jetzt genauer bestimmen. Im Oktober-
heft 1909 des Burlington Magazine hatLippmann eine Bronze-
statuette der Minerva aus englischem Privatbesitz unter dem
Namen des Cellini publiziert. Einer der feinsten Kenner
altitalienischer Kunst, Herr Charles Loeser, hat dann im
Dezemberheft derselben Zeitschrift völlig überzeugend, durch
Vergleich mit der Loggetta J a copoSansovino s,nachgewiesen,
daß es sich um ein Werk dieses in Venedig akklimatisierten
Florentiners handelt. DieseStatuettestimmt nun, wie ich mich in
Gemeinschaft mit Herrn Loeser vor dem Wiener Original über-
zeugt habe, nicht nur im Stil völlig mit diesem überein, sondern
auch in den Maßen (20 engl. Zoll = 51 cm), gehört also
offenbar zu einer Serie. Das Wiener Stück steht außerdem
in seiner energischen Modellierung dem vorauszusetzenden
Originalmodell viel näher, als die flauere und in manchen
Einzelheiten veränderte große Bronze in Stockholm, die dem-
nach als eine spätere Wiederholung aufzufassen sein wird. Die
Vermutung unseres Textes, daß es sich um einen venezianischen
Bildhauer handelt, der wohl ein Nachfolger Sansovinos
gewesen ist, gewinnt dadurch an innerer Wahrscheinlichkeit;
der Name bleibt freilich vorderhand verborgen.
Band II, S. 5 zu Tafel I. In dem umfänglichen
Tafelwerk von Streit, T. Riemenschneider, Berlin 1880,
wo unsere Gruppe auf Taf. 97 abgebildet ist, wird die Be-
hauptung aufgestellt, das Bildwerk sei vom Stift St. Florian
aus Würzburg erworben worden. Diese Behauptung ist, wie
hier ausdrücklich hervorgehoben werden soll, gänzlich aus
der Luft gegriffen, und nur geeignet, auf Irrwege zu führen.
Band II, S. 7 zu Tafel X—XV. Die Angaben
über die zum Kelsschen Spielbrett gehörigen Spielsteine
sind in folgender Weise richtigzustellen. In Ilgs Auf-
satz werden 15 weiße und 15 schwärze (durch die dunklen
Rahmen bezeichnete) Spielsteine aufgeführt; in Wirklichkeit
sind es aber 16 weiße und 14 schwarze. Zwei von den letzteren
fehlen also, da zu dem Brettspiel je 16 Steine gehören. Sie
haben sich nun auch tatsächlich vorgefunden, ohne daß man
sagen kann, wann sie dem Ensemble entfremdet worden sind;
die älteren Inventare geben hier keinen Aufschluß Heute befinden
sich die Stücke, deren Zugehörigkeit zum Kelsschen Spiel-
brett auf den ersten Blick klar ist, im Besitze des Städtischen
Museums von Schweinfurt, wo sie von Dr. G. Habich,
Konservator des k. Münzkabinets in München, aufgefunden
worden sind, dem wirauchdiesevorläufigeMitteilungverdanken.
Ihre Darstellungen zeigen Orpheus und Euridyce, sowie
Phaedra und Hippolytus (nach dem Simile von Josef und
der Potiphar gebildet). Dr. Habich wird die interessanten
Objekte in nächster Zeit publizieren.
Band I, S. 12 zu Tafel XXXIII. Die Bronzestatuette
des Merkur läßt sich jetzt genauer bestimmen. Im Oktober-
heft 1909 des Burlington Magazine hatLippmann eine Bronze-
statuette der Minerva aus englischem Privatbesitz unter dem
Namen des Cellini publiziert. Einer der feinsten Kenner
altitalienischer Kunst, Herr Charles Loeser, hat dann im
Dezemberheft derselben Zeitschrift völlig überzeugend, durch
Vergleich mit der Loggetta J a copoSansovino s,nachgewiesen,
daß es sich um ein Werk dieses in Venedig akklimatisierten
Florentiners handelt. DieseStatuettestimmt nun, wie ich mich in
Gemeinschaft mit Herrn Loeser vor dem Wiener Original über-
zeugt habe, nicht nur im Stil völlig mit diesem überein, sondern
auch in den Maßen (20 engl. Zoll = 51 cm), gehört also
offenbar zu einer Serie. Das Wiener Stück steht außerdem
in seiner energischen Modellierung dem vorauszusetzenden
Originalmodell viel näher, als die flauere und in manchen
Einzelheiten veränderte große Bronze in Stockholm, die dem-
nach als eine spätere Wiederholung aufzufassen sein wird. Die
Vermutung unseres Textes, daß es sich um einen venezianischen
Bildhauer handelt, der wohl ein Nachfolger Sansovinos
gewesen ist, gewinnt dadurch an innerer Wahrscheinlichkeit;
der Name bleibt freilich vorderhand verborgen.
Band II, S. 5 zu Tafel I. In dem umfänglichen
Tafelwerk von Streit, T. Riemenschneider, Berlin 1880,
wo unsere Gruppe auf Taf. 97 abgebildet ist, wird die Be-
hauptung aufgestellt, das Bildwerk sei vom Stift St. Florian
aus Würzburg erworben worden. Diese Behauptung ist, wie
hier ausdrücklich hervorgehoben werden soll, gänzlich aus
der Luft gegriffen, und nur geeignet, auf Irrwege zu führen.
Band II, S. 7 zu Tafel X—XV. Die Angaben
über die zum Kelsschen Spielbrett gehörigen Spielsteine
sind in folgender Weise richtigzustellen. In Ilgs Auf-
satz werden 15 weiße und 15 schwärze (durch die dunklen
Rahmen bezeichnete) Spielsteine aufgeführt; in Wirklichkeit
sind es aber 16 weiße und 14 schwarze. Zwei von den letzteren
fehlen also, da zu dem Brettspiel je 16 Steine gehören. Sie
haben sich nun auch tatsächlich vorgefunden, ohne daß man
sagen kann, wann sie dem Ensemble entfremdet worden sind;
die älteren Inventare geben hier keinen Aufschluß Heute befinden
sich die Stücke, deren Zugehörigkeit zum Kelsschen Spiel-
brett auf den ersten Blick klar ist, im Besitze des Städtischen
Museums von Schweinfurt, wo sie von Dr. G. Habich,
Konservator des k. Münzkabinets in München, aufgefunden
worden sind, dem wirauchdiesevorläufigeMitteilungverdanken.
Ihre Darstellungen zeigen Orpheus und Euridyce, sowie
Phaedra und Hippolytus (nach dem Simile von Josef und
der Potiphar gebildet). Dr. Habich wird die interessanten
Objekte in nächster Zeit publizieren.