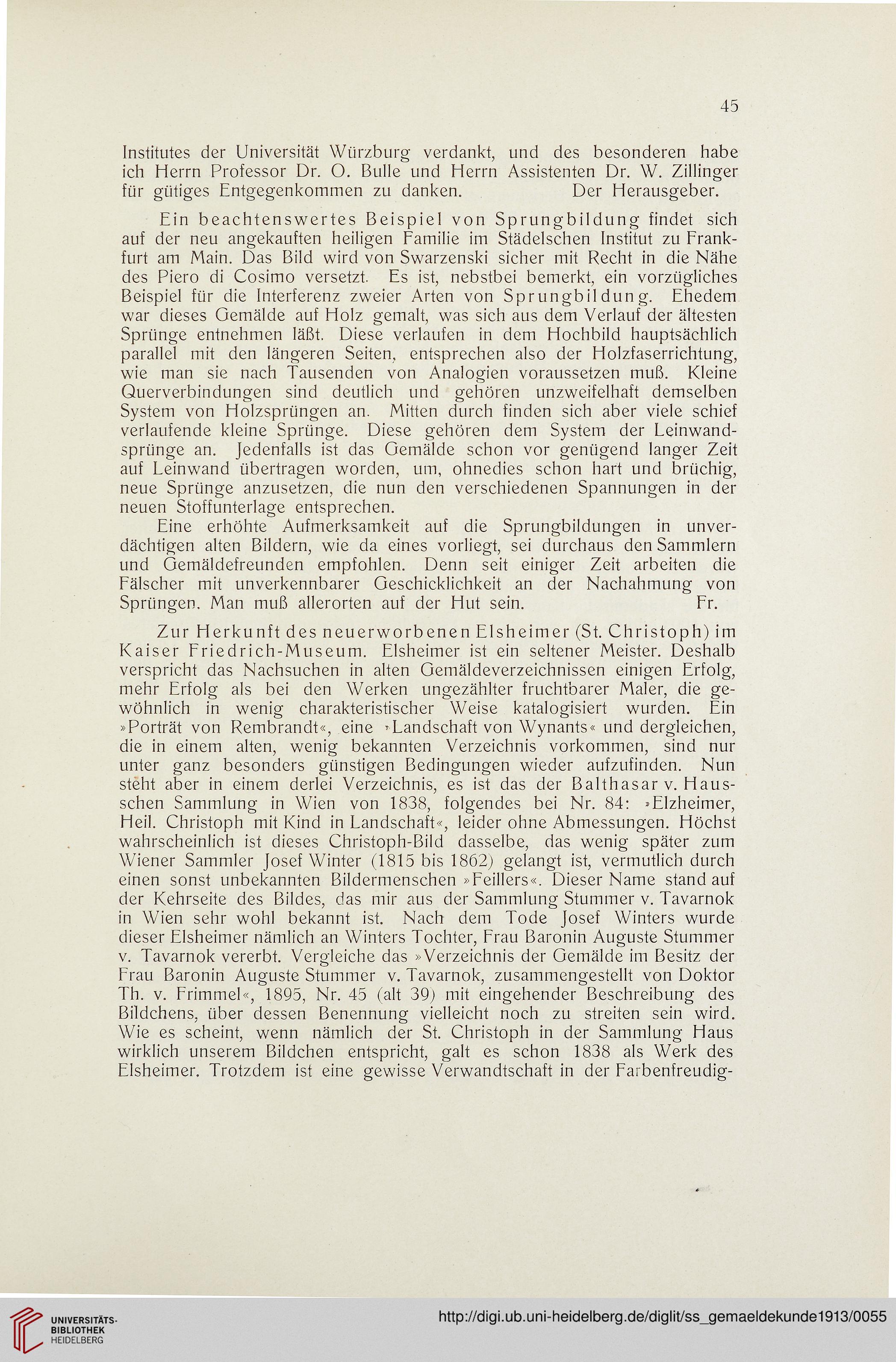45
Institutes der Universität Würzburg verdankt, und des besonderen habe
ich Herrn Professor Dr. O. Bulle und Herrn Assistenten Dr. W. Ziiiinger
für gütiges Entgegenkommen zu danken. Der Herausgeber.
Ein beachtenswertes Beispiel von Sprungbiidung findet sich
auf der neu angekauften heiiigen Familie im Städelschen institut zu Frank-
furt am Main. Das Bild wird von Swarzenski sicher mit Recht in die Nähe
des Piero di Cosimo versetzt. Es ist, nebstbei bemerkt, ein vorzügliches
Beispiel für die Interferenz zweier Arten von Sprungbildung. Ehedem
war dieses Gemälde auf Holz gemalt, was sich aus dem Verlauf der ältesten
Sprünge entnehmen läßt. Diese verlaufen in dem Hochbild hauptsächlich
parallel mit den längeren Seiten, entsprechen also der Holzfaserrichtung,
wie man sie nach Tausenden von Analogien voraussetzen muß. Kleine
Querverbindungen sind deutlich und gehören unzweifelhaft demselben
System von Holzsprüngen an. Mitten durch finden sich aber viele schief
verlaufende kleine Sprünge. Diese gehören dem System der Leinwand-
sprünge an. Jedenfalls ist das Gemälde schon vor genügend langer Zeit
auf Leinwand übertragen worden, um, ohnedies schon hart und brüchig,
neue Sprünge anzusetzen, die nun den verschiedenen Spannungen in der
neuen Stoffunterlage entsprechen.
Eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Sprungbildungen in unver-
dächtigen alten Bildern, wie da eines vorliegt, sei durchaus den Sammlern
und Gemäldefreunden empfohlen. Denn seit einiger Zeit arbeiten die
Fälscher mit unverkennbarer Geschicklichkeit an der Nachahmung von
Sprüngen. Man muß allerorten auf der Hut sein. Fr.
Zur Herkunft des neuerworbenen Elsheimer (St. Christoph) im
Kaiser Friedrich-Museum. Elsheimer ist ein seltener Meister. Deshalb
verspricht das Nachsuchen in alten Gemäldeverzeichnissen einigen Erfolg,
mehr Erfolg als bei den Werken ungezählter fruchtbarer Maler, die ge-
wöhnlich in wenig charakteristischer Weise katalogisiert wurden. Ein
»Porträt von Rembrandt«, eine 'Landschaft von Wynants« und dergleichen,
die in einem alten, wenig bekannten Verzeichnis Vorkommen, sind nut-
unter ganz besonders günstigen Bedingungen wieder aufzufinden. Nun
steht aber in einem derlei Verzeichnis, es ist das der Balthasar v.Haus-
schen Sammlung in Wien von 1838, folgendes bei Nr. 84: »Elzheimer,
Heil. Christoph mit Kind in Landschaft«, leider ohne Abmessungen. Höchst
wahrscheinlich ist dieses Christoph-Bild dasselbe, das wenig später zum
Wiener Sammler Josef Winter (1815 bis 1862) gelangt ist, vermutlich durch
einen sonst unbekannten Bildermenschen »FeiHers«. Dieser Name stand auf
der Kehrseite des Bildes, das mir aus der Sammlung Stummer v. Tavarnok
in Wien sehr wohl bekannt ist. Nach dem Tode Josef Winters wurde
dieser Elsheimer nämlich an Winters Tochter, Frau Baronin Auguste Stummer
v. Tavarnok vererbt. Vergleiche das »Verzeichnis der Gemälde im Besitz der
Frau Baronin Auguste Stummer v. Tavarnok, zusammengestellt von Doktor
Th. v. Frimmel«, 1895, Nr. 45 (alt 39) mit eingehender Beschreibung des
Bildchens, über dessen Benennung vielleicht noch zu streiten sein wird.
Wie es scheint, wenn nämlich der St. Christoph in der Sammlung Haus
wirklich unserem Bildchen entspricht, galt es schon 1838 als Werk des
Elsheimer. Trotzdem ist eine gewisse Verwandtschaft in der Farbenfreudig-
Institutes der Universität Würzburg verdankt, und des besonderen habe
ich Herrn Professor Dr. O. Bulle und Herrn Assistenten Dr. W. Ziiiinger
für gütiges Entgegenkommen zu danken. Der Herausgeber.
Ein beachtenswertes Beispiel von Sprungbiidung findet sich
auf der neu angekauften heiiigen Familie im Städelschen institut zu Frank-
furt am Main. Das Bild wird von Swarzenski sicher mit Recht in die Nähe
des Piero di Cosimo versetzt. Es ist, nebstbei bemerkt, ein vorzügliches
Beispiel für die Interferenz zweier Arten von Sprungbildung. Ehedem
war dieses Gemälde auf Holz gemalt, was sich aus dem Verlauf der ältesten
Sprünge entnehmen läßt. Diese verlaufen in dem Hochbild hauptsächlich
parallel mit den längeren Seiten, entsprechen also der Holzfaserrichtung,
wie man sie nach Tausenden von Analogien voraussetzen muß. Kleine
Querverbindungen sind deutlich und gehören unzweifelhaft demselben
System von Holzsprüngen an. Mitten durch finden sich aber viele schief
verlaufende kleine Sprünge. Diese gehören dem System der Leinwand-
sprünge an. Jedenfalls ist das Gemälde schon vor genügend langer Zeit
auf Leinwand übertragen worden, um, ohnedies schon hart und brüchig,
neue Sprünge anzusetzen, die nun den verschiedenen Spannungen in der
neuen Stoffunterlage entsprechen.
Eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Sprungbildungen in unver-
dächtigen alten Bildern, wie da eines vorliegt, sei durchaus den Sammlern
und Gemäldefreunden empfohlen. Denn seit einiger Zeit arbeiten die
Fälscher mit unverkennbarer Geschicklichkeit an der Nachahmung von
Sprüngen. Man muß allerorten auf der Hut sein. Fr.
Zur Herkunft des neuerworbenen Elsheimer (St. Christoph) im
Kaiser Friedrich-Museum. Elsheimer ist ein seltener Meister. Deshalb
verspricht das Nachsuchen in alten Gemäldeverzeichnissen einigen Erfolg,
mehr Erfolg als bei den Werken ungezählter fruchtbarer Maler, die ge-
wöhnlich in wenig charakteristischer Weise katalogisiert wurden. Ein
»Porträt von Rembrandt«, eine 'Landschaft von Wynants« und dergleichen,
die in einem alten, wenig bekannten Verzeichnis Vorkommen, sind nut-
unter ganz besonders günstigen Bedingungen wieder aufzufinden. Nun
steht aber in einem derlei Verzeichnis, es ist das der Balthasar v.Haus-
schen Sammlung in Wien von 1838, folgendes bei Nr. 84: »Elzheimer,
Heil. Christoph mit Kind in Landschaft«, leider ohne Abmessungen. Höchst
wahrscheinlich ist dieses Christoph-Bild dasselbe, das wenig später zum
Wiener Sammler Josef Winter (1815 bis 1862) gelangt ist, vermutlich durch
einen sonst unbekannten Bildermenschen »FeiHers«. Dieser Name stand auf
der Kehrseite des Bildes, das mir aus der Sammlung Stummer v. Tavarnok
in Wien sehr wohl bekannt ist. Nach dem Tode Josef Winters wurde
dieser Elsheimer nämlich an Winters Tochter, Frau Baronin Auguste Stummer
v. Tavarnok vererbt. Vergleiche das »Verzeichnis der Gemälde im Besitz der
Frau Baronin Auguste Stummer v. Tavarnok, zusammengestellt von Doktor
Th. v. Frimmel«, 1895, Nr. 45 (alt 39) mit eingehender Beschreibung des
Bildchens, über dessen Benennung vielleicht noch zu streiten sein wird.
Wie es scheint, wenn nämlich der St. Christoph in der Sammlung Haus
wirklich unserem Bildchen entspricht, galt es schon 1838 als Werk des
Elsheimer. Trotzdem ist eine gewisse Verwandtschaft in der Farbenfreudig-