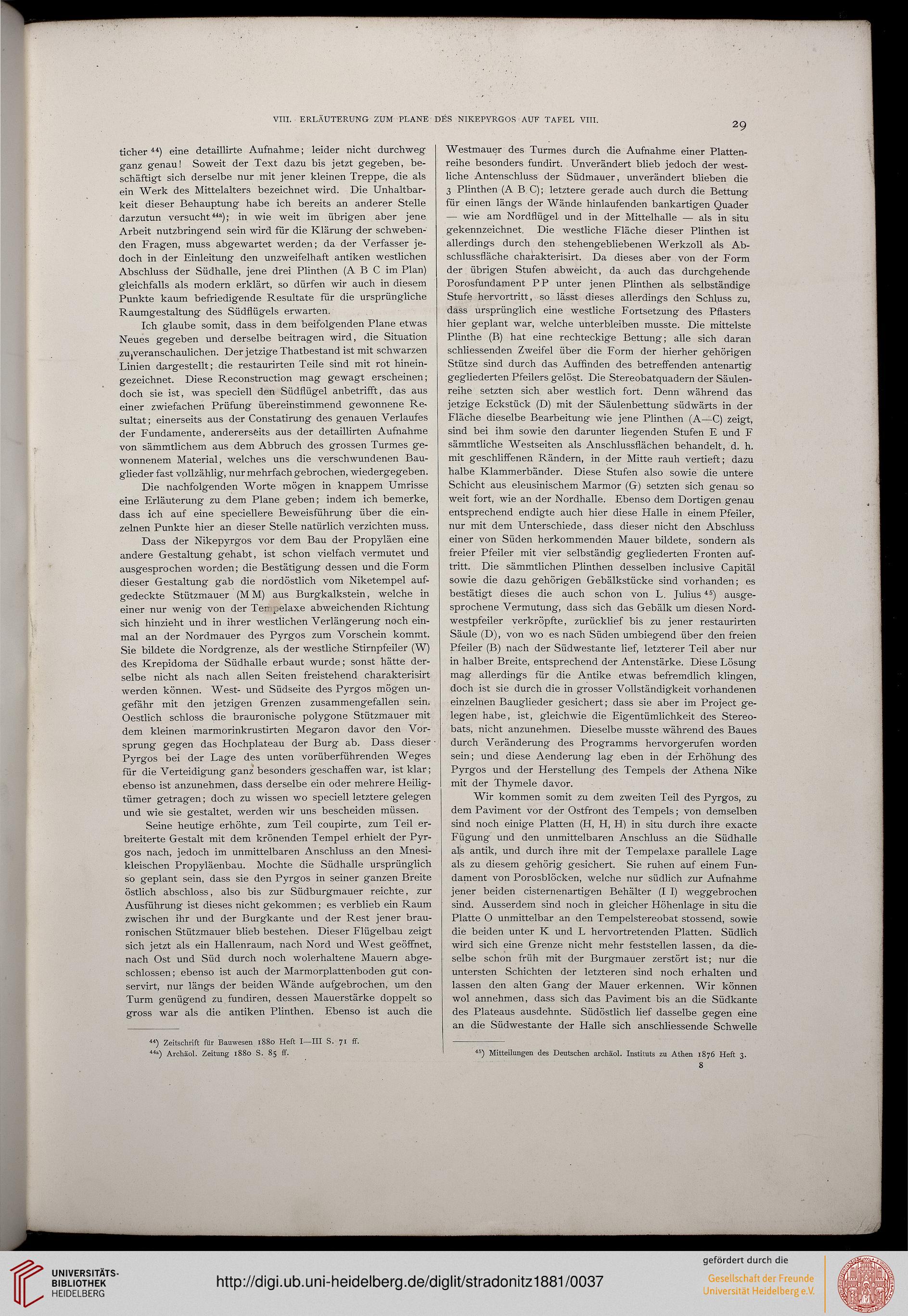VIII. ERLÄUTERUNG ZUM PLANE DES NIKEPYRGOS AUF TAFEL VIII.
29
ticher44) eine detaillirte Aufnahme; leider nicht durchweg
ganz genau! Soweit der Text dazu bis jetzt gegeben, be-
schäftigt sich derselbe nur mit jener kleinen Treppe, die als
ein Werk des Mittelalters bezeichnet wird. Die Unhaltbar-
keit dieser Behauptung habe ich bereits an anderer Stelle
darzutun versucht44"); in wie weit im übrigen aber jene
Arbeit nutzbringend sein wird für die Klärung der schweben-
den Fragen, muss abgewartet werden; da der Verfasser je-
doch in der Einleitung den unzweifelhaft antiken westlichen
Abschluss der Südhalle, jene drei Plinthen (A B C im Plan)
gleichfalls als modern erklärt, so dürfen wir auch in diesem
Punkte kaum befriedigende Resultate für die ursprüngliche
Raumgestaltung des Südflügels erwarten.
Ich glaube somit, dass in dem,beifolgenden Plane etwas
Neues gegeben und derselbe beitragen wird, die Situation
zu veranschaulichen. Der jetzige Thatbestand ist mit schwarzen
Linien dargestellt; die restaurirten Teile sind mit rot hinein-
gezeichnet. Diese Reconstruction mag gewagt erscheinen;
doch sie ist, was speciell den Südflügel anbetrifft, das aus
einer zwiefachen Prüfung übereinstimmend gewonnene Re-
sultat ; einerseits aus der Constatirung des genauen Verlaufes
der Fundamente, andererseits aus der detaillirten Aufnahme
von sämmtlichem aus dem Abbruch des grossen Turmes ge-
wonnenem Material, welches uns die verschwundenen Bau-
glieder fast vollzählig, nur mehrfach gebrochen, wiedergegeben.
Die nachfolgenden Worte mögen in knappem Umrisse
eine Erläuterung zu dem Plane geben; indem ich bemerke,
dass ich auf eine speciellere Beweisführung über die ein-
zelnen Punkte hier an dieser Stelle natürlich verzichten muss.
Dass der Nikepyrgos vor dem Bau der Propyläen eine
andere Gestaltung gehabt, ist schon vielfach vermutet und
ausgesprochen worden; die Bestätigung dessen und die Form
dieser Gestaltung gab die nordöstlich vom Niketempel auf-
gedeckte Stützmauer (MM) aus Burgkalkstein, welche in
einer nur wenig von der Terr pelaxe abweichenden Richtung
sich hinzieht und in ihrer westlichen Verlängerung noch ein-
mal an der Nordmauer des Pyrgos zum Vorschein kommt.
Sie bildete die Nordgrenze, als der westliche Stirnpfeiler (W)
des Krepidoma der Südhalle erbaut wurde; sonst hätte der-
selbe nicht als nach allen Seiten freistehend charakterisirt
werden können. West- und Südseite des Pyrgos mögen un-
gefähr mit den jetzigen Grenzen zusammengefallen sein.
Oestlich schloss die brauronische polygone Stützmauer mit
dem kleinen marmorinkrustirten Megaron davor den Vor-
sprung gegen das Hochplateau der Burg ab. Dass dieser
Pyrgos bei der Lage des unten vorüberführenden Weges
für die Verteidigung ganz besonders geschaffen war, ist klar;
ebenso ist anzunehmen, dass derselbe ein oder mehrere Heilig-
tümer getragen; doch zu wissen wo speciell letztere gelegen
und wie sie gestaltet, werden wir uns bescheiden müssen.
Seine heutige erhöhte, zum Teil coupirte, zum Teil er-
weiterte Gestalt mit dem krönenden Tempel erhielt der Pyr-
gos nach, jedoch im unmittelbaren Anschluss an den Mnesi-
kleischen Propyläenbau. Mochte die Südhalle ursprünglich
so geplant sein, dass sie den Pyrgos in seiner ganzen Breite
östlich abschloss, also bis zur Südburgmauer reichte, zur
Ausführung ist dieses nicht gekommen; es verblieb ein Raum
zwischen ihr und der Burgkante und der Rest jener brau-
ronischen Stützmauer blieb bestehen. Dieser Flügelbau zeigt
sich jetzt als ein Hallenraum, nach Nord und West geöffnet,
nach Ost und Süd durch noch wolerhaltene Mauern abge-
schlossen ; ebenso ist auch der Marmorplattenboden gut con-
servirt, nur längs der beiden Wände aufgebrochen, um den
Turm genügend zu fundiren, dessen Mauerstärke doppelt so
gross war als die antiken Plinthen. Ebenso ist auch die
44) Zeitschrift für Bauwesen 1880 Heft I—III S. 71 ff.
"*) Archäol. Zeitung 1880 S. 85 ff.
Westmauer des Turmes durch die Aufnahme einer Platten-
reihe besonders fundirt. Unverändert blieb jedoch der west-
liche Antenschluss der Südmauer, unverändert blieben die
3 Plinthen (A B C); letztere gerade auch durch die Bettung
für einen längs der Wände hinlaufenden bankartigen Quader
— wie am Nordflügel und in der Mittelhalle — als in situ
gekennzeichnet. Die westliche Fläche dieser Plinthen ist
allerdings durch den, stehengebliebenen Werkzoll als Ab-
schlüssfläche charakterisirt. Da dieses aber von der Form
der übrigen Stufen abweicht, da auch das durchgehende
Porosfundament PP unter jenen Plinthen als selbständige
Stufe hervortritt, so lässt dieses allerdings den Schluss zu,
dass ursprünglich eine westliche Fortsetzung des Pflasters
hier geplant war, welche unterbleiben musste. Die mittelste
Plinthe (B) hat eine rechteckige Bettung; alle sich daran
schliessenden Zweifel über die Form der hierher gehörigen
Stütze sind durch das Auffinden des betreffenden antenartig
gegliederten Pfeilers gelöst. Die Stereobatquadern der Säulen-
reihe setzten sich aber westlich fort. Denn während das
jetzige Eckstück (D) mit der Säulenbettung südwärts in der
Fläche dieselbe Bearbeitung wie jene Plinthen (A—C) zeigt,
sind bei ihm sowie den darunter liegenden Stufen E und F
sämmtliche Westseiten als Anschlussflächen behandelt, d. h.
mit geschliffenen Rändern, in der Mitte rauh vertieft; dazu
halbe Klammerbänder. Diese Stufen also sowie die untere
Schicht aus eleusinischem Marmor (G) setzten sich genau so
weit fort, wie an der Nordhalle. Ebenso dem Dortigen genau
entsprechend endigte auch hier diese Halle in einem Pfeiler,
nur mit dem Unterschiede, dass dieser nicht den Abschluss
einer von Süden herkommenden Mauer bildete, sondern als
freier Pfeiler mit vier selbständig gegliederten Fronten auf-
tritt. Die sämmtlichen Plinthen desselben inclusive Capital
sowie die dazu gehörigen Gebälkstücke sind vorhanden; es
bestätigt dieses die auch schon von L. Julius45) ausge-
sprochene Vermutung, dass sich das Gebälk um diesen Nord-
westpfeiler verkröpfte, zurücklief bis zu jener restaurirten
Säule (D), von wo es nach Süden umbiegend über den freien
Pfeiler (B) nach der Südwestante lief, letzterer Teil aber nur
in halber Breite, entsprechend der Antenstärke. Diese Lösung
mag allerdings für die Antike etwas befremdlich klingen,
doch ist sie durch die in grosser Vollständigkeit vorhandenen
einzelnen Bauglieder gesichert; dass sie aber im Project ge-
legen habe, ist, gleichwie die Eigentümlichkeit des Stereo-
bats, nicht anzunehmen. Dieselbe musste während des Baues
durch Veränderung des Programms hervorgerufen worden
sein; und diese Aenderung lag eben in der Erhöhung des
Pyrgos und der Herstellung des Tempels der Athena Nike
mit der Thymele davor.
Wir kommen somit zu dem zweiten Teil des Pyrgos, zu
dem Paviment vor der Ostfront des Tempels; von demselben
sind noch einige Platten (H, H, H) in situ durch ihre exacte
Fügung und den unmittelbaren Anschluss an die Südhalle
aljs antik, und durch ihre mit der Tempelaxe parallele Lage
als zu diesem gehörig gesichert. Sie ruhen auf einem Fun-
dament von Porosblöcken, welche nur südlich zur Aufnahme
jener beiden cisternenartigen Behälter (I I) weggebrochen
sind. Ausserdem sind noch in gleicher Höhenlage in situ die
Platte O unmittelbar an den Tempelstereobat stossend, sowie
die beiden unter K und L hervortretenden Platten. Südlich
wird sich eine Grenze nicht mehr feststellen lassen, da die-
selbe schon früh mit der Burgmauer zerstört ist; nur die
untersten Schichten der letzteren sind noch erhalten und
lassen den alten Gang der Mauer erkennen. Wir können
wol annehmen, dass sich das Paviment bis an die Südkante
des Plateaus ausdehnte. Südöstlich lief dasselbe gegen eine
an die Südwestante der Halle sich anschliessende Schwelle
45) Mitteilungen des Deutschen archäol. Instituts zu Athen 1876 Heft 3.
29
ticher44) eine detaillirte Aufnahme; leider nicht durchweg
ganz genau! Soweit der Text dazu bis jetzt gegeben, be-
schäftigt sich derselbe nur mit jener kleinen Treppe, die als
ein Werk des Mittelalters bezeichnet wird. Die Unhaltbar-
keit dieser Behauptung habe ich bereits an anderer Stelle
darzutun versucht44"); in wie weit im übrigen aber jene
Arbeit nutzbringend sein wird für die Klärung der schweben-
den Fragen, muss abgewartet werden; da der Verfasser je-
doch in der Einleitung den unzweifelhaft antiken westlichen
Abschluss der Südhalle, jene drei Plinthen (A B C im Plan)
gleichfalls als modern erklärt, so dürfen wir auch in diesem
Punkte kaum befriedigende Resultate für die ursprüngliche
Raumgestaltung des Südflügels erwarten.
Ich glaube somit, dass in dem,beifolgenden Plane etwas
Neues gegeben und derselbe beitragen wird, die Situation
zu veranschaulichen. Der jetzige Thatbestand ist mit schwarzen
Linien dargestellt; die restaurirten Teile sind mit rot hinein-
gezeichnet. Diese Reconstruction mag gewagt erscheinen;
doch sie ist, was speciell den Südflügel anbetrifft, das aus
einer zwiefachen Prüfung übereinstimmend gewonnene Re-
sultat ; einerseits aus der Constatirung des genauen Verlaufes
der Fundamente, andererseits aus der detaillirten Aufnahme
von sämmtlichem aus dem Abbruch des grossen Turmes ge-
wonnenem Material, welches uns die verschwundenen Bau-
glieder fast vollzählig, nur mehrfach gebrochen, wiedergegeben.
Die nachfolgenden Worte mögen in knappem Umrisse
eine Erläuterung zu dem Plane geben; indem ich bemerke,
dass ich auf eine speciellere Beweisführung über die ein-
zelnen Punkte hier an dieser Stelle natürlich verzichten muss.
Dass der Nikepyrgos vor dem Bau der Propyläen eine
andere Gestaltung gehabt, ist schon vielfach vermutet und
ausgesprochen worden; die Bestätigung dessen und die Form
dieser Gestaltung gab die nordöstlich vom Niketempel auf-
gedeckte Stützmauer (MM) aus Burgkalkstein, welche in
einer nur wenig von der Terr pelaxe abweichenden Richtung
sich hinzieht und in ihrer westlichen Verlängerung noch ein-
mal an der Nordmauer des Pyrgos zum Vorschein kommt.
Sie bildete die Nordgrenze, als der westliche Stirnpfeiler (W)
des Krepidoma der Südhalle erbaut wurde; sonst hätte der-
selbe nicht als nach allen Seiten freistehend charakterisirt
werden können. West- und Südseite des Pyrgos mögen un-
gefähr mit den jetzigen Grenzen zusammengefallen sein.
Oestlich schloss die brauronische polygone Stützmauer mit
dem kleinen marmorinkrustirten Megaron davor den Vor-
sprung gegen das Hochplateau der Burg ab. Dass dieser
Pyrgos bei der Lage des unten vorüberführenden Weges
für die Verteidigung ganz besonders geschaffen war, ist klar;
ebenso ist anzunehmen, dass derselbe ein oder mehrere Heilig-
tümer getragen; doch zu wissen wo speciell letztere gelegen
und wie sie gestaltet, werden wir uns bescheiden müssen.
Seine heutige erhöhte, zum Teil coupirte, zum Teil er-
weiterte Gestalt mit dem krönenden Tempel erhielt der Pyr-
gos nach, jedoch im unmittelbaren Anschluss an den Mnesi-
kleischen Propyläenbau. Mochte die Südhalle ursprünglich
so geplant sein, dass sie den Pyrgos in seiner ganzen Breite
östlich abschloss, also bis zur Südburgmauer reichte, zur
Ausführung ist dieses nicht gekommen; es verblieb ein Raum
zwischen ihr und der Burgkante und der Rest jener brau-
ronischen Stützmauer blieb bestehen. Dieser Flügelbau zeigt
sich jetzt als ein Hallenraum, nach Nord und West geöffnet,
nach Ost und Süd durch noch wolerhaltene Mauern abge-
schlossen ; ebenso ist auch der Marmorplattenboden gut con-
servirt, nur längs der beiden Wände aufgebrochen, um den
Turm genügend zu fundiren, dessen Mauerstärke doppelt so
gross war als die antiken Plinthen. Ebenso ist auch die
44) Zeitschrift für Bauwesen 1880 Heft I—III S. 71 ff.
"*) Archäol. Zeitung 1880 S. 85 ff.
Westmauer des Turmes durch die Aufnahme einer Platten-
reihe besonders fundirt. Unverändert blieb jedoch der west-
liche Antenschluss der Südmauer, unverändert blieben die
3 Plinthen (A B C); letztere gerade auch durch die Bettung
für einen längs der Wände hinlaufenden bankartigen Quader
— wie am Nordflügel und in der Mittelhalle — als in situ
gekennzeichnet. Die westliche Fläche dieser Plinthen ist
allerdings durch den, stehengebliebenen Werkzoll als Ab-
schlüssfläche charakterisirt. Da dieses aber von der Form
der übrigen Stufen abweicht, da auch das durchgehende
Porosfundament PP unter jenen Plinthen als selbständige
Stufe hervortritt, so lässt dieses allerdings den Schluss zu,
dass ursprünglich eine westliche Fortsetzung des Pflasters
hier geplant war, welche unterbleiben musste. Die mittelste
Plinthe (B) hat eine rechteckige Bettung; alle sich daran
schliessenden Zweifel über die Form der hierher gehörigen
Stütze sind durch das Auffinden des betreffenden antenartig
gegliederten Pfeilers gelöst. Die Stereobatquadern der Säulen-
reihe setzten sich aber westlich fort. Denn während das
jetzige Eckstück (D) mit der Säulenbettung südwärts in der
Fläche dieselbe Bearbeitung wie jene Plinthen (A—C) zeigt,
sind bei ihm sowie den darunter liegenden Stufen E und F
sämmtliche Westseiten als Anschlussflächen behandelt, d. h.
mit geschliffenen Rändern, in der Mitte rauh vertieft; dazu
halbe Klammerbänder. Diese Stufen also sowie die untere
Schicht aus eleusinischem Marmor (G) setzten sich genau so
weit fort, wie an der Nordhalle. Ebenso dem Dortigen genau
entsprechend endigte auch hier diese Halle in einem Pfeiler,
nur mit dem Unterschiede, dass dieser nicht den Abschluss
einer von Süden herkommenden Mauer bildete, sondern als
freier Pfeiler mit vier selbständig gegliederten Fronten auf-
tritt. Die sämmtlichen Plinthen desselben inclusive Capital
sowie die dazu gehörigen Gebälkstücke sind vorhanden; es
bestätigt dieses die auch schon von L. Julius45) ausge-
sprochene Vermutung, dass sich das Gebälk um diesen Nord-
westpfeiler verkröpfte, zurücklief bis zu jener restaurirten
Säule (D), von wo es nach Süden umbiegend über den freien
Pfeiler (B) nach der Südwestante lief, letzterer Teil aber nur
in halber Breite, entsprechend der Antenstärke. Diese Lösung
mag allerdings für die Antike etwas befremdlich klingen,
doch ist sie durch die in grosser Vollständigkeit vorhandenen
einzelnen Bauglieder gesichert; dass sie aber im Project ge-
legen habe, ist, gleichwie die Eigentümlichkeit des Stereo-
bats, nicht anzunehmen. Dieselbe musste während des Baues
durch Veränderung des Programms hervorgerufen worden
sein; und diese Aenderung lag eben in der Erhöhung des
Pyrgos und der Herstellung des Tempels der Athena Nike
mit der Thymele davor.
Wir kommen somit zu dem zweiten Teil des Pyrgos, zu
dem Paviment vor der Ostfront des Tempels; von demselben
sind noch einige Platten (H, H, H) in situ durch ihre exacte
Fügung und den unmittelbaren Anschluss an die Südhalle
aljs antik, und durch ihre mit der Tempelaxe parallele Lage
als zu diesem gehörig gesichert. Sie ruhen auf einem Fun-
dament von Porosblöcken, welche nur südlich zur Aufnahme
jener beiden cisternenartigen Behälter (I I) weggebrochen
sind. Ausserdem sind noch in gleicher Höhenlage in situ die
Platte O unmittelbar an den Tempelstereobat stossend, sowie
die beiden unter K und L hervortretenden Platten. Südlich
wird sich eine Grenze nicht mehr feststellen lassen, da die-
selbe schon früh mit der Burgmauer zerstört ist; nur die
untersten Schichten der letzteren sind noch erhalten und
lassen den alten Gang der Mauer erkennen. Wir können
wol annehmen, dass sich das Paviment bis an die Südkante
des Plateaus ausdehnte. Südöstlich lief dasselbe gegen eine
an die Südwestante der Halle sich anschliessende Schwelle
45) Mitteilungen des Deutschen archäol. Instituts zu Athen 1876 Heft 3.